aus Süddeutsche.de, 28. 9. 2015
In der Rubrik Mühen der Erziehung schreibt Michael Neudecker heute in der SZ:
...Eine viel beachtete Studie [über die Langeweile] führten vor drei Jahren die Psychologen Benjamin Baird und Jonathan Schooler von der University of California in Santa Barbara durch. Sie gaben 145 Studenten zwei Minuten Zeit, möglichst viele und möglichst ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für Alltags- gegenstände wie Zahnstocher, Kleiderbügel oder Ziegelsteine aufzulisten. Dann wurden die Studenten in vier Gruppen aufgeteilt: Die eine Gruppe machte mit der Liste weiter, die zweite ruhte sich aus, die dritte hatte eine schwierige, die volle Konzentration beanspruchende Aufgabe zu lösen, und die vierte bekam eine eintönige, unterfordernde Aufgabe. Nach zwölf Minuten wurden alle noch einmal vor die gleiche Aufgabe gestellt wie eingangs, nämlich ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für Zahnstocher und Co. zu finden - und während in den ersten drei Gruppen kaum Unterschiede festzustellen waren, verbesserte sich die vierte Gruppe um 41 Prozent. Die Studenten also, die mit einer simplen Aufgabe gelangweilt wurden, hatten nebenbei ganz offensichtlich die erste und interessantere Aufgabenstellung unterbewusst und ohne Ergebnisdruck weiter bearbeitet.
Aus Sicht des Mediziners liegt das daran, dass in einer Phase, in der das Gehirn kaum gefordert wird, dennoch Aktivitäten feststellbar sind, die dazu führen, dass das Gehirn danach leistungsfähiger ist als zuvor. Aus Sicht der Philosophen, hier der Existenzialismus-Begründer Sartre und Camus, ist die Lange- weile eine der zentralen Erfahrungen, ohne die der Mensch sein eigenes Sein nicht erkennen kann. Und in Erziehungsratgebersprache formuliert: Ein Kind, das nie gelernt hat, seine Langeweile zu überwinden, weiß auch als Erwachsener nicht, was es mit sich anfangen soll, sondern wird im besten Fall zum Multi- tasking-Mutanten.
Nota I. - Muße und Langeweile sind nicht dasselbe. Aber sie sind Cousins.
Nota II. - Eben erst bemerke ich, dass man das Plädoyer für die Langeweile als ein Argument für die Schule missverstehen könnte. Anregend ist die Langeweile aber nur, weil sie dazu verleitet, unversehens in Betrachtung zu versinken; aber doch nicht während des Unterrichts! Die Langweile in der Schule ist töd-lich, weil sie völlig unfruchtbar ist. Lediglich zum Davonlaufen regt sie an, aber das weiß die Schule zu unterbinden. Nov. '15
Nota III. - Das Gegenteil der Langenweile ist anscheinend die Konzentration. Sich konzentrieren kann man trainieren; so sehr, dass es verkrampft, und dann haben wir eine Langeweile höherer Ordnung - typisch für Schüler im oberen, aber nicht dem obersten Leistunggsegment.
Wenn man annimmt, der Leitende Angestellte sei das Bildungsideal unserer Schulen, dann wäre alles in Ordnung. Hält man den aber für historisch überholt, dann wäre es angezeigt, in die Lehrpläne regelmäßige Entkonzentrationsübungen einzubauen. Sport und Kunst wären gut dafür geeignet, wenn sie nicht, wie alles, was die Schule zu bieten hat, Fächer wären. Als solche geben sie ein zu erreichende Maß vor und gebieten, sich darauf zu... konzentrieren. Weil das langweilig ist, wird das Maß zu oft nicht errreicht. Muße ist, wenn ich ein eigenes Maß suchen und finden kann. Konzentrieren wird man sich dann auch, man siehts auf den Gesichtern. Aber es ist das Paradox eines entspannten Konzentrierens, und trägt meist weiter, als alles Vorgegebene.
JE
Montag, 28. September 2015
Freitag, 18. September 2015
Der kleine Unterschied in der Schule.
aus DiePresse.com, 18.09.2015 | 12:32
Mehr Geschlechterunterschiede als gedacht
Buben gehen öfter in Vorschulen oder Sonderschulen. Mädchen besuchen häufiger eine maturaführende Schule.
Mädchen lesen besser, Buben sind besser beim Rechnen. Auf diese Feststellungen werden häufig die Geschlechterunterschiede in der Schule reduziert. Daneben gibt es aber zahlreiche andere Differenzen, die am Donnerstag bei der Veranstaltung "Gleichstellung im Gespräch" im Bildungsministerium aufgezeigt wurden.
Das zeigt sich etwa in den Bildungslaufbahnen: So werden schulpflichtige Buben (62 Prozent) wesentlich häufiger der Vorschulstufe zugewiesen als Mädchen (38 Prozent). Auch in Sonderschulen sind sie deutlich überrepräsentiert (67 Prozent). In der Sekundarstufe II besuchen die Mädchen (56 Prozent) häufiger eine maturaführende Schule (AHS, BHS) als die Burschen (45 Prozent), die selbst wiederum deutlich häufiger eine Lehre absolvieren. Folge sind dann höhere Hochschulzugangs- und -Abschlussquoten bei den Frauen.
Lesefreude unterscheidet sich
Auch die Aussage "Mädchen lesen besser, Buben sind besser in Mathe" muss differenziert betrachtet werden. So haben die diversen Studien wie PIRLS (Volksschule), PISA (15- bzw. 16-Jährige) oder PIAAC (Erwachsene) gezeigt, dass Mädchen am Ende der Volksschule beim Lesen leichte Vorteile gegenüber den Burschen haben, die zum Ende der Pflichtschulzeit stark anwachsen. In der Gesamtbevölkerung zeigen sich dann aber (zumindest derzeit noch) wieder minimale Unterschiede zugunsten der Männer.
Eine Erklärung dafür könnten die Daten zur Lesefreude bzw. Lesehäufigkeit bieten: 15-/16-jährige Mädchen lesen deutlich häufiger zum Vergnügen und äußern deutlich größere Lesefreude - wird das Lesen allerdings nicht nur auf Bücher bezogen, sondern auch auf andere Medien, sind die Unterschiede nur mehr gering bzw. beim Online-Lesen gar nicht mehr vorhanden. Bei Erwachsenen gibt es praktisch keine Unterschiede mehr in der Lesehäufigkeit.
Erwachsene Männer rechnen besser
In der Mathematik sieht es zunächst ähnlich aus: Buben haben leichte Vorteile am Ende der Volksschule, die bis zum Ende der Pflichtschule deutlicher werden. Im Unterschied zum Lesen verschwinden sie aber im Erwachsenenalter nicht, sondern bleiben bestehen. Am Ende der Volksschule haben die Buben etwas mehr Freude an Mathe und weisen ein etwas höheres Selbstkonzept auf - das bedeutet, dass sie ein höheres Bild von sich selbst haben. Auch in der Sekundarstufe II haben die Burschen größeres Interesse und Freude, dazu kommen noch ein höheres Selbstkonzept und eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung - sie trauen sich also viel eher zu, schwierige Lernziele zu erreichen. Das gilt auch bei eigentlich gleicher Kompetenz. Im internationalen Vergleich sind gerade die Unterschiede in der Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Österreich sehr hoch.
Mädchen haben bessere Noten
Im Schnitt bekommen Mädchen in Österreich übrigens bessere Noten als Burschen, auch bei gleicher Kompetenz. Dieser Effekt ist in den Sprachen deutlich, in der Mathematik deutlich geringer ausgeprägt.
Bei ihrem Vortrag plädierte BIFIE-Direktorin Claudia Schreiner dafür, Jugendlichen größere Freiheiten bei der Wahl des Lesestoffs zu überlassen, das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und bei den Lehrerinnen wie Lehrern Bewusstsein für eigene gender-stereotype Sichtweisen zu schaffen. Bildungs -und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) forderte in einer Aussendung ebenfalls ein Umdenken: "Mit der PädagogInnenausbildung neu setzen wir Schwerpunkte im Ausbau der Genderkompetenz angehender LehrerInnen. An der Pädagogischen Hochschule Salzburg wurde eine Professur für Geschlechterpädagogik geschaffen; ein Bundeszentrum für Geschlechterpädagogik wird derzeit eingerichtet." Bereits im Kleinkindalter müsse das Interesse für Technik bei Mädchen und Buben gleichermaßen geweckt werden, um alte Rollenklischees aufzubrechen - "denn sie beeinflussen die spätere Berufswahl - zum Nachteil von Frauen"
Nota. - Das haben Sie ganz richtig gelesen: Mädchen bekommen bessere Noten als Jungen, auch bei gleicher Kompetenz, sogar in Mathematik Die anwesende BildungsinstitutsleiterIn empfiehlt daher, das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken, und die MininsterIn spricht von Rollenklischees zum Nachteil von Frauen. Das hat schon seine Richtigkeit so.
JE
Mehr Geschlechterunterschiede als gedacht
Buben gehen öfter in Vorschulen oder Sonderschulen. Mädchen besuchen häufiger eine maturaführende Schule.
Mädchen lesen besser, Buben sind besser beim Rechnen. Auf diese Feststellungen werden häufig die Geschlechterunterschiede in der Schule reduziert. Daneben gibt es aber zahlreiche andere Differenzen, die am Donnerstag bei der Veranstaltung "Gleichstellung im Gespräch" im Bildungsministerium aufgezeigt wurden.
Das zeigt sich etwa in den Bildungslaufbahnen: So werden schulpflichtige Buben (62 Prozent) wesentlich häufiger der Vorschulstufe zugewiesen als Mädchen (38 Prozent). Auch in Sonderschulen sind sie deutlich überrepräsentiert (67 Prozent). In der Sekundarstufe II besuchen die Mädchen (56 Prozent) häufiger eine maturaführende Schule (AHS, BHS) als die Burschen (45 Prozent), die selbst wiederum deutlich häufiger eine Lehre absolvieren. Folge sind dann höhere Hochschulzugangs- und -Abschlussquoten bei den Frauen.
Lesefreude unterscheidet sich
Auch die Aussage "Mädchen lesen besser, Buben sind besser in Mathe" muss differenziert betrachtet werden. So haben die diversen Studien wie PIRLS (Volksschule), PISA (15- bzw. 16-Jährige) oder PIAAC (Erwachsene) gezeigt, dass Mädchen am Ende der Volksschule beim Lesen leichte Vorteile gegenüber den Burschen haben, die zum Ende der Pflichtschulzeit stark anwachsen. In der Gesamtbevölkerung zeigen sich dann aber (zumindest derzeit noch) wieder minimale Unterschiede zugunsten der Männer.
Eine Erklärung dafür könnten die Daten zur Lesefreude bzw. Lesehäufigkeit bieten: 15-/16-jährige Mädchen lesen deutlich häufiger zum Vergnügen und äußern deutlich größere Lesefreude - wird das Lesen allerdings nicht nur auf Bücher bezogen, sondern auch auf andere Medien, sind die Unterschiede nur mehr gering bzw. beim Online-Lesen gar nicht mehr vorhanden. Bei Erwachsenen gibt es praktisch keine Unterschiede mehr in der Lesehäufigkeit.
Erwachsene Männer rechnen besser
In der Mathematik sieht es zunächst ähnlich aus: Buben haben leichte Vorteile am Ende der Volksschule, die bis zum Ende der Pflichtschule deutlicher werden. Im Unterschied zum Lesen verschwinden sie aber im Erwachsenenalter nicht, sondern bleiben bestehen. Am Ende der Volksschule haben die Buben etwas mehr Freude an Mathe und weisen ein etwas höheres Selbstkonzept auf - das bedeutet, dass sie ein höheres Bild von sich selbst haben. Auch in der Sekundarstufe II haben die Burschen größeres Interesse und Freude, dazu kommen noch ein höheres Selbstkonzept und eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung - sie trauen sich also viel eher zu, schwierige Lernziele zu erreichen. Das gilt auch bei eigentlich gleicher Kompetenz. Im internationalen Vergleich sind gerade die Unterschiede in der Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Österreich sehr hoch.
Mädchen haben bessere Noten
Im Schnitt bekommen Mädchen in Österreich übrigens bessere Noten als Burschen, auch bei gleicher Kompetenz. Dieser Effekt ist in den Sprachen deutlich, in der Mathematik deutlich geringer ausgeprägt.
Bei ihrem Vortrag plädierte BIFIE-Direktorin Claudia Schreiner dafür, Jugendlichen größere Freiheiten bei der Wahl des Lesestoffs zu überlassen, das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und bei den Lehrerinnen wie Lehrern Bewusstsein für eigene gender-stereotype Sichtweisen zu schaffen. Bildungs -und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) forderte in einer Aussendung ebenfalls ein Umdenken: "Mit der PädagogInnenausbildung neu setzen wir Schwerpunkte im Ausbau der Genderkompetenz angehender LehrerInnen. An der Pädagogischen Hochschule Salzburg wurde eine Professur für Geschlechterpädagogik geschaffen; ein Bundeszentrum für Geschlechterpädagogik wird derzeit eingerichtet." Bereits im Kleinkindalter müsse das Interesse für Technik bei Mädchen und Buben gleichermaßen geweckt werden, um alte Rollenklischees aufzubrechen - "denn sie beeinflussen die spätere Berufswahl - zum Nachteil von Frauen"
Nota. - Das haben Sie ganz richtig gelesen: Mädchen bekommen bessere Noten als Jungen, auch bei gleicher Kompetenz, sogar in Mathematik Die anwesende BildungsinstitutsleiterIn empfiehlt daher, das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken, und die MininsterIn spricht von Rollenklischees zum Nachteil von Frauen. Das hat schon seine Richtigkeit so.
JE
Donnerstag, 17. September 2015
Verblöden durch Domestikation.
aus scinexx
Hunde: Dümmer durch Domestikation?
Haushunde schneiden beim selbstständigen Lösen von Problemen schlechter ab als Wölfe
Hunde haben durch ihre enge Beziehung zum Menschen offenbar einiges an Grips und Selbstständigkeit eingebüßt. Denn wenn sie allein ein Problem lösen sollen, verlieren sie schnell die Lust und blicken stattdessen hilfesuchend zum Menschen. Wölfe dagegen knobeln solange, bis sie es geschafft haben, wie ein Experiment belegt. Das Versagen der Hunde spricht dafür, dass die starke Ausrichtung auf uns Menschen ihre Problemlöse-Fähigkeiten hemmt, wie Forscher im Fachmagazin "Biology Letters" berichten.
Hunde sind echte Menschenkenner: Sie folgen unseren Blicken, erkennen unser Lächeln und entnehmen unserer Tonlage selbst feine Nuancen unserer Stimmung. Doch diese Anpassung an den Menschen scheint nicht ohne Kosten zu sein. Bereits 2014 fanden Forscher heraus, dass Hunde schlechter zählen können als ihre wilden Verwandten, die Wölfe.
Monique Udell von der Oregon State University in Corvallis und ihre Kollegen haben nun ein weiteres Indiz dafür gefunden, dass Domestikation die Hunde in gewisser Hinsicht eher dümmer machte. In ihrem Experiment testeten sie, wie gut Wölfe und Hunde eine knifflige Aufgabe lösten. Dafür legten die Forscher im Beisein des Hundes eine Wurst in eine durchsichtige Plastikbox. Ihr Deckel ließ sich jedoch nur abziehen, wenn die Tiere an einem daran befestigten Seil zerrten.
Wölfe schaffen es, Hunde nicht
Wie sich zeigte, lösten acht von zehn Wölfen die Aufgabe problemlos. Sie zerrten und bissen so lange an der Box herum, bis sie den Deckel erfolgreich abgezogen hatten. Nicht so die Hunde: Schon nach kurzer Zeit gaben sie auf und blickten sie hilfesuchend zu dem im Raum anwesenden Menschen. "Die Hunde verbrachten signifikant mehr Zeit damit, zum Menschen hinzusehen, als die Wölfe", berichten die Forscher.

Wölfe tüfteln solange, bis sie die Aufgabe gelöst haben.
Die magere Erfolgsbilanz: Von den zehn Haushunden schaffte es keiner, die Box zu öffnen, unter den zehn Hunden aus dem Tierheim gelang dies nur einem. Und dies änderte sich auch kaum, als der Mensch den Hunden Rückmeldung gab und sie aktiv zum Weitermachen ermunterte. Zwar beschäftigten sie sich dann länger mit der Box, von den 20 Hunden schafften es aber selbst dann nur vier Tierheimhunde und ein Haushund, an die Wurst heranzukommen.
Hilfe suchen statt selbstständig handeln
Nach Ansicht von Udell und ihren Kollegen zeigt dies, dass Wölfe besser darin sind, unabhängig Probleme zu lösen. Diese Fähigkeit scheinen Hunde zumindest zum Teil eingebüßt zu haben. "Hunde sind hypersozial, verglichen mit ihren wilden Gegenparts", erklärt Udell. "Ihre erhöhte soziale Sensibilität könnte ihre Fähigkeiten zum unabhängigen Problemlösen stören."
Oder anders ausgedrückt: Hunde haben sich daran gewöhnt, sich auf den Menschen und seine sozialen Signale zu verlassen. Vor ein Problem gestellt, suchen sie daher bei ihm Hilfe, beispielsweise in Form einer erhellenden Geste. "Hunde könnten gelernt haben, in Abwesenheit klarer menschlicher Hinweise eher vorsichtig zu sein", meint Udell. "Das ist langfristig beim Zusammenleben mit Menschen sicher ein Vorteil."
Die Kehrseite ist allerdings, dass die Hunde auf sich allein gestellt weniger gut klarkommen als ihre wilden Verwandten. Wenn darum geht, Probleme selbstständig zu lösen, verlieren sie schnell die Lust. (Royal Society Biology Letters, 2015; doi: 10.1098/rsbl.2015.0489)
(Royal Society, 16.09.2015 - NPO)
Nota. - Was das in der Konsequenz für die Pädagogik bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Da bedarf es keiner Interpretationshilfe.
JE
Hunde: Dümmer durch Domestikation?
Haushunde schneiden beim selbstständigen Lösen von Problemen schlechter ab als Wölfe
Hunde haben durch ihre enge Beziehung zum Menschen offenbar einiges an Grips und Selbstständigkeit eingebüßt. Denn wenn sie allein ein Problem lösen sollen, verlieren sie schnell die Lust und blicken stattdessen hilfesuchend zum Menschen. Wölfe dagegen knobeln solange, bis sie es geschafft haben, wie ein Experiment belegt. Das Versagen der Hunde spricht dafür, dass die starke Ausrichtung auf uns Menschen ihre Problemlöse-Fähigkeiten hemmt, wie Forscher im Fachmagazin "Biology Letters" berichten.
Hunde sind echte Menschenkenner: Sie folgen unseren Blicken, erkennen unser Lächeln und entnehmen unserer Tonlage selbst feine Nuancen unserer Stimmung. Doch diese Anpassung an den Menschen scheint nicht ohne Kosten zu sein. Bereits 2014 fanden Forscher heraus, dass Hunde schlechter zählen können als ihre wilden Verwandten, die Wölfe.
Monique Udell von der Oregon State University in Corvallis und ihre Kollegen haben nun ein weiteres Indiz dafür gefunden, dass Domestikation die Hunde in gewisser Hinsicht eher dümmer machte. In ihrem Experiment testeten sie, wie gut Wölfe und Hunde eine knifflige Aufgabe lösten. Dafür legten die Forscher im Beisein des Hundes eine Wurst in eine durchsichtige Plastikbox. Ihr Deckel ließ sich jedoch nur abziehen, wenn die Tiere an einem daran befestigten Seil zerrten.
Wölfe schaffen es, Hunde nicht
Wie sich zeigte, lösten acht von zehn Wölfen die Aufgabe problemlos. Sie zerrten und bissen so lange an der Box herum, bis sie den Deckel erfolgreich abgezogen hatten. Nicht so die Hunde: Schon nach kurzer Zeit gaben sie auf und blickten sie hilfesuchend zu dem im Raum anwesenden Menschen. "Die Hunde verbrachten signifikant mehr Zeit damit, zum Menschen hinzusehen, als die Wölfe", berichten die Forscher.

Wölfe tüfteln solange, bis sie die Aufgabe gelöst haben.
Die magere Erfolgsbilanz: Von den zehn Haushunden schaffte es keiner, die Box zu öffnen, unter den zehn Hunden aus dem Tierheim gelang dies nur einem. Und dies änderte sich auch kaum, als der Mensch den Hunden Rückmeldung gab und sie aktiv zum Weitermachen ermunterte. Zwar beschäftigten sie sich dann länger mit der Box, von den 20 Hunden schafften es aber selbst dann nur vier Tierheimhunde und ein Haushund, an die Wurst heranzukommen.
Hilfe suchen statt selbstständig handeln
Nach Ansicht von Udell und ihren Kollegen zeigt dies, dass Wölfe besser darin sind, unabhängig Probleme zu lösen. Diese Fähigkeit scheinen Hunde zumindest zum Teil eingebüßt zu haben. "Hunde sind hypersozial, verglichen mit ihren wilden Gegenparts", erklärt Udell. "Ihre erhöhte soziale Sensibilität könnte ihre Fähigkeiten zum unabhängigen Problemlösen stören."
Oder anders ausgedrückt: Hunde haben sich daran gewöhnt, sich auf den Menschen und seine sozialen Signale zu verlassen. Vor ein Problem gestellt, suchen sie daher bei ihm Hilfe, beispielsweise in Form einer erhellenden Geste. "Hunde könnten gelernt haben, in Abwesenheit klarer menschlicher Hinweise eher vorsichtig zu sein", meint Udell. "Das ist langfristig beim Zusammenleben mit Menschen sicher ein Vorteil."
Die Kehrseite ist allerdings, dass die Hunde auf sich allein gestellt weniger gut klarkommen als ihre wilden Verwandten. Wenn darum geht, Probleme selbstständig zu lösen, verlieren sie schnell die Lust. (Royal Society Biology Letters, 2015; doi: 10.1098/rsbl.2015.0489)
(Royal Society, 16.09.2015 - NPO)
Nota. - Was das in der Konsequenz für die Pädagogik bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Da bedarf es keiner Interpretationshilfe.
JE
Dienstag, 15. September 2015
Mythos Trauma.
Von Dr. Abigail Zuger
Bei all den begründeten Interessen, die in der gegenwärtigen medizinischen Landschaft lauern, ist es kein Wunder, dass die wissenschaftliche Methodik manchmal beiläufig Schaden nimmt. Fälle von verschwiegenen oder manipulierten Daten sind wie finstere Typen in einem schlechtbeleumdeten Viertel: Stets wird über sie gemunkelt, aber keiner wagt sich wirklich an sie ran.
Auch Leser, die keinen persönlichen oder beruflichen Bezug zum sexuellen Kindesmissbrauch haben, werden darum „The Trauma Myth“ mit Gewinn lesen – ein kurzer Abriss eines ganz besonders belasteten Kapitels.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Harvard Universität hat die Psychologin Susan A. Clancy Mitte der neunziger Jahre erwachsene Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch interviewt in der Erwartung, die konventionelle Weisheit bestätigt zu finden, je traumatischer der Missbrauch war, um so gestörter ist das Kind als Erwachsener. „Alles, was ich bis dahin
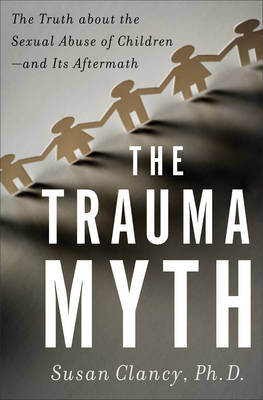 wusste, wies darauf hin, dass der Missbrauch ein furchtbares Erlebnis ist und dass das Kind durch das Geschehen von Furcht, Schreck und Grauen traumatisiert wird.“
wusste, wies darauf hin, dass der Missbrauch ein furchtbares Erlebnis ist und dass das Kind durch das Geschehen von Furcht, Schreck und Grauen traumatisiert wird.“Doch ihre vielen sorgfältig dokumentierten Interviews erbrachten nichts dergleichen. Gewöhnlich war der Missbrauch für das Kind verstörend gewesen, aber nicht traumatisch in dem üblichen Sinn des Worts. Erst wenn das Kind alt genug wurde, um das Geschen wirklich zu begreifen – manchmal viele Jahre später -, traten Furcht, Schreck und Grauen ein. Und erst zu diesem Zeitpunkt wurde die Erfahrung traumatisch und begann ihre bekannte zerstörerische Wirkung.
Dr. Clancy überprüfte ihre Ergebnisse, fand sie bestätigt und war überzeugt. Und als sie ihre Daten veröffentlichte, war ihr Publikum zutiefst empört.
Erstens schlugen ihre Daten etlichen Jahrzehnten politisch korrekter Traumatheorie, dem Feminismus und der sexueller Aufklärungsarbeit ins Gesicht.
Zweitens fand Dr. Clancy, dass die Welt wenig Geschmack für wissenschaftliche Subtilitäten hat: „Leider übersetzten die Leute meine Wort ‚nicht traumatisch im Moment des Geschehens’ mit ‚Es schadet den Opfern auch später nicht’. Einige meinten, schlimmer noch, ich gäbe den Opfer die Schuld am Missbrauch.“
Dr. Clancy erzählt, wie sie in wissenschaftliche und Laienkreisen zum Paria wurde. Sie wurde in der Presse als „Freundin der Pädophilen“ gekreuzigt, Kollegen boykottierten ihre Kolloquien, und wohlmeinende Ratgeber meinten, wenn sie so weitermachte, verbaue sie sich jede Möglichkeit einer akademischen Laufbahn.
All der Krakeel um ein kleines Wort – „Trauma“ – und eine Verschiebung des Zeitplans. Was kann daran so entscheidend sein?
Dr. Clancy vermutet mehrere Gründe für derlei Leidenschaft. Doch vor allem wurde ein ganzes akademisches und therapeutisches Gebäude auf dem alten Modell des sexuellen Missbrauchs errichtet; ihre Ergebnisse könnten einen Berg von teuren Behandlungen und Präventionsprojekten untergraben.
Doch sei es gerade ihr Modell, das den Opfern wirklich helfen könnte. Erwachsener Opfer von Kindesmissbrauch sind in der Regel tief beschämt davon, wie sie sich als Kinder verhalten hatten. Weil sie sich nicht gewehrt oder um Hilfe geschrieen hatten, verdächtigen sie sich selber der Mittäterschaft. Es kann sehr erleichternd für sie sein, zu erfahren, dass ihre Reaktion oder deren Ausbleiben ganz normal war.
Dr. Clancys Modell bringt auch Licht in das leidige Thema verdrängter Erinnerungen.
 Wirkliche traumatische Erlebnisse werden in der Regel lebhaft erinnert. Doch wenn Momente sexuellen Missbrauchs lediglich eine von vielen Verstörungen sind, die die Kindheit kennzeichnen, können sie durchaus vergessen werden. „Warum soll ein Kind sich daran erinnern, wenn sie im Moment des Geschehens selbst nicht sonderlich traumatisch waren?“ Erst wenn sie neu aufarbeitet und wirklich verstanden werden, werden sie zum Brennpunkt.
Wirkliche traumatische Erlebnisse werden in der Regel lebhaft erinnert. Doch wenn Momente sexuellen Missbrauchs lediglich eine von vielen Verstörungen sind, die die Kindheit kennzeichnen, können sie durchaus vergessen werden. „Warum soll ein Kind sich daran erinnern, wenn sie im Moment des Geschehens selbst nicht sonderlich traumatisch waren?“ Erst wenn sie neu aufarbeitet und wirklich verstanden werden, werden sie zum Brennpunkt.Auch ohne diese Konsequenzen ist die Moral von Dr. Clancys Geschichte klar: Wissenschaft sollte der Wahrheit dienen, nicht dem Wunschdenken. Wenn harte Daten einer liebgewordenen Theorie widersprechen, muss die Theorie weichen.
Dr. Clancy schreibt mit der Präzision und Geduld eines guten Lehrers auf schwierigem Terrain. Ihr Stil könnte nicht klarer sein und ihre Argumente werden ein ums andere Mal demonstriert. Aber bei Amazon.com hat sie ein entrüsteter Leserrezensent bereits niedergemacht. „Es ist bedrückend“, schrieb er, „dass ‚Experten’ wie Susan Clancy ein Buch in den Druck bringen können, dessen Titel nicht nur falsch ist, sondern das auch noch Sexualverbrechern sagt, ‚Macht weiter so, missbraucht Kinder sexuell, sie mögen das und sie werden nicht einmal davon traumatisiert’.“
Wissenschaft ist nicht stets der Begleiter einer guten Gesinnung, und guter Schreibstil offenbar auch nicht.
Montag, 7. September 2015
Mädchen bekamen schon immer bessere Noten.

7. 9. 2015
Das Geschlecht der Lehrkraft hat keinen Einfluss auf den Bildungserfolg von Schülern
Jungen schneiden schlechter in der Schule ab als Mädchen. Schuld daran ist aber nicht der hohe Anteil weiblicher Lehrkräfte, wie oft vermutet wird. Bildungsforscher Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zeigt in einer Überblicksstudie, dass das Geschlecht der Lehrkraft keinen nachweisbaren Einfluss auf den Bildungserfolg von Schülern hat. Der WZB-Forscher wertete 42 Studien mit Daten zu 2,4 Millionen Schülerinnen und Schülern aus 41 Ländern aus.
Die Studien zeigen, dass Lehrkräfte des jeweils gleichen Geschlechts die schulischen Leistungen von Jungen und Mädchen nicht verbessern. Mädchen profitieren nicht von Lehrerinnen, Jungen nicht von Lehrern: Sie erwerben durch sie weder höhere Kompetenzen, noch erhalten sie bessere Noten.* Sie werden von ihnen auch nicht öfter für eine höhere Schulform empfohlen. „Damit fehlt die empirische Basis für politische Programme, die durch mehr männliche Lehrer die Bildungskrise der Jungen lösen wollen“, sagt WZB-Bildungsforscher Helbig.
Er fand in der Forschungsliteratur auch keinen Beleg dafür, dass sich die Schulleistungen der Jungen in den letzten Jahrzehnten verschlechtert hätten. „Mädchen bekamen schon immer bessere Schulnoten als Jungen“, schreibt Helbig, der in diesem Zusammenhang auf eine weitere Analyse von 369 Studien verweist. Sie zeige, dass es zwischen 1914 und 2011 keine Veränderung der Notenunterschiede zwischen Mädchen und Jungen gegeben hat. Dieser Befund stützt die Annahme, dass sich Mädchen seit jeher besser in der Schule zurechtgefunden haben.
Dass Jungen schlechter in der Schule abschneiden, führt der WZB-Forscher auf Unterschiede in der Leistungsbereitschaft zurück. Mädchen seien oft disziplinierter und fleißiger, was sich in besseren Noten niederschlage. Das Problem: Fleißig zu sein, gilt unter Jungs als uncool. „Sich für gute schulische Leistungen anzustrengen und sich selbst zu disziplinieren, passt nicht in das geschlechtstypische Konzept von Männlichkeit“, erklärt Helbig. Ob und wie Schule an diesem Rollenverhalten etwas ändern kann, ist für den Forscher eine offene Frage.
Marcel Helbig: Brauchen Mädchen und Jungen gleichgeschlechtliche Lehrkräfte? Eine Überblicksstudie zum Zusammenhang des Lehrergeschlechts mit dem Bildungserfolg von Jungen und Mädchen. Erschienen in: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online, Beltz Juventa 2015.
*) für dieselben Leistungen, Herr Helbig! JE
Nota. - In diesem unsern Land in dieser unsern Zeit folgt darauf mit mathematischer Sicherheit: Wenn sich Jungens in der Schule nicht anstrengen wollen, dann muss man sie ändern. Ich dagegen finde: Schule is nix und war noch nie was für Jungen. Diese und nicht die Jungen muss man ändern - oder womöglich abschaf-fen. Denn dass Jungen sind wie sie sind und Männer sind wie sie sind, ist in Ordnung und nicht beanstan-denswert.
JE
Donnerstag, 3. September 2015
Die Lehrerpersönlichkeit kann man nicht lernen.
Die FAZ, die nicht wünscht, dass ich ihre Artikel übernehme, brachte unterm Titel Die Lehrerper- sönlichkeit kann man nicht lernen am 31. 8. 2015 ein langes Interview von Julia Schaaf mit dem Berliner Pädagogen Dirk Stötzer. Hier einige Auszüge:
...Was ist mit den Dauerkranken, Schlechtgelaunten, Totalgestressten? Ihr Buch legt nahe, dass solche Lehrer nicht Opfer widriger Rahmenbedingungen sind, sondern die falsche Persönlichkeit mitbringen.
Das ist aus meiner Sicht ein Hauptproblem. Die Lehrerpersönlichkeit ist entscheidend. Wir reden in der Ausbildung viel zu viel über Methodenvielfalt. Dabei kommt es letztlich darauf an, wie jemand vorne vor der Klasse steht. Ein Lehrer muss den Schülern vermitteln: Ich weiß mehr als ihr; ihr könnt von mir was lernen. Und wenn er die Schüler dazu bringt, dass sie das auch wollen, ist der große Schritt getan. Ich habe vielen Referendaren beim Staatsexamen gesagt: Überlegen Sie sich das noch mal. Halten Sie das wirklich 40 Jahre durch? Oder sind Sie vielleicht nach sechs, sieben Jahren ausgebrannt und werfen hin?
Warum?
Wenn Lehrer diese gewisse Ebene mit den Schülern nicht finden, müssen sie in jeder Stunde 150 Prozent geben, um überhaupt vernünftigen Unterricht machen zu können. Die versuchen dann mit Strenge und Strafen durchzusetzen, was ihnen an Führungspersönlichkeit fehlt. Das ist unheimlich anstrengend. Und ich habe viele Kollegen gesehen, die deshalb irgendwann zusammengebrochen sind. Wer in dem Job nicht glücklich ist und leidet, endet als Wrack.
Der renommierte Bildungsforscher John Hattie sagt: Das Wichtigste für den Lernerfolg der Kinder ist ein guter Lehrer.
Das habe ich lange vor Hattie gesagt. Das Problem ist nur: Persönlichkeit kann man nicht lernen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist abgeschlossen, wenn Lehrer ins Referendariat kommen. Deshalb müsste man sich vorher fragen: Bin ich der richtige für den Lehrerberuf?
Was braucht es denn, wenn es nicht die gute Ausbildung ist: Charisma? Begabung?
Der erste Auftritt ist entscheidend. In meiner eigenen Schulzeit haben wir in der siebten Klasse in Latein zwei Lehrerinnen verschlissen. Die haben wir nicht ernst genommen, nach kurzer Zeit gaben sie auf. Dann kam ein neuer Kollege, und schon als er die Tür aufmachte und den Klassenraum betrat, war für uns klar: Von dem geht eine Aura aus, den schaffen wir nicht.
Wie war Ihr erster Auftritt?
Fatal. Musikunterricht in der 9b, und als ich den Klassenraum betrat, nahm niemand Notiz von mir. Keiner meinte, sich an seinen Platz begeben zu müssen; alle waren am Reden. Dann haben die Schüler versucht zu provozieren. Ich war damals 25 und wurde gefragt, ob ich eine Freundin habe. Als der Begriff „Libretto“ fiel, ging es plötzlich darum, ob das eine Form des Vibrators sei.
Ich habe versucht, nicht auf das Thema einzusteigen. Wir kamen dann ins Gespräch, und langfristig hat sich ein gutes menschliches Verhältnis entwickelt. Aber Unterricht, und das ist das Entscheidende, war schlicht nicht möglich.
Nach vier Jahrzehnten Schuldienst sagen Sie: Lehrer ist der beste Beruf der Welt.
Das meine ich ernst. Mit jungen Leuten zu arbeiten ist toll. Und da Lehrer heutzutage gern in ein schlechtes Licht gerückt werden, will ich Interessenten Mut machen. Wer für diesen Beruf geeignet ist und sich engagiert, findet eine sehr erfüllende Tätigkeit, die über viele Jahre hinweg abwechslungsreich bleibt. Wenn ich heute im Fernsehen einen ehemaligen Schüler sehe als Schauspieler, als Oberkirchenrat, als Sportmoderator, freue ich mich und denke: An dieser Entwicklung bin ich, wenn auch nur zentimeterweise, beteiligt gewesen.
Lehrer jammern gern: Die Klassen seien zu groß, die Schulen marode, und außerdem würden die Schüler immer schwieriger. Übertrieben?
An manchen Stellen schon. Ich sage immer im Scherz, man sollte das Jammern in die Lehrerausbildung übernehmen. Offenbar gehört es dazu. Dabei werden damit oft eigene Schwächen übertüncht. Wenn ein Lehrer klagt, er könnte nicht unterrichten, weil die Decke in seinem Klassenzimmer nicht schön gestrichen sei, hängt das nicht miteinander zusammen. Das ist der Versuch, eine Minderleistung abzuwälzen.
...
Der Lehrer muss führen?
Jeder Lehrer ist Führungskraft. Das ist ja auch das Schwierige, dass wir ohne Erfahrung in diese Position gesteckt werden. Wenn Sie Ingenieur werden, sitzen Sie im Büro, kröseln vor sich hin und steigen vielleicht irgendwann auf. In der Schule werden sie unvorbereitet in so eine Position geworfen.
Sie haben auch eine Checkliste, um die eigene Persönlichkeit für den Lehrerberuf zu testen. Worauf kommt es besonders an?
Dass man Kinder mag. Überraschungen vertragen kann. Nicht zu lärmempfindlich ist. Und Humor. Eine Unterrichtsstunde, in der nicht mindestens einmal gelacht wird, ist eine schlechte Stunde.
„Superlehrer, Superschule, supergeil: Der beste Beruf der Welt“ von Dirk Stötzer und Beate Stoffers, 352 Seiten, 12,99 Euro, ist gerade im Goldmann Verlag erschienen.
Nota. - Schön altmodisch, nicht wahr? Und man merkt ihm an, dass er in dem Teil der Stadt Lehrer war, an dem das Jahr '68 spurlos vorübergegangen ist. Namentlich das mit dem Führen würde ein Ex-Antiautoritärer noch heute nicht über die Lippen bringen. Es ist auch wirklich diskutabel - in dem Sinn, dass man einige einschränkende Bedingungen hinzusetzen muss. Entscheidend ist aber der Satz, dass es auf die Person des Pädagogen ankommt, das haben nicht nur Hr. Stötzer und Mr. Hattie, sondern das haben schon viele, die was von dem Beruf verstanden haben, vor ihnen gesagt.
Dem Bild der Führungskraft ziehe ich das Bild des Performing artist vor. Der erwartet nicht, dass die andern seinem Vorbild folgen. Er will Eindruck machen, das schon, weiß aber auch, dass er nur wenig Kontrolle darüber hat, welchen. Er muss es einfach drauf ankommen lassen. Und weiß dabei: Er steht ganz allein auf der Bühne, auf einen Sympathievorschuss seines Publikums kann er nicht rechnen, denn die sitzen alle nicht freiwillig da. - Da braucht man schon breite Schultern.
JE
Nota. - Schön altmodisch, nicht wahr? Und man merkt ihm an, dass er in dem Teil der Stadt Lehrer war, an dem das Jahr '68 spurlos vorübergegangen ist. Namentlich das mit dem Führen würde ein Ex-Antiautoritärer noch heute nicht über die Lippen bringen. Es ist auch wirklich diskutabel - in dem Sinn, dass man einige einschränkende Bedingungen hinzusetzen muss. Entscheidend ist aber der Satz, dass es auf die Person des Pädagogen ankommt, das haben nicht nur Hr. Stötzer und Mr. Hattie, sondern das haben schon viele, die was von dem Beruf verstanden haben, vor ihnen gesagt.
Dem Bild der Führungskraft ziehe ich das Bild des Performing artist vor. Der erwartet nicht, dass die andern seinem Vorbild folgen. Er will Eindruck machen, das schon, weiß aber auch, dass er nur wenig Kontrolle darüber hat, welchen. Er muss es einfach drauf ankommen lassen. Und weiß dabei: Er steht ganz allein auf der Bühne, auf einen Sympathievorschuss seines Publikums kann er nicht rechnen, denn die sitzen alle nicht freiwillig da. - Da braucht man schon breite Schultern.
JE
Abonnieren
Posts (Atom)






