
Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flämmchen, die entfacht sein wollen.
 François Rabelais zugeschrieben
François Rabelais zugeschriebenI. Homo ludens victor
II. Taugt Erziehung zur Wissenschaft?
III. Herbarts Einsicht…
IV. Vom schönen Schein des Wahren
Die Erfindung des Kindes und die Bestimmung des Menschen
aus: PÄD Forum 2/2003
Die Weltzeit ist ein spielender Knabe, der auf dem
Brett die Steine hin und herschiebt: Dem Knaben das Reich!
Heraklit, fr. B 52
Reife des Mannes: das heißt den Ernst wieder-
finden, den man als Kind hatte, beim Spiel.
Fr. Nietzsche
Ein Freigelassener der Schöpfung
Joh. Gottfried Herders Wort, daß „jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird“,1 ist allen professionellen Pädagogen aus dem Herzen gesprochen. Zwar hatte er gerade erst den Menschen als „den ersten Freigelassenen der Schöpfung“2 erkannt. Indem sich aber die Gattung durch eine „zweite Genesis“3 zum Kulturwesen gebildet hat, haben die Individuen ihre eben gewonnene Freiheit gleich wieder verspielt: „Alle Erziehung kann nur durch Nachahmung und Übung, also durch Übergang des Vorbilds ins Nachbild werden.“4 Freigelassen aus der Natur, wird der Mensch zum Lakai der eignen Überlieferung: „In welche Hände er fällt, so wird er.“5 Es konnte nicht fehlen, daß in dieser wundervollen Vieldeutigkeit seither allerlei Machtträume der pädagogischen Zunft ihren Nährboden fanden.
In Herders Ideen
stehen geniale Geistesblitze, die bis heute die Forschung beleben,
neben mancher Schrulle und mancher Naivität. Namentlich die
(unausgesprochene, weil allzu nahe liegende) Annahme, daß es sich bei
den ‚zwei Naturen’ des Menschen um zwei Stufen handelt, die zeitlich auf einander folgen, führt in die Irre. Der ur-springende Punkt bei der
Menschwerdung ist allerdings der aufrechte Gang: Er hat erst die
physische und, durch die Dissoziierung von Hand und Kopf, die mentale
Entwicklung der Spezies auf eine völlig neue, in der Natur bislang noch
nicht ‚vorgesehene’ Bahn gestellt. Aber seine ‚erste’ Natur hat er ja
nicht hinter sich gelassen! Natürlich bleibt er weiter in sie
verstrickt, sie wirkt bis in seine ‚zweite’, geistige Existenz hinein
(und ob er in dieser Hinsicht wirklich „frei“ ist, wird von der
hirnphysiologischen Forschung durchaus in Frage gestellt). Aber das gilt
auch umgekehrt. Seine Entwicklung als Kulturwesen hat rückwirkend seine
Stammesgeschichte umgedeutet – und hat physiologische Folgen gezeitigt.
Unreife als Gattungscharakter
Daß
wir pädagogische Probleme überhaupt kennen, ist offenbar die Folge
unserer biologischen Sonderstellung: „Das menschliche Kind kommt
schwächer auf die Welt als keins der Tiere“,6
nur darum muß – und kann – es erzogen werden. Die Gründe sind
physiologischer Art: „offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ist,
die im Mutterleib nicht ausgebildet werden konnte. Der Mensch allein
bleibt lange schwach, denn sein Gliederbau ist, wenn ich so sagen darf,
dem Haupt zuerschaffen worden, das übergroß im Mutterleib zuerst
ausgebildet ward und also auf die Welt tritt.“7.
Der Schweizer Biologe Adolf Portmann sprach Mitte des vorigen Jahrhunderts geradezu von einer ‚extra-uterinen Embryonalzeit’ des Menschen: Im Vergleich mit allen andern Säugetieren sei der Mensch eine „physiologische Frühgeburt“, eigentlich „müßte unsere Schwangerschaft etwa um ein Jahr länger sein als sie tatsächlich ist“,8 und so bildet sich das höchstentwickelte Säugetier gewissermaßen ‚zurück’ zu einem sekundären Nesthocker! Dieser ‚Rückschritt nach vorn’ bestimmt fortan seinen ganzen Gattungscharakter.
Doch war die „enorme Gehirnentwicklung des Menschen und die vielleicht damit zusammenhängende Umstrukturierung der gesamten Physis in Richtung auf ‚Embryonalisierung’ und ‚Primitivität’ keineswegs eine Folge des Kampfes ums Dasein“ und nicht das Resultat eines Auslesevorgangs, wie eine an Darwin orientierte Orthodoxie vermuten würde, „sondern durch direkte innere Ursachen provoziert“, und diese endogene „Umstimmung“ des Menschen war „so radikal, daß sie ihn aus allen ‚natürlichen’ Lebensbedingungen hinauswarf und auf eine sonst nicht vorhandene und neuartige Lebensführung“ verwies, meint der Philosoph und Kultursoziologe Arnold Gehlen9 - im unmittelbaren Anschluß an Herder: „Das Tier ist, was es ein soll. Der Mensch allein ist im Widerspruch mit sich und mit der Erde, denn das ausgebildetste Geschöpf unter all ihren Organisationen ist zugleich das unausgebildetste in seiner eigenen neuen Anlage.“10
Was aber bedeutet ‚Ausbildung’ in der Natur? Anpassung an die gattungsmäßig vorgegebene Umweltnische, Ausbildung für eine spezifische Funktion im ökologischen Geflecht. Natürliches Reifen ist nichts anderes als Spezialisierung: Sie ist „das Endziel organischer Entwicklung“ und findet „bei allen Säugern außer dem Menschen“11 statt. Das ist das Paradox der Species humana: Deren Reifung ist eine „Spezialisierung auf Nicht-Spezialisiertsein“,12 ihre Ausbildung ist eine Entspezialisierung, ihre Reife ist Dysfunktionalität.
Was für das umweltgebundene Tier eine Minderung wäre, wurde für den Menschen, der sich eine Welt erschließen sollte, zum Gewinn, denn „unter Spezialisierung ist zu verstehen der Verlust der Fülle der Möglichkeiten, die in einem unspezialisierten Organ liegen, zugunsten der Hochentwicklung einiger dieser Möglichkeiten auf Kosten anderer“.13 Das spezialisierte Wesen ist fest-gestellt. „Für ein Tier ist durch seine umweltgebundene Organisation von vornherein darüber entschieden, ob und inwiefern ein Naturbestandteil dieses Wesen etwas angeht. Die weltoffene Anlage des Menschen schafft dagegen eine völlig andere Beziehung zu der umgebenden Natur. Uns kann jeder noch so unscheinbare Teilbestand der Umgebung bedeutend werden, jede beliebige Einzelheit vermögen wir durch unsere Beachtung aus dem indifferenten Feld der Wahrnehmung herauszulösen und hervorzuheben. Uns kann alles etwas angehen.“14 Verloren ging die Sicherheit, und gewonnen hat er eine Freiheit, durch die ihm die „Führung des Daseins eine nie endende Aufgabe“15 ward. Mit andern Worten, der Mensch funktioniert nicht; weil er, nach Nietzsche, „das nicht festgestellte Tier“16 ist.
Der Sündenfall
Dabei schienen doch seit der Aufklärung Funktionalität und Vernunft beinah dasselbe zu sein; in der aufgeklärten Pädagogik schon gar. Und sah dabei so aus, als hätte sie nach langer Irrung den Menschen endlich seiner natürlichen Bestimmung zugeführt!
Am Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und dort seine eigne kleine Umweltnische ausbildete – denn da drinnen mußte nach und nach alles wieder recht ordentlich funktionieren. Das war die Erfindung des Ackerbaus vor vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung der Arbeit.17 Nun hatte auch der Mensch sein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden mußte. Solange die Arbeit einfach war, fand sie ihre Schranke lediglich an der jeweiligen Körperkraft. Man konnte in sie hineinwachsen, nach und nach, learning by doing. Doch Arbeit und Funktionalität, das bedeutet Arbeits-Teilung. Geteilte Arbeit ist spezialisierte Arbeit. Und je besonderer die Arbeit, umso perfekter wird sie. Ausbildung bekommt einen neuen, aparten Sinn. Im zünftigen Handwerk der mittelalterlichen Städte tritt die Figur des Lehrlings auf, der als Kind in den Haushalt seines Meisters eintritt, unter dessen Munt er zum Gesellen reift – selber „mündig“ wird er freilich erst, wenn er seinen eignen Hausstand gründet.
Die vollendete, ‚ausgebildete’ Form der Arbeitsgesellschaft ist die Marktwirtschaft: Alles hat seinen Preis. Jetzt müssen die Arbeiten gegeneinander austauschbar, ihre Qualität muß meß- und vergleichbar sein. Die Nützlichkeit der einen Sache muß sich in der Nützlichkeit der andern Sache darstellen lassen: An die Stelle der Gebrauchswerte tritt der Tauschwert – der Wert der Nationalökonomen: eine Art ‚Nützlichkeit schlechthin’. Das ist die Logik der Arbeitsteilung: die Reduktion der Qualitäten auf komplex zusammengesetzte Quantitäten; das Absehen von der Stoff- und das Hervorkehren der Formseite; die Auflösung einer jeden Substanz in ihr Herstellungsverfahren; die Reduktion von Qualität auf Technik; von lebendiger Anschauung auf Analyse.
Die Arbeit selbst muß so werden, daß die eine „die andere wert“ ist. Sie braucht von nun an Standards, damit man sie messen, vergleichen und austauschen kann. An die Stelle des meisterlichen Zunfthandwerkers tritt der ‚allgemein-qualifizierte’ Fachmann, der Berufsmensch. Einer der „konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur“ ist, nach Max Weber, „die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee“.18 Der Professionelle, der sein Fach gewählt hat und dessen Arbeitskraft so durchgebildet ist, daß sie dem öffentlichen Vergleich mit jedem andern standhält, ist von da an der Inbegriff des Normalmenschen. Er ist der Erwachsene. Seine Merkmale sind erstens Spezialisierung und zweitens Austauschbarkeit.
An die Stelle der kunsthandwerklichen persönlichen Lehre im Haushalt des Meisters treten nun die unpersönlichen Curricula der öffentlichen Anstalt Schule. „Die Schule ist als Mittel der Erziehung an die Stelle des Lehrverhältnisses getreten. Das bedeutet, daß sich das Kind nicht länger einfach nur unter die Erwachsenen mischt und das Leben direkt durch den Kontakt mit ihnen kennenlernt“, schreibt Philippe Ariès;19 ja in gewissem Sinn, nämlich als ein besonderer gesellschaftlicher Stand wird das Kind jetzt überhaupt erst erfunden: Von nun an wird es „in einer Art Quarantäne gehalten, ehe es in die Welt entlassen wird. Damit beginnt ein langer Prozeß der Einsperrung der Kinder (wie der Irren, der Armen und der Prostituierten), der bis in unsere Tage nicht zum Stillstand kommen sollte.“20 Die ‚Geschichte der Kindheit’ in ihrem modernen Verständnis ist nichts anderes als die Geschichte ihrer Verschulung. Das Kind wird zur Raison gebracht und wird zum gegebenen Zeitpunkt dem Erwachsenen Platz machen – spezialisiert, aber austauschbar.
Residuum I: das Kind
Das ist eine Revolution im Lebensroman der Individuen. Denn es bedeutet nichts anderes, als daßseither „zwei gesonderte Stände des menschlichen Lebens“ einander gegenüber stehen, zwischen denen „heute ein Abgrund klafft“,21,22 schrieb der holländische Psychiater J. H. van den Berg vor vierzig Jahren. Doch „das Kind ist zum Kind geworden. Das Kind ist kindlich nur in Bezug auf das Nicht-Kindliche, das Erwachsene. Die Ursachen der veränderten Art des kindlichen Daseins müssen in der veränderten Art der Erwachsenheit liegen.“ Nicht die Erwachsenen haben das Kind aus ihrem Kreis ‚ausgegrenzt’, sondern sie haben sich selbst aus der Menge der Unzivilisierten hervorgehoben.23 Das Kind bliebt zurück. Während Sozial- und Wirtschaftshistoriker dazu neigen, in der Geschichte der modernen Kindheit vor allem auf die neuen Qualitätserfordernisse der industriellen Arbeit zu schauen,24 hebt der Psychiater van den Berg die Austauschbarkeit, die Gleich-Gültigkeit, die Beliebigkeit, die „Polyvalenz“25 der Erwachsenheit hervor – denn die Eigenheit der Markt-Gesellschaft ist es, daß die ‚Werte’ dort zirkulieren! Und darum hat der moderne Mensch nichts mehr, woran er sich halten kann: Er muß sein Leben führen durch die Unwägbarkeiten des Marktgeschehens, muß „einen Weg ins Ungewisse entwerfen, einen Weg durch die Gefahr“.26 Die Kinder können das noch nicht, erst der Erwachsenen kann es; vielleicht. – Die Erwachsenen konnten es, möchte man van den Berg nachrufen; denn als er schrieb, hatte die Erwachsenheit sehr wohl noch ein Maß, das sie auszeichnete, und hatten die ‚Werte’ noch eine Substanz, die sie verband: die Arbeit.
Das Kind ist durch die bürgerliche Gesellschaft bestimmt als der Nicht-Arbeiter. Das ist ein Mangel. Aber in einer Welt, wo Arbeit nur als Lohnarbeit vorkommt, ist es auch ein Segen. Und nur Arbeiter sein, das will auch der Erwachsene nicht. Der Anblick seiner Kinder am Feierabend erheitert ihn. Zeit ohne Uhr und Spiel ohne Rechenschaft, das ist „die begrenzte Ausnahmeregelung, die die bürgerliche Gesellschaft den Kindern gewährt, um im Kind den Erwachsenen einen Trost für ihre seelische Verkrüppelung zu gewähren“.27 Daß seine Kinder zur Schule gehen und dort schonmal den Ernst des Lebens einüben, will der Werktätige nicht wirklich wissen. Sie gehören in den Feierabend. Und sonntags in den Zoo. Schule bedeutet nur Ärger, daran kann sich ein Erwachsener gut erinnern. Die Kindheit ist ein Überbleibsel aus ferner, froherer, verlorener Zeit. Sie ist ein schwachmachendes Denkmal aus unserer Zeit vor dem Sündenfall.
Residuum II: der Künstler
Ein aufreizendes Denkmal ist der Künstler. Die Frage „was ist Kunst?“ mag ewig ungeklärt bleiben – solange man auf die ästhetische Qualität der Werke blickt. Denn da geht es um Geschmacksurteile, und die lassen sich nicht objektivieren. Kurz gesagt, Kunst ist das, was Künstler machen. Das ist keine Tautologie in spöttischer Absicht. Denn was ein Künstler ist, läßt sich durchaus objektivieren – nämlich durch seinen bestimmten Gegensatz, den Arbeiter. Dem Arbeiter ist ein Zweck vorgegeben, als das Bedürfnis, dem sein Produkt zu dienen hat. Tut es das nicht, war seine Arbeit umsonst, so als wäre sie ungetan. Der Künstler dient keinem Zweck, und ob sein Werk einmal auf ein ‚Bedürfnis’ trifft, welches gerade ihm gilt, kann er nicht wissen. Er muß es „darauf ankommen lassen“. Natürlich muß auch er auf den Markt, um zu leben. Wenn er nichts an den Mann bringt, mag er verrückt werden und sich ein Ohr abschneiden. Aber van Goghs Bilder waren Kunst, lange bevor sie ihre Käufer fanden. Nicht wegen einer okkulten immanenten Qualität, sondern weil er ein Künstler war, nämlich einer, der in der selbstgemachten Umweltnische Arbeitsgesellschaft nicht funktioniert.28
Rhetorisch wird oft der Künstler mit dem Kind verglichen: „Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne jede moralische Zurechnung in ewig gleicher Unschuld hat in dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes.“29 Das ist mehr als eine blumige Metapher. Der holländische Verhaltensforscher und Tierpsychologe F.J.J. Buytendijk sekundiert: „Wie der Künstler reflektiert das spielende Kind nicht auf das Wie, Was und Warum seines Tuns. Dabei ist seine Tätigkeit ein wirkliches Unternehmen, das freilich nicht genau auf ein Ziel gerichtet ist, sondern sein Tun hat das Abenteuerliche eines Wagnisses. Es kann gelingen oder nicht.“ Es hat dieselbe Quelle wie die ästhetische Produktion im engeren Sinn: „Das menschliche Spiel ist eine wundersame Freude am Schein. Wir spielen tatsächlich immer mit Bildern, die mit uns spielen.“30
Hans-Georg Gadamer schließt den Kreis: „Sich-Darstellen ist das wahre Wesen des Spiels – und des Kunstwerks.“31 Aber er erinnert: „Der Reiz des Spiels liegt in dem Risiko.“32 Darum ist der Künstler ein aufreizendes Denkmal unserer Vorzeit: weil er gewagt hat. Er hat seinen Weg ins Ungewisse entworfen, einen Weg durch die – ja, doch: durch die Gefahr. Ist er der wahre Erwachsene? Und liegt der Unterschied zwischen Kindlichkeit und Erwachsenheit doch nicht da, wo J.H. van den Berg dachte? Oder nicht mehr da? Oder wieder nicht mehr da? Liegt womöglich unsere Zukunft in unserer Vergangenheit?
…und Residuum III: der Erwachsene!
Die Arbeitsgesellschaft hat uns ‚reifen’ lassen, die industrielle Zivilisation hat uns erwachsen gemacht. Und mit der Industrie veraltet jetzt der Erwachsene! Wir müssen „den Arbeitsmenschen unserer Zeit“33 nicht länger „als die selbstverständliche Norm des rechten Menschenlebens hinnehmen. Die Einschätzung der Arbeit als eine wesentliche Aufgabe des Lebens, als ein höherer Auftrag der Vorsehung, als Quelle von Seelenfrieden, als Sinn der gesellschaftlichen Gliederung, die Taxierung des Berufs als ein Lebenszentrum“ waren „ein sehr spätes Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung“34 – und ein vergängliches.
Die Arbeit ist nicht länger Sinn des Lebens, und nicht einmal noch ‚Maß und Substanz’ des ökonomischen Werts. Ein Kronzeuge hatte es vorausgesehen: „In dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wahren Reichtums abhängig weniger von dem Quantum angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder in keinem Verhältnis stehen zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie. Was Tätigkeit des Arbeiters war, wird Tätigkeit der Maschine.“35 Am Ende tritt der Arbeiter „neben den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört [auf] und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts.“36 Mit andern Worten, das Wertgesetz ‚verfällt’.
Nach
der Erfindung des aufrechten Gangs, nach der Erfindung der Arbeit ist
dies die dritte große Revolution unserer Gattungsgeschichte. Es ist eine
Krisis, und wie sie
ausgeht, weiß keiner. Aber eins wissen wir: daß es nie wieder sein wird,
wie es war. Arbeit für alle wird es nie wieder geben, denn all die
ausführenden Griffe, für die man Kraft braucht und Ausdauer und gute
Nerven, die werden bald die Maschinen verrichten, weil sie es billiger
und zuverlässiger tun. Etwas reproduzieren, was längst da war, wird
nicht länger die Aufgabe lebendiger Menschen sein. Es war auch immer ein
bißchen unter ihrer Würde. Geahnt haben wir es längst, aber von nun an
dürfen wir es wissen, „daß in jedem von uns auch noch ein anderer, ein
alter Adam aus der Zeit vor dem Sündenfall lebendig ist, der sein Recht
fordert und der nicht nur dazu da ist, unterdrückt zu werden“. 37
Werden, was wir waren
Das ist alles kein Spiel mit Worten. Es hat ernste Erwäggründe in der Naturgeschichte des Menschen. Zum Fortschrittsdogma des neunzehnten Jahrhunderts gehörte der Glauben an die Unumkehrbarkeit. Und so gab es auch in der Darwinschen Evolutionslehre keinen Platz für ein Zurück. Eine einmal erreichte Anpassung konnte nur überboten, aber nicht hintergangen werden. Bis der holländische Biologe Louis Bolk vor achtzig Jahren eine beunruhigende Entdeckung machte. „Das ‚Gesetz’ der Irreversibilität der Spezialisierung erfährt nämlich eine gewichtige Ausnahme, sowie Neotenie-Erscheinungen auftreten.“38 Bolk hatte herausgefunden, dass „die menschliche Gestalt sich von ihren Verwandten, den Menschenaffen, durch das Bewahren kindlicher, ja früh fötaler Merkmale unterscheidet. Daß die Kinder von Menschenaffen uns ähnlicher sind als die Erwachsenen, ist die bekannteste dieser Erscheinungen. Die Menschwerdung besteht vor allem in einer Gestaltreifung auf ständig jüngeren Stufen, wobei die Entwicklung selbst verlangsamt ist.“39 Genauer gesagt, in einer Reifungs-Hemmung der unausgebildeten Gestalt! Diese „Retardation“, das frühzeitige ‚Einfrieren’ des normalen Ausbildungsgangs, der von unsern humanoiden Vorfahren erreicht worden war, „kann nur auf eine Aktion des endokrinen Systems zurückgeführt werden“.40 Seine physiologische Kindlichkeit verdankt der Mensch seinen Hormonen.
Doch seine äußere Gestalt ist nicht das, worauf es ankommt, sondern seine Kindlichkeit in mente. Arnold Gehlen schlägt den Bogen von Bolks „Retardation“ zurück zu Portmanns „extra-uterinen Embryonalzeit“: Ein solcher „zwar außerhalb des Mutterleibes, aber noch im Stadium der Ausreifung vor sich gehender früher Kontakt mit dem offenen Reichtum der einströmenden Reizfülle ist das früheste Stadium eines der wichtigsten Wesenszüge des Menschen – seiner Weltoffenheit. Und so rückt diese Weltoffenheit als eine innere Eigenschaft in den Zusammenhang der äußeren Eigenschaften hinein, von denen Louis Bolk, der geniale Amsterdamer Anatom, nachwies, daß sie allesamt zeitlebens stabilisierte, über die ganze Lebenszeit hin dauerhaft gewordene embryonale Eigenschaften sind: so die Schädelwölbung, die Unterstellung des Gebißteils unter den Hirnteil, die Unbehaartheit, der Bau des Beckens, aus dem der aufrechte Gang folgt usw. Ein solches frühinfantiles Merkmal, das doch stabilisiert durchhält, ist auch die Weltoffenheit des Menschen.“41
Unsere Weltoffenheit ist das Korrelat zu unserer ‚Spezialisierung auf Nicht-Spezialisiertsein’: „Alle Anpassungen des Menschen zielen auf Vielseitigkeit ab.“42 „Das Stehenbleiben der Entwicklung auf einem jugendlichen Stadium, die sogenannte Neotenie, ist die Voraussetzung dafür, daß der Mensch nicht, wie die meisten Tiere, sein Neugierverhalten mit dem Erwachsenwerden einstellt, sondern seine konstitutive Weltoffenheit beibehält, bis das Greisenalter ihr ein Ende bereitet.“43 Das „unspezialisierte Neugierwesen“ Mensch bleibt fast bis zum Schluß „ein Werdender“.44 Darum ist Kindlichkeit „eins der wichtigsten, unentbehrlichsten und im edelsten Sinne humanen Merkmale des Menschen. Kindliche Eigenschaften gehören ohne allen Zweifel zu den Voraussetzungen der Menschwerdung.“45
Nicht
nur des Werdens, auch des Bleibens. „Die Größe des Menschen ist es, nie
mit seiner Kindheit zu brechen, mit dem Abenteuer, der
Zerbrechlichkeit, den bodenlosen Entrüstungen, den Naivitäten und der
Hingabe ohne Kalkül. Kindereien haben ihre Zeit, die Kindheit nicht.“46 Das Kind steht der Bestimmung des Menschen näher als der Erwachsene.
Bilder und Begriffe
Kann man das wirklich ernstnehmen? Auf den ersten Blick nicht. Erwachsenheit hieß nicht nur Arbeit. Erwachsenheit hieß auch Rationalität und Reflexion. Das fehlt dem Kind: der Begriff.
Soweit
der erste Blick. Auf den zweiten Blick ist auch unsere Vorstellung von
Vernunft geprägt von der zehntausendjährigen Arbeitsgesellschaft. „Die
exakte, auf Maß und Zahl beruhende Arbeits- und Leistungswissenschaft
trägt heute unsere gesamte Weltzivilisation und alle Technik und
Industrie. Sie erstrebt ein Weltbild in mathematischen Gleichungen, das
es ermöglicht, den Weltprozeß in eindeutig den Gegenständen der
Raumzeitmannigfaltigkeit zugeordneten Zeichen zu bestimmen und ihnen
gemäß ihn gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“, heißt es
bei Max Scheler, dem Vater der Wissenssoziologie.47
„Erst seit kurzer Zeit dämmert in der Philosophie die Einsicht auf, daß das, was man ‚Erkenntnistheorie’’ nannte, meist nur eine Art der Erkenntnis beachtete, nämlich diejenige der positiven Wissenschaft - und innerhalb ihrer auch wiederum nur gewisse, je willkürlich bevorzugte Disziplinen, sei es der mathematischen Naturwissenschaft, sei es der Geschichte. Was in Religion, Kunst, Mythos, Sprache an ‚Wissen’ steckt und wie dieses Wissen dem System allen Wissens einzuordnen sei, das beginnt man heute wieder zu fragen und zu ahnen.“48
„Erst seit kurzer Zeit dämmert in der Philosophie die Einsicht auf, daß das, was man ‚Erkenntnistheorie’’ nannte, meist nur eine Art der Erkenntnis beachtete, nämlich diejenige der positiven Wissenschaft - und innerhalb ihrer auch wiederum nur gewisse, je willkürlich bevorzugte Disziplinen, sei es der mathematischen Naturwissenschaft, sei es der Geschichte. Was in Religion, Kunst, Mythos, Sprache an ‚Wissen’ steckt und wie dieses Wissen dem System allen Wissens einzuordnen sei, das beginnt man heute wieder zu fragen und zu ahnen.“48
Geahnt hatten es schon die Romantiker, aber sie wurden rasch zum Schwarzen Mann des gesunden Menschenverstands. Die Vernunft hat nicht erst mit dem Begriff begonnen. “Wie im Schreiben Bilderschrift früher war als Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Metapher, insofern sie Verhältnisse und nicht Gegenstände bezeichnet, das frühere Wort, welches sich erst allmählich zum eigentlichen Ausdruck entfärben mußte. Daher ist jede Sprache in Rücksicht geistiger Beziehungen ein Wörterbuch erblasseter Metaphern.“49 Die Begriffe waren auch einmal Bilder, bevor der häufige Austausch sie ab- und zugeschliffen hat für den logischen Gebrauch. Das Verständnis der Welt geschah zuerst in Bildern und Erzählungen.
Logos und Mythos
„Der Logos hat sich vom Mythos abgesetzt. Der Mythos ist älter und selbstverständlich hat er sich sprachlich niedergeschlagen. Der Logos hat aber seitdem noch längst nicht alle Lebensgebiete logisiert oder rationalisiert“, schreibt Schelers Schüler Erich Rothacker. „Aus zu Ende gedachten Begriffen, wie sie dem rein rationalen Welt‚bild’ vorliegen, ergibt sich überhaupt kein Bild mehr. Denn ein Bild muß anschaulich sein oder es mindestens werden. Dieses rein rationale Weltbild ist im Grunde überhaupt nur zu ‚leben’ als mehr oder minder tiefdringende Infiltration oder auch Okulation“ – Pfropf, sagt der Gärtner – „über einem gelebten mythischen Weltbild.“50
Die
Anschauung muß immer den Stoff liefern, den der Begriff fassen will.
„Man muß nur nicht meinen, mit dem Denken über die Empfindungen und
Anschauungen hinauskommen zu können.“52
Die wirklich kritische Erkenntnistheorie könne „zeigen, wie die
logische Funktion durch allmähliche Fiktionen aus der Empfindung die
Vorstellungswelt schafft“, schrieb Hans Vaihinger zum Abschluß seines
lebenslangen Ringens mit der Kritik der reinen Vernunft.53
Nicht durch ihr Wesen unterscheidet sich die logische Funktion vom Mythos, sondern durch ihren Gebrauch. Fingiert sind sie beide. Die eine dient der Beschreibung dessen, was ‚der Fall ist’. Der andere will einen Sinn darin sehen. Denn „je begreiflicher uns das Universum wird, um so sinnloser erscheint es auch“, sagt einer, der es wissen muß.54 Begreifen ist eins, verstehen ein anderes. „Das Bestreben, das Universum zu verstehen, hebt das menschliche Leben ein wenig über eine Farce hinaus und verleiht ihm einen Hauch von tragischer Würde“.55 Es liegt auch den wissenschaftlichsten Kosmologien noch ein Ur-Bild von deutlich mythischem Charakter zu Grunde, vom Großen Uhrmacher der Aufklärung bis zum Urknall unserer Tage. In ihren Mythen macht sich die Menschheit daran, „etwas zu bearbeiten und zu verarbeiten, was ihr zusetzt, was sie in Unruhe und in Bewegung bringt. Es läßt sich auf die einfache Formel bringen, daß die Welt den Menschen nicht durchsichtig ist und nicht einmal sie selbst sich dies sind.“56 Tragisch ist an dieser „Arbeit am Mythos“, dass die mythischen Antworten ‚nur ein Schein’ sind. „In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht, es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen.“57 Aber das nützt einem nichts, der sein Leben in der Welt führen muß. Die Mythen sind ein Kunstgriff. „Sie geben zwar keine Antworten auf Fragen, nehmen sich aber so aus, als bliebe nichts zu fragen übrig. Welt zu haben ist immer das Resultat einer Kunst.“58
Hier gelangen wir zu einer substanziellen Bestimmung der Kunst, unabhängig vom Phänotyp des Künstlers. Nämlich wenn wir den Mythos durch die Kunst erklären (nicht umgekehrt). „Alle Kunstwerke, und Kunst insgesamt, sind Rätsel“, daß sie „etwas sagen und im gleichen Atemzug es verbergen“, macht ihren Kunstcharakter aus.59 „Kunst wird zum Rätsel, weil sie scheint, als hätte sie gelöst, was am Dasein Rätsel ist. Ob die Verheißung Täuschung ist, das ist das Rätsel.“60 In die Welt einen Sinn hineinlesen, das ist der Kunstakt. Überhaupt erst durch diesen Elementarakt wird ‚alles, was der Fall ist’, zu einer Welt. Ihr Sinn liegt außer ihr, doch nicht jenseits, sondern diesseits. Er liegt im Auge des Lesenden.61
Artisten-Metaphysik
Ist es aber ganz beliebig, welchen Sinn dieser oder jener in die Welt hineinschaut? Ist einer so gut wie der andere? Kann man auch darauf verzichten? Ist es etwa „nur ein Spiel“? Sinn nennen wir den Leitfaden, der uns erlaubt, unser Leben zu führen, und daß wir es führen müssen, macht die Freiheit aus, die uns von den andern Lebewesen unterscheidet. Als Sinn muß er sich bewähren, nicht theoretisch, sondern praktisch. Solange das Leben der Menschen von der Not geprägt war, haben sich Arbeit und Beruf als Sinn bewährt. Aber nicht als ein Entwurf der Freiheit, sondern als ihre Schranke. Freiheit war „Einsicht in die Notwendigkeit“: Das war Vernunft und der Ursprung allen Wissens.
Damit
ist es vorbei, jedenfalls virtuell. Völlig unvorbereitet trifft es uns
nicht. Die Romantiker hatten die Bürgerlichkeit, hatten Arbeit und Beruf
nie gewollt. Paradoxer Weise wurden sie dabei zu den Begründern dessen,
was man später die Moderne
genannt hat. Deren Totenglocke läutete, gut hundert Jahre vor der Zeit,
Friedrich Nietzsche, und bereitete schon den Boden der „Postmoderne“.62 Und zwar aus metaphysischen Erwägungen; nämlich der Einsicht in das Ende der Metaphysik – worunter man das Bemühen versteht, aus der Welt und allem, was der Fall ist, einen Sinn heraus zu räsonnieren.
„Alle philosophischen Systeme sind überwunden.“63 Wir müssen hinter Sokrates, den Erfinder des Räsonnements, zurückkehren zu Heraklits „ästhetischer Grundperzeption vom Spiel der Welt“:64 „Es gibt kein Sein, das ewige Werden ist wie ein ewiges Nichtsein.“65 Es ist die Lehre von der inneren Gleich-Gültigkeit der Welt, nach der „nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint“.66
„Alle philosophischen Systeme sind überwunden.“63 Wir müssen hinter Sokrates, den Erfinder des Räsonnements, zurückkehren zu Heraklits „ästhetischer Grundperzeption vom Spiel der Welt“:64 „Es gibt kein Sein, das ewige Werden ist wie ein ewiges Nichtsein.“65 Es ist die Lehre von der inneren Gleich-Gültigkeit der Welt, nach der „nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint“.66
„Was früher am stärksten reizte, wird nur noch als Spiel angesehen und gelten gelassen.“67 Wir sind jetzt „nur zum Spiel Kaufleute und wissenschaftliche Menschen“, weil wir es lediglich als „Form und Reiz“ ästhetisch auffassen: „ein Spiel der Kinder, auf welches das Auge des Weisen blickt“. Das „neue Ideal des theoretischen (!) Menschen“ verkörpert „die höchste menschliche Möglichkeit – alles in Spiel aufzulösen, hinter dem der Ernst steht.“68 Homo ludens victor.
Denn Spiel ist nicht unernst, es ist auch nicht irreal. „Das Wesentliche beim Spiel“, sagt der Biologe, „ist das Formgeben“.69 Wenn nicht länger die Notdurft die freie Tätigkeit des Menschen zur ‚Arbeit’ verkürzt, woher sollen die Formen, die Gestalten, die Ordnungen dann kommen? Wenn ich im Stoff nicht mein Bedürfnis darstelle, wenn ich auf das Darstellen im Stoff doch aber nicht verzichten kann, dann kann ich nur… mich ‚selbst’ darstellen. Entwerfen, besser gesagt, denn wie eine ‚Welt’, so wird auch ein ‚Selbst’ überhaupt erst durch diesen Kunstakt. Sich-Darstellen ist das wahre Wesen des Spiels und der Kunst.70 „Das Kind wirft einmal das Spielzeug weg: bald aber fängt es wieder an, in unschuldiger Laune. Sobald es aber baut, knüpft und fügt und formt es gesetzmäßig und nach inneren Ordnungen. So schaut nur der ästhetische Mensch die Welt an.“71
„Die Welt selbst ist nichts als Kunst.“72 Die Arbeitsgesellschaft verfällt, das Reich der Notwendigkeiten schwindet, und mit ihnen die rationellen Weltschemata von Ursache und Wirkung. Übrig bleibt „Artisten-Metaphysik“.73
Wenn aber an die Stelle des zum Berufsmenschen ausgereiften Erwachsenen als anthropologische Leitfigur der artistisch sich-und-die-Welt entwerfenden Ästhetiker tritt, hat das für die Pädagogik tiefer reichende Folgen, als uns PISA träumen lässt.
1) Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791), II. Teil, IX. Buch, 1. Kap., Darmstadt 1966 [neu: Wiesbaden 1985], S. 226
2) ebd, II,IV.4, S. 119
3) ebd, II,IX.1, S. 227
4) ebd, II,IX.1, S. 228
5) ebd, II,IV.3, S. 114
6) Herder aaO, II,IV.4, S. 118
7) Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Hamburg (rde) 21958, S. 49; S. 68ff.
8 ) Arnold Gehlen, Der Mensch, Wiesbaden 121978, S. 114
10) Herder aaO, II, V.6, S. 146
11) Gehlen aaO, S. 87
12) Konrad Lorenz, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, Mchn. 1983, S. 237
13) Lorenz aaO.
14) Portmann, aaO, S. 65
15) Adolf Portmann,“Der Mensch – ein Mängelwesen?“ in: ders., Entläßt die Natur den Menschen?, Mchn. 1970, S. 209
16) Friedrich Nietzsche, „Jenseits von Gut und Böse“ in Werke (Hg. v. K. Schlechta) Mchn. 61969, Bd. II, S. 623
17)
In der Bibel ist die Arbeit die Folge des Sündenfalls: „im Schweiße
deines Angesichts…“! Und sie verewigt ihn: Es ist der Bauer Kain, der
den Hirten Abel erschlägt. (1. Mose, 3.4.)
18)
Max Weber, „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“
in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübg.
1920, S. 202
19) Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, Mchn. 1978, S. 47f.
20) ebd, S. 48
21) J. H. van den Berg, Metabletica – Über die Wandlung des Menschen, Göttingen 1960, S. 33f.
22) ebd
23) vgl. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, Bern 1969.
24)
Namentlich die Pariser Sozialhistoriker-Schule um die Zs. Annales ESC
hat im Anschluß an Ariès’ Buch eine inzwischen unübersehbare Menge
empirischer Untersuchungen hervorgebracht.
25) van den Berg aaO, S. 43
26) ebd, S. 47
27) Rudolf zur Lippe, Naturbeherrschung am Menschen I, Ffm. 1981, S. 79
28) Wenn ihm keines seiner Werke gelang, dann war er ein schlechter Künstler – aber nicht etwas anderes.
29) Fr. Nietzsche, „Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen“, aaO Bd. III, S. 376
30)
F.J.J. Buytendijk, „Das menschliche Spiel“ in: H.-G. Gadamer (Hg.),
Neue Anthropologie, Bd. IV: Kulturanthropologie, Stgt. 1973, S. 109
31) Buytendijk aaO, S. 95
32) H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, S. 102
33) ebd, S. 110
34) Adolf Portmann, „Spiel und Leben“ in: Entläßt die Natur den Menschen? Mchn. 1970, S. 238ff.
35) Karl Marx, „Grundrisse“ in: Marx-Engels-Werke, Bd. 42, Bln. 1983, S. 600f.
36) ebd, S. 601
37) Portmann, Entläßt…?, S. 240
38) Louis Bolk, Das Problem der Menschwerdung, Jena 1926
39) Konrad Lorenz, „Psychologie und Stammesgeschichte“, in: Über tierisches und menschliches Verhalten, Mchn. 1965, S. 242
40)
Portmann, Zoologie…, S. 132ff. Siehe zum gesamten Neotenie-Komplex: O.
H. Schindewolf, „Phylogenie und Anthropologie aus paläontologischer
Sicht“ in: H.-G. Gadamer (Hg.), Neue Anthropologie, Bd. 1: Biologische
Anthropologie, Stgt. 1972, S. 230-292
41) Arnold Gehlen, Der Mensch, Wiesbaden 121978, S. 104
42) Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek 1961 (rde), S. 57
43) Konrad Lorenz, Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, Mchn. 1983, S. 238
44) Konrad Lorenz, Die Rckseite des Spiegels, Mchn. 1977, S. 192
45) Lorenz, Das Wirkungsgefüge…, S. 240; 245
46) Konrad Lorenz, Die sieben Todsünden der zivilisierten Menschheit, Mchn. 71974, S. 63
47)
Emmanuel Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, hier zit.
nach: Jean Cornilh, Emmanuel Mounier, Paris 1966, S. 76
48) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“, in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 210
49) ebd, S. 200f.
50) Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, Werke Bd. IV, Lpzg. o. J., S. 233 (Bibl. Inst.)
51) Erich Rothacker, Philosophische Anthropologie, Bonn 21966, S. 103; 108
52) Hans Vaihinger, Philosophie des Als Ob, Lpzg. 91927, S. 139; 278f.
53)
der Astrophysiker Steven Weinberg (Nobelpreis 1979) in: Die ersten drei
Minuten – Der Ursprung des Universums, Mchn. 31978, S. 213
54) ebd, S. 212
56) Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Ffm. 1996, S. 303
57) Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus; Werkausgabe Bd. 1, Ffm. 1987, S. 82. [6.41]
58) Blumenberg, aaO, S. 319; 13
59) Th. W. Adorno, Ästhetische Theorie, Ffm. 1970, S. 182
60) ebd, S. 191; 193
61) Aber das Auge sieht sich nicht. Die Frage ist selber die Antwort.
62) siehe hierzu K.-H. Bohrer (Hg.), Mythos und Moderne, Ffm. 1983
63)
z. B. Günter Wohlfart, „Nietzsches Vorpostmoderne – Die ästhetische
Grundperzeption vom Spiel der Welt als Vorspiel der Postmoderne“ in:
Artisten-Metaphysik, Würzburg 1991
64)
Friedrich Nietzsche, aus dem Nachlaß; hier zit. nach: Günter Wohlfart,
Also sprach Herakleitos – Heraklits Fragment B 52 und Nietzsches
Heraklit-Rezeption, Freiburg 1991, S. 357
65) ebd, S. 292f.
66) ebd, S. 336
67) ebd, S. 364
68) ebd, 312, 291ff.
69) Adolf Portmann, „Das Spiel als gestaltete Zeit“ in: Flitner, A. (Hg), Das Kinderspiel, Mchn. 51988, S. 60
70) siehe Anm. 34
71) Nietzsche nach Wohlfart, Also…, S. 288
72) ebd, S. 265
73) Fr. Nietzsche, „Die Geburt der Tragödie“ in: Werke, (Hg. Schlechta) Bd. 1, Mchn. 61969, S. 14
——————————————————————————————————————————————
Die Grenzen der pädagogischen Vernunft
oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?
zuerst in: PÄDForum 2/2003
 Ich
kann von dem, was ich sollte, keinen
Ich
kann von dem, was ich sollte, keinenBegriff haben, bevor ich es tue. Einen
Akt der Freiheit begreifen wollen, ist
absolut widersprechend. Eben wenn sie es
begreifen könnten, wäre es nicht Freiheit.
J. G. Fichte
Erziehung, was ist das? „Alles ist Erziehung!“ strahlt der Pädagoge. Wenn alles Erziehung ist, dann ist nichts Erziehung. Ist Erziehung alles und nichts? Das klingt weise!
 Der
Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt
ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm
nicht durch sein Erbmaterial, sondern
durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand
unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins
Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie
kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der
Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als
willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der
Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als
er dachte.
Der
Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt
ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm
nicht durch sein Erbmaterial, sondern
durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand
unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins
Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie
kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der
Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als
willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der
Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als
er dachte.
Begriffliche
Schärfe lag nicht in seinem Temperament. Gelegentliche Aporien machten
ihm nichts aus (denn mit dem tendenziösen Mißverstehen eines
selbstsüchtigen Berufsstandes mußte er zu seiner Zeit noch nicht
rechnen). Erziehung, wie er sie arglos verstand, gehört zum Menschen,
seit er aufrecht geht, das heißt, seit Jahrmillionen; und zwar ganz
selbstverständlich, ohne dazu einer besondern Theorie, einer begründeten
Methode oder gar – eines besondern Berufsstands von
Erziehungstechnikern zu bedürfen. Ganz selbstverständlich ist dagegen
heute, daß Erziehung methodisch zu geschehen hat, daß sie als
Wissenschaft zu betreiben, und daß sie – das ist wohl das mindeste –
durch ausgebildete Professionelle zu verabfolgen ist, an denen sich
dilettierende Eltern bitteschön ein Vorbild nehmen sollen.2
 Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
Was ist Wissenschaft?
Wissenschaft
gibt es nicht an sich, etwa im Unterschied zu andern möglichen Weisen
des Wissens. Schon gar nicht ist jede gut sortierte Anhäufung von
Wissensstoff gleich „Wissenschaft“. Die Himmelskunde der Babylonier, die
doch auf genauer, geduldiger und systematischer Beobachtung beruhte,
war so umfassend, daß sie vom Abendland zweitausend Jahre lang nicht zu
überbieten war. Aber sie diente bloß den Astrologen. Einen andern Sinn
kannte sie nicht.4
 Wissenschaft
ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist
wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er
unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt
oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen
wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen
auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern
zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –
und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.
Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6
Wissenschaft
ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist
wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er
unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt
oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen
wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen
auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern
zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –
und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.
Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6
Die
bürgerliche Gesellschaft ist wesentlich öffentlicher Raum. Aber die
öffentliche Meinung ist „von Natur“ gespalten. Wissenschaft vermag das
Feld des Meinungskampfs einzuengen, indem sie Einverständnis erzwingt;
sie ist öffentliches Wissen.7 Ihr Aufstieg im Zeitalter der
Moderne war das politische Ereignis par excellence. Je mehr Bereiche des
öffentlichen Lebens von Wissenschaft durchdrungen werden, umso weiter
reicht das Feld politischen Einverständnisses. Nichts anderes bezeichnet
Max Webers Wort von der „Rationalisierung der Welt“, deren äußeres
Merkmal ihre Verrechtlichung ist.8
Ihre
das Einverständnis erzwingende Macht verdankt Wissenschaft ihrem
systematischen Fortschreiten von der Sicherung ihres logischen Grundes
hier – zur begrifflichen Erfassung ihres Gegenstands da. Reale
wissenschaftliche Forschung bewährt sich als die alltäglich immer neu zu
leistende Vermittlung zwischen ihrem Grund und ihrem Gegenstand.9 So kann es scheinen, als sei die Methode selber die Wissenschaft. Das verdanken sie beide ihrem Stifter. René Descartes identifizierte zwei Substanzen in der Welt, res extensa – Körper, Materie, deren wesentliche Bestimmung ihre Räumlichkeit ist – und res cogitans, die immaterielle denkende Seele.
Dies
ist das Grundmuster des modernen Weltbilds: da das unendlich
ausgedehnte, von allgemeingültigen Gesetzen regierte Universum, und hier
das souveräne Subjekt. Erkenntnis ist möglich, weil sie von ihrem
gemeinsamen Schöpfer mit demselben Gesetz ausgestattet sind. Was findet
nämlich die denkende Seele, wenn sie, von allen (trügerischen)
sinnlichen Eindrücken absehend, sich selber auf den Grund geht? Die
klaren und eindeutigen Verfahren der Mathematik, als der reinen
Anschauung räumlicher Verhältnisse. Descartes machte Epoche, als er sich
„entschied, nichts für wahr anzunehmen, was mir nicht so klar und so
gewiß erschiene wie die Demonstrationen der Geometer“.10
Wissenschaft bedeutet seither: die Welt more geometrico
rekonstruieren, und Vernunft heißt, sich – nach mathematischem Muster –
logische Beziehungen wie räumliche Verhältnisse denken. Auf dieser
„Verräumlichung“ des modernen Bewußtseins11 beruht ein
Kausalitäts-Begriff, der dem Modell der klassischen mechanischen Physik
nachgebildet ist und das Alltagsbewußtsein bis heute prägt,12 und noch die Zeit erscheint als eine zu durchmessende Strecke.13
Das physikalische Modell…
 Zum
Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.
Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand
durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu
sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System
bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,
sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer
und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in
zünftigen Werkstätten, Dombauhütten, Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
Zum
Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.
Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand
durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu
sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System
bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,
sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer
und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in
zünftigen Werkstätten, Dombauhütten, Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
Zur
Theorie wurden sie nicht an der Universität geordnet, sondern in den
Privaträumen denkender Liebhaber – Descartes war Reiteroffizier, Newton
leitete die Londoner Münze. Die Theorie hatte der Physik
jahrtausendelang vielmehr den Weg versperrt. Das war der Fluch ihrer
frühen Geburt: Das abendländische Denken begann bei den ionischen
(kleinasiatischen) Griechen als Natur-Philosophie, als meta-physische Spekulation über ‚Ein und Alles’, wo die Natur – gr. physis
– gemeinsam mit allem Denkbaren in einem unlösbaren Durcheinander
unterging, aus dem sie die rein zufälligen Experimente einzelner
Neugieriger nicht herausholen konnte. Unter der Herrschaft der römischen
Kirche war an eine Lösung der Natur aus der Theologie schon gar nicht
zu denken.
Dazu
bedurfte sie des Eingriffs der Mathematik. Die mittelalterlichen
Scholastiker hatten mit ihrer gnadenlosen Logik der Wissenschaft den
Boden bereitet, das sei nicht vergessen. Nichts ließen sie gelten, als
was mit überprüfbaren Gründen bewiesen wurde,15 und ihre
Disputationen fanden öffentlich statt. Aber ihnen waren seitens der
Gegenstände wie seitens der Gründe von der Theologischen Fakultät enge
Grenzen gesetzt, und ihre Gelehrtenrepublik – von Salamanca bis Wilnius,
von Palermo bis Uppsala – zählte nur ein paar hundert Köpfe.
Doch
der Mathematik konnte keiner Grenzen setzen, und auf Hörsäle war sie
gar nicht erst angewiesen. Sie war universell und unwiderstehlich. Sie
war nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem
kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr
Interesse auf die Arithmetik konzentriert. Aber Mathematik entstand
erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst
der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das
Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt16 – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion.17
Auf
etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie
nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte
sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden:
„die Naturer- scheinungen auf mathematische Gesetze zurückzuführen“,181920 und nur  darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,
weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter
Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie
er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen
Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem
‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man
sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,
weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter
Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie
er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen
Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem
‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man
sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
 darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,
weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter
Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie
er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen
Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem
‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man
sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik überflüssig,
weil sie selber metaphysisch ist – aber unausgesprochen. Ein ‚letzter
Grund’ bleibt dabei stillschweigend immer vorausgesetzt, und ob oder wie
er sich auffinden läßt, wird geflissentlich den Philosophen und anderen
Hirnwebern überlassen, und nicht viel anders steht es mit dem
‚Gegenstand an sich’, der Welt. In den realen Wissenschaften begnügt man
sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
…schafft auch nicht alles.
 Die
wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.
Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche
Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn
sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte,
dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die
Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein
naturgesetzliches System zu fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
Die
wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.
Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche
Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn
sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte,
dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die
Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein
naturgesetzliches System zu fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
Es hatte aber den Mangel, daß aus der Produktivität des Bodens den Werten kein Maß
erwachsen konnte. An ihre Stelle setzten Adam Smith und David Ricardo
daher im ‚Klassischen System der Politischen Ökonomie’ die Produktivität
der menschlichen Arbeit.23 Das Wertgesetz
lautet: Die Waren tauschen sich gegen einander nach Maßgabe der in
ihnen dargestellten Arbeitsmenge. Es war politisch in einem unerwarteten
Sinn.24 Ließ sich nämlich die bürgerliche Gesellschaft als
geschlossenes System darstellen, das sich durch ebenso natürliche wie
vernünftige Gesetze selbst-begründet, so erschien sie als gerechtfertigt – gegen den untergehenden Erbadel sowohl als gegen das aufkommende Proletariat.
Politisch
waren auch die Motive für die Kritik daran. Doch ihre ‚Methode’ bestand
zunächst nur in dem Versuch, das ‚System’ abschließend darzustellen.
Doch was zeigte sich? Zu Grunde liegt ihm in Wahrheit ein „fehlerhafter
Kreislauf“: Was erklärt werden müßte, wird schon vorausgesetzt!25
Wenn nämlich die Arbeit in den Austauschprozeß der Werte (=Waren) als
Maß eingreifen soll, dann muß sie selber regelmäßig als Ware
ausgetauscht werden. Mit andern Worten, das Wertgesetz setzt Lohn-Arbeit
voraus.
Es
setzt voraus, daß eine Klasse von Leuten entstanden ist, die nicht die
Mittel (Werkzeuge, Rohstoffe) haben, um ihre eigene Arbeit in
Gebrauchsgütern zu vergegenständlichen, die sie mit andern tauschen
könnten, und darum die Arbeit selbst als Ware veräußern müssen.26
Setzt voraus, daß die Masse der Bevölkerung von ihrer angestammten
Scholle vertrieben war. „Die Expropriation des ländlichen Produzenten,
des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen
Prozesses.“27 Und das war kein naturgesetzlicher und kein
ökonomischer Vorgang, sondern ein historischer Gewaltakt. Das ‚System’
hat sich nicht ‚selbst begründet’, der ‚Wert’ ist nicht aus dem ‚Gesetz’
hervorgegangen, sondern aus einem ungleichen Kräfteverhältnis, und die
bürgerliche Gesellschaft wurde nicht gerechtfertigt, sondern fix und
fertig vorausgesetzt.
Wissen wozu?
Alles
kann irgendwie ‚gewußt’ werden. Oder richtiger, indem es gewußt wird,
kann Alles überhaupt nur ‚sein’. Doch wie der Gegenstand bestimmt wird,
hängt anscheinend davon ab, wer was wozu wissen will. Erst recht hängt
davon ab, wie es wem zu beweisen ist.
 Die
Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise
Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,
aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist
kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment
von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.
Die
Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise
Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,
aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist
kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment
von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.  Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29
zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die
‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,
was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.
Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem
Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29
zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die
‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,
was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.
Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem
Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
Und
so erscheint es, als sei das einzige Wissen, das diesen Namen verdient,
dasjenige, das unsere Macht über besagten Weltprozeß mehrt.
‚Herrschaftswissen’ hat es Max Scheler genannt32
– und hat daneben ein ‚Bildungswissen’ gestellt, das unsere „geistige
Person“ prägt, sowie ein – wie er es nannte – ‚Erlösungswissen’, das dem
persönlichen Leben seinen Sinn weist. Doch Bildungs- und
Erlösungswissen drängen nicht an die Öffentlichkeit, denn sie bedürfen
niemandes Einverständnis’. Sie können mitgeteilt werden;
Herrschaftswissen muß. Es ist der Typus der Wissenschaft.
Bevor
wir zu der Frage kommen, wer was wozu vom Erziehen wissen will, und ob
dies Wissen zur Wissenschaft taugt, sei eine weitere Unterscheidung
eingeführt: Kants Trennung von ‚theoretischem’ und ‚praktischem’ Wissen.
Dieses hat alles zum Gegenstand, was ist; jenes das, was sein soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist.“33
‚Durch Freiheit möglich’ sind die Zwecke, die wir uns selber setzen.
Theoretische Wissenschaft kann die ‚Gesetze’ aufzeigen, derer wir uns
bedienen, um unsere Zwecke zu verfolgen. Aber Zwecke setzen kann sie
nicht.
So
hat sich die Politische Ökonomie seit der Marx’schen Kritik zu dem
zurückentwickelt, was sie an ihrem Anfang war – ein Inventar von
Techniken der Wirtschaftspolitik.34 Könnte sie wirklich
lehren, wie man die Produktion steigert, wäre sie ‚theoretisch’ im
selben Sinn wie etwa die Ingenieurswissenschaften. Wie aber das Produkt
etwa ‚gerecht verteilt’ werden soll, wäre eine praktische Frage, die
‚durch Freiheit’ zu entscheiden ist – von der Politik, nicht von der
Wissenschaft. Einverständnis kann darüber nicht durch Gründe erzwungen
werden, weil es um Zwecke geht, und die werden nicht erwiesen, sondern
postuliert.
Normalisierung
 Das
Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von
äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die
Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das
Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu
erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte
uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken
lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert
werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,
dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.
Das
Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von
äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die
Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das
Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu
erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte
uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken
lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert
werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,
dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.
Das
Problem ist hier offenbar das Subjekt. Wer darf die Zwecke der
Erziehung postulieren? Die Öffentlichkeit? Aber die ist gespalten. Darum
ging es doch gerade: die Öffentlichkeit durch zwingende Gründe zu einem
Subjekt zu bilden – dazu war Wissenschaft da! Wieder ein „fehlerhafter
Kreislauf“: Um postulieren zu können, müßte sie sich zum Subjekt bilden;
aber um sich zum Subjekt zu bilden, bräuchte sie Wissenschaft. Aber
deren Zweck sollte sie ja erst noch postulieren!
Darum
postuliert ‚die Öffentlichkeit’ in dieser Sache auch nicht selber. Das
überläßt sie stellvertretend dem Berufsstand der erwerbsmäßigen
Pädagogen. Es scheint auch nahe zu liegen: Es ist ja ihr Beruf, da
werden sie schon wissen, was sie tun. Ein Arzt weiß, was er tut, weil er
nicht nur ein Handwerk gelernt, sondern auch eine Wissenschaft studiert
hat. Der Kfz-Mechaniker hat zwar keine Wissenschaft studiert, aber wenn
er nicht wüßte, was er tut, würden seine Machwerke nicht laufen. Und
wüßte die Köchin nicht, was sie tut, müßten alle spucken.
Daß
Pädagogen einen Beruf ausüben, beweist aber nicht, daß sie wissen, was
sie tun. Ein Handwerk mögen sie gelernt haben, doch ob ihre Machwerke
‚laufen’, mag im einzelnen jedesmal bezweifelt werden – denn wo ist das
Maß? Gespuckt hat schon mancher. Und ob das, was sie studiert haben,
eine Wissenschaft ist, steht eben in Frage.
Doch
wenn sie zwar nicht mit zwingenden Gründen Einverständnis schaffen, so
stehen sie doch zum gesellschaftlichen Konsensus irgendwie in einem
privilegierten Verhältnis. Denn von alters ist es der Berufsstand der
Pädagogen, der für Normalität sorgt! Das hat ihn gerechtfertigt und zum
Postulieren befugt. Doch wer wagt heute noch zu sagen, was normal ist?
Den Pädagogen kommt ja nicht mal mehr das Wort über die Lippen!35
Die
Rechtfertigung des Pädagogenstandes war eine historische. In
vorbürgerlichen Gesellschaften gab es keine Normalität. Sie sahen aus
wie Flickenteppiche aus soundsoviel verschiedenen Nischen, die nur
äußerlich verbunden schienen: durch Handelswege und dynastische
Herrschaft. Jeder war an seiner Statt so, wie er eben war und wuchs in
die Besonderheiten seiner Umwelt hinein, sich von Anfang an nach Maßgabe
seiner je entwickelten Kräfte an deren besonderer Reproduktionsweise
beteiligend, mitmachend, learning by doing – und die er normalerweise sein Lebtag nicht verließ: Werkstatt, Laden, Acker, usw.
 Mit
zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen
erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen
Ausbildung der technischen Fertigkeit sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
Mit
zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen
erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen
Ausbildung der technischen Fertigkeit sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
Eine
Besonderheit der westlichen Entwicklung: mit der Feudalisierung
entsteht im christlichen Adel eine Kriegerkaste, die – teils in
Abhängigkeit vom Klerus, teils in Konkurrenz – selber zum Kulturträger
wird: Bildung wird, wie bei Plato, zur Legitimation des Berufs zum
Herrschen. Bildung ist
ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger
und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in
München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein
Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.
In
der bürgerlichen Gesellschaft wird Bildung zu einer allgemeinen
Aufgabe. Sie zersetzt die partikularen Umweltnischen durch ihre
Vereinnahmung ins Marktgeschehen. Sein Charakter ist, nach Dr. Quesnay,
Zirkulation. Jetzt sollen alle mobil werden. Austauschbarkeit wird zum
entscheidenden Kriterium gesellschaftlicher Wert-Schätzung.
Normalisierung, mit einem andern Wort.
Das
heißt vor allem: Formalisierung, nämlich Verschriftlichung, und dadurch
Vereinheitlichung der bislang partikularen Standesbildungen durch
Lateinschulen, Universitäten, später Gymnasien. Seit dem Buchdruck und
dem Entstehen der Wissenschaft explodiert der Fundus sachlicher Kenntnisse und nimmt einen Umfang an, der den Rahmen des Learning by doing in einer Lebensspanne weit übersteigt. Nicht
nur der Form, sondern auch dem Gehalt nach wird Bildung nunmehr
allgemein. Motor der Entwicklung einer allgemein- verbindlichen,
„normalen“ Bildungsidee ist der wachsende Bedarf an qualifizierten
Staatsbeamten.36
.
 Mit
der industriellen Revolution wird ein allgemeiner, wenn auch
elementarer Bildungsstandard zur Voraussetzung auch der ausführenden
Tätigkeiten in der Fabrik: „Allgemeinbildung“, Lesen, Schreiben,
Kopfrechnen… Ursache ist die fortschreitenden Kapitalisierung der
Produktionsvorgänge. Je mehr Kapital in der Technik steckt, umso teurer
kommen Bedienungsfehler. Der ideale Fabrikarbeiter ist mobil und kann
bedarfsweise von einer Maschine zur andern wechseln, ohne dabei an
Zuverlässigkeit zu verlieren. Die industrielle Zivilisation schafft den
Durchschnittsarbeiter. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt.37
Mit
der industriellen Revolution wird ein allgemeiner, wenn auch
elementarer Bildungsstandard zur Voraussetzung auch der ausführenden
Tätigkeiten in der Fabrik: „Allgemeinbildung“, Lesen, Schreiben,
Kopfrechnen… Ursache ist die fortschreitenden Kapitalisierung der
Produktionsvorgänge. Je mehr Kapital in der Technik steckt, umso teurer
kommen Bedienungsfehler. Der ideale Fabrikarbeiter ist mobil und kann
bedarfsweise von einer Maschine zur andern wechseln, ohne dabei an
Zuverlässigkeit zu verlieren. Die industrielle Zivilisation schafft den
Durchschnittsarbeiter. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt.37
Die
erziehende Tätigkeit hat ihren besonderen Ort gefunden. Dort hat sich
ein besonderer Berufsstand gebildet. Da war es nun, das postulierende
Subjekt! War es aber zum Postulieren berechtigt? Immerhin erledigt es
eine allgemeine Aufgabe – Normalisierung. Zugleich erschien ihm seine
Tätigkeit als eine besondere; so besonders nämlich, daß sie einer
speziellen Ausbildung bedarf, ja daß sie gar zum Gegenstand einer eignen
Wissenschaft bestimmt werden kann. Mit andern Worten, in der Schule
wurde Erziehung auf einen Begriff gebracht,37
und der gilt seither als das Eigentliche. Was Väter, Mütter, Onkels,
Tanten und alle andern tun, die sonstwie regelmäßig mit Kindern Umgang
haben, ist dagegen eine uneigentliche, verunreinigte, dilettantische und
– sagen wir’s nur graderaus – eine störende Mängelversion davon.
Unsere Welt und meine Welt
Das
wirkliche Verhältnis scheint auf den Kopf gestellt. Als Herder meinte,
der Mensch werde ‚nur durch Erziehung’ zum Menschen, wollte er,
gegenüber biologischer Vererbung in der Natur, die Bedeutung kultureller
Traditionen für die Ausbildung der Gattung hervorheben. Durch das
Einschmuggeln der ‚Normalität’ in die ‚Menschwerdung’ bekommt der Satz
nun einen neuen Sinn: Der Mensch wird nur durch die Erwerbstätigkeit von
Pädagogen zum Menschen. Und ‚erziehen’ wird in beiden Fällen in völlig
anderer Bedeutung verwendet: da unspezifisch, auf die Forstschritte der
ganzen Gattung bezogen; hier auf das Individuum bezogen und historisch
spezifiziert.
Daß
der Mensch ‚erzogen werden muß’, liegt daran, daß er nicht mehr in
einer biologisch definierten Umwelt lebt, sondern in einer offenen Welt.
„Für ein Tier ist durch seine umweltgebundene Organisation von
vornherein darüber entschieden, ob und inwiefern ein Naturbestandteil
dieses Wesen etwas angeht. Uns kann jeder noch so unscheinbare
Teilbestand der Umgebung bedeutend werden. Uns kann alles etwas
angehen.“38 Eine Umwelt ist ein Inventar natürlicher Dinge,
die sich selbst bedeuten.* Die Welt ist ein Tableau von Bedeutungen, die
in Symbolen dargestellt wurden.39
Es
sind nicht sowohl die Dinge, die kulturell tradiert werden, als die
Bedeutungen. Während seiner „extra-uterinen Embryonalzeit“ ist der
Mensch noch in seine Umwelt gebunden; doch bereitet sein „noch im
Stadium der Ausreifung vor sich gehender früher Kontakt mit dem offenen
Reichtum der einströmenden Reizfülle“ den Grund für seinen spezifisch
menschlichen Wesenszug: „seine Weltoffenheit“.40 Erziehen
heißt nun, einem Menschen die Dinge zeigen und die Symbole, die ihm die
Welt bedeuten. Doch haben die in den Symbolen aufbewahrten Bedeutungen
einen andern Realitätsgrad als die Dinge. Sie ‚sind’ nämlich nur, sofern
ich sie gelten lasse. Denn der Mensch ist das Tier, das nein sagen kann;41 auch dazu: zur Meinung der Andern. Das heißt, ‚die Welt’ wird überliefert, aber seine Welt bildet sich jeder selbst..
 „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, sagt Ludwig Wittgenstein,42
aber das ist falsch. Die Grenzen unseres gemeinsamen Symbolsystems –
das ist mehr als Sprache – sind die Grenzen unserer gemeinsamen Welt;
nämlich ihrer Mitteilbarkeit (und die erheischt Bestimmtheit).43 Meine Welt hat andere Grenzen, denn in ihr können auch Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, sagt Ludwig Wittgenstein,42
aber das ist falsch. Die Grenzen unseres gemeinsamen Symbolsystems –
das ist mehr als Sprache – sind die Grenzen unserer gemeinsamen Welt;
nämlich ihrer Mitteilbarkeit (und die erheischt Bestimmtheit).43 Meine Welt hat andere Grenzen, denn in ihr können auch Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
Kein verständiger Kopf würde sie bestimmen wollen. Aber gezeigt werden sie oft und gern – in den Bildern der Kunst.44
Nicht zuletzt darum übrigens ist die Welt, im Unterschied zu den
geschlossenen Umwelten, offen: weil in meiner Welt Anderes vorkommen mag
als in der der Andern45 – und ich es ihnen zeigen kann.
Gebildet ist, wer sein Leben in ‚seiner’ Welt und in ‚unserer’ Welt
gleichzeitig führt, ohne sich zu verlaufen. Nur als Bildung läßt
Erziehung sich rechtfertigen.
Alles,
was als Tatsache in ‚unserer’ Welt vorkommt, läßt sich auch bestimmen;
nämlich in das allgemeine Bedeutungsgeflecht einpassen, wo Jedem seine
Bedeutung durch die Bedeutung aller Andern zugewiesen wird. Reflektieren
heißt nichts anderes als: seinen Platz im großen
Verweisungszusammenhang aufsuchen. Was bestimmt ist, kann Bestandteil
einer Wissenschaft werden – weil sich sein logischer Zusammenhang
demonstrieren und Einverständnis erzwingen läßt. Was demonstriert werden
kann, läßt sich erlernen.
Was
dagegen ‚durch meine Freiheit möglich’ wurde, läßt sich eo ipso nicht
bestimmen. Es liegt allein in ‚meiner’ Welt. Ich kann es nicht erlernen,
sondern muß es erfinden und mir einbilden. Einverständnis der andern
kann ich nicht erzwingen, sondern höchstens ihren Beifall heischen: sie
animieren, meine ‚Anschauung’ nach-zu-erfinden. Das Nacherfinden kann
nicht gelehrt werden: dazu muß man verführen, und das ist Kunst.
Gegenstand von Wissenschaft kann es nur ‚idiographisch’ werden: kritisch
und historisch.
Das Labor und das Leben
Eine
Welt braucht jeder von uns, weil wir unsre Umwelt verlassen haben. Aber
eine gemeinsame Welt brauchen wir, weil wir zusammen arbeiten müssen.
Vereinfacht, aber kaum verkürzend kann man sagen: ‚Unsere’ Welt
verdanken wir der Arbeitsgesellschaft, und Wissenschaft ist ihr Abbild.
In der Arbeitsgesellschaft gilt ‚unsere’ Welt als die ganze Welt, was in
ihr nicht vorkommt, ist nicht real. Aber nur in der Arbeitsgesellschaft
kann keiner leben, nicht der Arbeiter und nicht einmal sein Chef. Nach
Feierabend darf verkehrte Welt sein, wenn man’s bezahlen kann, und gilt
ein Kunstwerk nicht nur als Sachanlage. Aber das liegt jenseits der
Realität.
Die
Schule will die Arbeitsgesellschaft als das wahre Leben und ‚unsere’
Welt als die wahre Welt, will Wissenschaft als das wahre Wissen lehren.
(Die musischen Fächer setzen ein paar Gänsfüßchen hintan, aber keiner
nimmt sie ernst.) Und jedenfalls sind die Grenzen ihrer Welt die Grenzen
ihrer Wörter: „Pädagogisches Handeln ist nur dort möglich, wo der
wechselseitige Austausch von sprachlich erschlossenen Erfahrungen
möglich ist“, schreibt Hermann Giesecke, und fügt hinzu, das sei „der
Normalfall im privaten wie im gesellschaftlichen Leben“.46
Reden über unsere Welt – das wäre Erziehung! Nein, das ist nicht der
Normalfall im privaten wie im gesellschaftlichen Leben. Das ist der
Normalfall im pädagogischen Labor, und nirgends sonst. Nur weil
schulische Pädagogik im Labor stattfindet, kann sie sich für
‚Wissenschaft’ halten; für ‚nomothetisches’ Herrschaftswissen zumal.
Normalisierung bedarf freilich eines mehrjährigen Aufenthalts im Labor. Dort wird auf das gesetzmäßig Verbindende abgesehen und das individuell Unterscheidende ausgeklammert – bei den wissenschaftlich bestimmten Lehrgegenständen, was dachten Sie? Na ja, wenn ich’s recht besehe – bei den Schülern auch. Natürlich werden die persönlichen Eigenheiten des einen und der andern ‚zugelassen’, aber als Ausnahmen von der Regel. Die Regel bleibt die Regel. Wie soll der Betrieb sonst funktionieren? „Standards“, na bitte, ick bün all do! Das ist der methodologische Sinn der Laborsituation: Störfaktoren ausschalten! Es ist nicht „das Leben“, worauf die Schule vorbereitet, sondern das Arbeitsleben. Und das ist nur ein Teil der Wirklichkeit, und zwar, am Ende der industriellen Zivilisation, ein schrumpfender.
Die
Arbeitswelt war ‚unsere’ Welt, war Sinn und Zweck des Lebens. Es gab
noch einen Rest, der war Randbedingung, Konsumsektor, Pause und
Erholung. In der Arbeitsgesellschaft war Normalisierung ein
‚gerechtfertigtes’, nämlich aus historischer Notdurft erwachsenes
Postulat. Heute erscheint immer mehr die Arbeit als ein Rest, eine
Randbedingung des Lebens, das seine Bestimmung verloren – oder, besser
gesagt: seine Bestimmung als Unbestimmtes wiedergefunden hat. Das
wirkliche Leben spielt (sic) sich immer in einer schwebenden Spannung
zwischen ‚unserer’ und ‚meiner’ Welt ab. Wie gut sich einer in dieser
Schwebe hält, bleibt tagtäglich sein Problem. Jemanden für dies Problem
zu wappnen, ist der einzig mögliche Sinn einer Erziehung, durch die ‚der
Mensch zum Menschen wird’.
Alltagskunst
Dies
Problem ist das, was der Erziehung zu Grunde liegt. Und das ist nichts,
worauf man bauen kann. Da muß man sich durchschlagen, jeden Tag aufs
Neu’. Mit andern Worten, wer Erziehen zu einem wissenschaftstauglichen
Begriff bestimmen will, der kann auch gleich ‚das Leben selbst’ als
Wissenschaft bestimmen. Erziehung ist alles und nichts. Das ist die
erhabene Sicht auf die Sache.
 Prosaisch
gesehen, ist erziehen eine Alltagsverrichtung wie kochen oder Auto
fahren. Im Prinzip kann das jeder, aber manch einer besser als manch
anderer. Wohl kann man aus diesem eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
Prosaisch
gesehen, ist erziehen eine Alltagsverrichtung wie kochen oder Auto
fahren. Im Prinzip kann das jeder, aber manch einer besser als manch
anderer. Wohl kann man aus diesem eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.  Wann
‚erziehen’ Eltern? Die Frage taugt als Vorlage für ein Schmunzelbuch.
Zweifellos doch, wenn sie belohnen oder strafen: denn das tun sie ja
wohl vorsätzlich. Was lernen ihre Kinder dabei? Nutzen und Schaden
abwägen. Das würden sie aber auch ohne dies lernen – vielleicht
langsamer, vielleicht schneller. Gerade dafür ist Erziehen also nicht
‚notwendig’. Tatsächlich geschieht das, was ein unbeteiligter Betrachter
Belohnung oder Strafe nennt, im täglichen familiären Kuddelmuddel nicht
vorsätzlich, sondern nebenher, ohne Kalkül. Das ist die Regel, die von
Ausnahmen bestätigt wird – welche ihrerseits nur deshalb wirken, weil
sie Ausnahmen sind.
Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
Wann
‚erziehen’ Eltern? Die Frage taugt als Vorlage für ein Schmunzelbuch.
Zweifellos doch, wenn sie belohnen oder strafen: denn das tun sie ja
wohl vorsätzlich. Was lernen ihre Kinder dabei? Nutzen und Schaden
abwägen. Das würden sie aber auch ohne dies lernen – vielleicht
langsamer, vielleicht schneller. Gerade dafür ist Erziehen also nicht
‚notwendig’. Tatsächlich geschieht das, was ein unbeteiligter Betrachter
Belohnung oder Strafe nennt, im täglichen familiären Kuddelmuddel nicht
vorsätzlich, sondern nebenher, ohne Kalkül. Das ist die Regel, die von
Ausnahmen bestätigt wird – welche ihrerseits nur deshalb wirken, weil
sie Ausnahmen sind.
Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
Einen
allgemeinen Begriff von Pädagogik – oder einen Begriff von Allgemeiner
Pädagogik – kann es nicht geben. Was es gibt, ist ein allgemeines Bild
von der pädagogischen Situation. Nämlich: Einer, der in der Welt schon
zuhause ist, begegnet einem, der dort neu ist, und ist er ein
anständiger Kerl, dann zeigt er sie ihm. Darin liegt keinerlei
Notwendigkeit, die in Begriffen, Gesetzen oder Formeln darstellbar wäre.
Es ist nur eben tatsächlich so. Die Menschen neigen dazu – weil der
Neue in diesem Bild typischerweise ein Kind ist.
 Wer
mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen.** Wie gut er sich
aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann
am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern
schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bißchen
neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags
verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben
‚meiner’ Welt scheint. Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den
Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite
der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst
ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom
pädagogischem Eros umschrieben wurde.47
Wer
mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen.** Wie gut er sich
aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann
am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern
schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bißchen
neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags
verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben
‚meiner’ Welt scheint. Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den
Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite
der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst
ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom
pädagogischem Eros umschrieben wurde.47
Im
Alltag gelingt es umso eher, je näher Menschen einander stehen. Darum
sind Eltern in der Regel die besseren Pädagogen. Normalisieren können
sie nicht so gut, aber was ihrer Welt an schulischer Breite fehlt,
überbieten sie an anschaulicher Tiefe. Sie sind Alltagskünstler (wenn
auch vielleicht nicht alle.)
 Man
kann immer noch einen Beruf daraus machen. Aber weil Normalität kein
berechtigter Erziehungszweck mehr ist, ist das Labor nicht mehr der
bevorzugte Ort. „Erziehung findet in Situationen statt, und die sind
immer konkret. Erziehen ist eine Sache des Alltags. Pädagogik ist, wo
sie theoretisch ist, Kunstlehre. Und der – gute – Erzieher ist ein
Künstler. Aber ein Aktionskünstler: er schafft keine ‚Werke’, sondern
eben nur – Situationen.“48 Seine Sache ist es, die
Situationen so zu arrangieren, daß sie den andern verlocken, (sich)
heraus zu finden; nie vergessend, daß er selber mitspielt und daß vieles
auch auf seinen Auftritt ankommt. Was es ist und wieviel es ist, wird
er wissen, wenn er es probiert. Er ist kein Ingenieur, sondern ein Performer.
Man
kann immer noch einen Beruf daraus machen. Aber weil Normalität kein
berechtigter Erziehungszweck mehr ist, ist das Labor nicht mehr der
bevorzugte Ort. „Erziehung findet in Situationen statt, und die sind
immer konkret. Erziehen ist eine Sache des Alltags. Pädagogik ist, wo
sie theoretisch ist, Kunstlehre. Und der – gute – Erzieher ist ein
Künstler. Aber ein Aktionskünstler: er schafft keine ‚Werke’, sondern
eben nur – Situationen.“48 Seine Sache ist es, die
Situationen so zu arrangieren, daß sie den andern verlocken, (sich)
heraus zu finden; nie vergessend, daß er selber mitspielt und daß vieles
auch auf seinen Auftritt ankommt. Was es ist und wieviel es ist, wird
er wissen, wenn er es probiert. Er ist kein Ingenieur, sondern ein Performer.
________________________________________________________________________________
*) [Nachtrag: Das ist eine saloppe Formulierung, die ich andernorts präzisiert habe.]
**) Zusatz. Je allgemeiner die ‚Welt’, von der die Rede ist, umso unspezifischer die Tätigkeit des Zeigens: Typischerweise bezeichnet dieses Bild in seiner Allgemeinheit das Verhältnis zwischen einem Erwachsenen und einem Kind.
Man kann ‚die Welt’ von einem partikularen Standpunkt aus ansehen. Je partikularer die ‚Welt’, von der die Rede ist, umso spezifischer der Akt des Zeigens. Die ‚Welt des Soldaten’ ist zwar eine besondere Welt, aber sie ist ‚allgemein’, weil ‚Soldatsein’ keine besondere Verrichtung, sondern eine besondere ‚Seinsweise’ ist; Soldat ist man auch nach Feierabend. Das ist nicht Einweisung in Strategie und Taktik, nicht Waffenkunde, nicht dies oder das, sondern ein ‚ganzes Universum’, wenn auch ein besonderes.
„Pädagogik“ heißt hier ‚Menschenführung’, hat aber mit Kindern nichts mehr zu tun und sollte Andragogik heißen. Die ‚Welt der Physik’ ist dagegen kein Universum, sondern nur ein Ausschnitt: aus der ‚Welt der Wissenschaft’, gar nur der ‚Welt der (‚exakten’) Naturwissenschaften’. Diese hochspezialisierte Welt einem Neuling zeigen ist eine höchst spezifische Tätigkeit, die man von Rechts wegen Lehre nennt. Erst hier gilt: ‚Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt’.
Je allgemeiner die Welt, um die es geht, umso eher ist von Bildung -, je spezifischer die Welt, umso richtiger ist von Lernen die Rede. Merke: Die allgemeinste Welt – die, die den Meisten zugänglich ist – ist die natürliche Welt der natürlichen Sprachen; die Welt, in denen nur Kinder ‚neu’ sind.
Alle Kinder werden irgendwie heranwachsen; dazu brauchen sie keine Professionellen. Professionelle braucht es, um ihnen das „Symbolnetz“ zu überliefern, in dem unsere ganze Welt dargestellt ist: weil das Allgemeinwissen der Menschheit so umfangreich und dabei so komplex geworden ist, daß es nicht mehr einfach in jedenkinds Alltag „vorkommt“ und man einfach nur, jeder an seiner Statt, dort hineinwachsen müßte, learning by doing. Ihre Mitteilung bedarf einer reservierten Zeit außerhalb der Alltagsgeschäfte und einer speziellen Methode, denn natürlich kann nicht jedem alles und schon gar nicht alles zugleich überliefert werden. Aber die Schule privilegierte jene ‚Symbolnetze’, die sich zu diskursiver Verknüpfung eignen. Das war mit dem Schlagwort der ‚Verwissenschaftlichung’ gemeint, das den pädagogsichen Diskurs seit den sechziger Jahren prägte. Verwissenschaftlichung bezieht sich per Definition auf den Bereich des sogenannten ‚Herrschaftswissens’. Anderes fällt nicht in ihren Bereich. Daß seither ‚Lernen’ zum Schlüsselbegriff staatlicher Pädagogik wurde und ‚Bildung’ wie ein Zopf abgeschnitten wurde, ist nur folgerichtig. Quod erat demonstrandum: Das gegenwärtige Schulsystem ist entstanden und behauptet sich als ein Produkt und eine Bedindung der industriellen Arbeitsteilung. Aber die Arbeitsgesellschaft und ihre Industrie sind am Vergehen.
1) J. G. Herder, Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, Darmstadt 1966, S. 227
2) „Fordert den Führerschein für Eltern: Prof. Klaus Hurrelmann“ in: Hör zu,
Heft 25/2001 (15. 06. 01); siehe dazu: J. Ebmeier, Eltern und Erzieher,
oder Die pädagogische Mystifikation in: PÄD Forum 5/2001, S. 322
3) Platon, Politeia, VII. Buch, Kap. 4-18
4) siehe hierzu Ivan D. Rozanskij, Geschichte der antiken Wissenschaft, Mchn. 1984; insbes. S. 7-20
5) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“ in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 216
6)
dt.: Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie, Hamburg 1988
(PhB) Siehe hierzu: Alexandre Koyré, Von der geschlossenen Welt zum
unendlichen Universum, Ffm. 1980; ders., Du monde de l’à-peu-près à l’univers de la précision in: Études d’histoire de la pensée philosophique,
Paris 1971, S. 341-362; auch: Wilhelm Dilthey, „Die Autonomie des
Denkens, der konstruktive Rationalismus und der pantheistische Monismus
nach ihrem Zusammenhang im 17. Jhdt.“ in: Philosophische Aufsätze, Bln.
(O) 1986, S. 327-389
7)
Zu diesem Zweck führt Galileo das Experiment in die Physik ein: nicht
um Gesetze zu entdecken, sondern um eine erdachte Theorie den
Widersachern zu beweisen.
8
)„Das zunehmende Eingreifen gesatzter Ordnungen“ sei „ein besonders
charakteristischer Bestandteil jenes Rationalisierungs- und
Vergesellschaftungsprozesses“, der die „wesentliche Triebkraft“ der
bürgerlichen Entwicklung ausmacht: Max Weber, Wirtschaft und
Gesellschaft, Tbg. 51972, S. 196.
9)
Es ist ein Wechselverhältnis. Dem einen ‚letzten’ Grund entspricht der
allgemeinste Gegenstand, und umgekehrt: je enger der Gegenstand, umso
breiter die Voraussetzungen.
10) René Descartes, Discours de la méthode
(1637) Hbg. 1960 [frz./dt.], S. 66; ein weiterer Stichtag der
abendl„ndischen Vernunft. – Die Begründung für die meta-physischen
Stellung der Mathematik liefert D. 1642 in den Meditationes de prima philosophia nach: [lat./dt.] Hamburg 1959 (PhB)
11)
Der Begriff stammt – als Gegensatz zu den „okularen“ Griechen und
Indern – von Paul Gf. Yorck v. Wartenberg in: ders., Bewußtseinsstellung
und Geschichte, Tbgn. 1956, S. 177
12) In Descartes’ Raum-Welt kommt keine andere Kraft als ‚Druck und Stoß’ vor. Als Newton die Gravitation
einführte, mußte daher der mysteriöse Stoff ‚Äther’ erdacht werden,
durch den diese neue Kraft ‚übertragen’ werden konnte.
13) In der Industrie wird die verräumlichte Zeit selber zur ersten Realität: Zeit ist Geld.
14)
Am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft stand die Erste mediale
Revolution; siehe Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit,
Ffm. 1991, sowie Elisabeth Eisenstein, Die Druckerpresse.
Kulturrevolution im frühen modernen Europa; Wien-New York 1997.
15) Um die Beweiskraft der Argumente ging es schon bei Plato/Sokrates (Theaitetos pass.) Aber
ihre Erkenntnis steht in Dienst des ‚Eros’: der Suche nach der guten
und schönen Lebensführung; und die ist privat, nicht öffentlich.
16) z. B. Plato, Timaios 55e-56c
17)
Das Modewort ‚Konstruktivismus’ entstammt der Einsicht moderner
Mathematiker, daß die Wahrheit der Mathematik in der anschaulichen
Konstruierbarkeit ihrer Figuren besteht; klassisch formuliert von der
sog. Erlanger Schule um Paul Lorenzen (seit den 1950er Jahren).
18) Isaac Newton, Mathematische Grundlagen…, S. 9. – Newton knüpft an Descartes an.
19)
Isaac Newton in Optik, Buch 3, Teil 1, Frage 31; hier zit. nach: J.
Robert Oppenheimer, Wissenschaft und allgemeines Denken, Hbg. 1955
(rde), S. 95f.
20)
Thomas Hobbes zog diese Konsequenz, verzichtete in seinem
philosophischen System auf eine Metaphysik i. e. S., und gilt daher zu
recht als Begründer des modernen metaphysischen Materialismus; und der modernen Wissenschaftsgläubigkeit.
21) 1755 erschien im 5. Band der Encyclopédie
der Artikel „Politische Ökonomie“, verfaßt von J. J. Rousseau. Er
stellt den Wirtschaftsprozeß in Analogie zum menschlichen Stoffwechsel
dar.
22) Quesnays’ Tableau économique erschien ab 1758 in mehreren Bearbeitungen; dt. in: ders., Ökonomische Schriften, Bln. (O) 1971
23)
Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen (1776), Mchn. 1978 (dtv); David
Ricardo, Über die Grundsätze der Politischen Ökonomie und der
Besteuerung (1817), Bln. (O) 1959
24) gr. oíkos: der Haushalt; pólis:
das Gemeinwesen. Der Ausdruck Politische Ökonomie bedeutet
ursprünglich: Lehre vom Staatshaushalt. Die Schrift, in deren Titel er
erstmals auftaucht, enthält daher nur Ratschläge an Ludwig XIII., wie er
seine Staatskasse füllen kann: Antoine de Montchrétien, Traité d’économie politique (Rouen 1615)
25) Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I; in: MEW Bd. 23, S. 741
26)
Da findet ein ungleicher Tausch statt. Der Käufer bezahlt die Arbeit,
wie jede andere Ware, nach ihren (Re-)Produktionskosten: d. h. das, was
der Arbeiter zum Leben braucht. Was die Arbeit darüber hinaus
produziert, gehört dem Käufer auch. Er bezahlt den Tauschwert der Arbeit
und erhält ihren Gebrauchswert, der darin besteht, daß sie mehr
produzieren kann, als sie selber gekostet hat.
27) ebd, S. 744
28) Wilhelm Dilthey und die ‚hermeneutische Schule’
29) von gr. nómos, Gesetz, und thésis, Setzung; und ídios, einzeln, und graphé
Zeichnung; so Wilhelm Windelband in „Geschichte und Naturwissenschaft“,
in: Präludien, Tbg. 1907, S. 355-379, und in seinem Gefolge die
Südwestdeutsche Schule der Neukantianer
30) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“, in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 210
31)
ebd, S. 205. (Rudi Dutschke hat ‚Herrschaftswissen’ im verballhornten
Sinn von Geheimwissen der Herrschenden in die studentische
Umgangssprache eingeführt.)
32)
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 800. In: ders., Werke (Hg.
Weischedel) Bd. IV, Ffm. 1974, S. 673 – `Praktische Philosophie’
bedeutet soviel wie Ethik.
33)
siehe Anm. 26. Sie ‚funktioniert’ freilich nur, wenn die Wirtschaft
ohnehin floriert. In der Krise, wenn man sie wirklich braucht, versagt
sie regelm„áig.
34) Die seit PISA so beliebten „Standards“ sind ein verschämter Ersatz.
35)
Im napoleonischen Frankreich wie im romantischen Deutschland: Unser
humanistisches Bildungsideal verdanken wir in erster Linie dem
bürokratischen preußischen Militärstaat. Der hatte kein
Bildungsbürgertum und keinen kultivierten Adel. Seine Intelligentsia war
seine Beamtenschaft.
36) siehe hierzu J. Ebmeier, Homo ludens victor in: PÄD Forum 2/2003, [S. 114]
37) Das Wort kommt im 17. Jhdt. auf, ‚Pädagogik’ hundert Jahre später. Der griechische paidagogós
war eine verächtliche Figur, ein alter Sklave, der zu sonst nichts mehr
taugte und die Knaben als Sittenwächter in der Öffentlichkeit zu
begleiten hatte. Bevor er namens der Pädagogik zu späten Ehren kam, war
er im 16. Jhdt. in der Korruptionsform il pedante landläufig geworden.
38) Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Hamburg (rde) 21958, S. 65
39) Ernst Cassirer, „Ein Schlüssel zum Wesen des Menschen: das Symbol“ in: Versuch über den Menschen, Hbg. 1990 (PhB), S. 47ff
40) Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek 1961 (rde), S. 57
41) vgl. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928, S. 63ff.
42) Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe Bd. 1, Ffm. 1984, S. 67 [5.6]
43) „Was ich nur meine, ist mein,
gehört mir als diesem besonderen Individuum an; wenn aber die Sprache
nur Allgemeines ausdrückt, so kann ich nicht sagen, was ich nur meine. Und das Unsagbare,
Gefühl, Empfindung, ist nicht das Vortrefflichste, Wahrste, sondern das
Unbedeutendste, Unwahrste.“ G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der
philosophischen Wissenschaften, in: ders., Werke, Bd. 8, Ffm. 1970, S.
74
44) …die darin ihre Berechtigung findet.
45) Wittgenstein wußte das: „Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.“ aaO, S. 83 [6.43] (Es ist sicher nicht die Sprache, nach der sich beide von einander unterscheiden.)
46) Hermann Giesecke, Pädagogik als Beruf, Weinheim 1987, S. 23
47)
Plato bezeichnet im Symposion als Eros das gemeinsame Streben des
Knaben und des Mannes nach der Anschauung des Wahren und Schönen.
48) J. Ebmeier, Kleine Erziehlehre, in: Unsere Jugend 6/1990, S. 229f.
—————————————————————————————
…vom ästhetischen Grund der Bildung
Kritische Ausgangslage
Kritische Ausgangslage
Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt.
Alles entartet unter den Händen des Menschen.
Rousseau
Alles entartet unter den Händen des Menschen.
Rousseau
Nicht von ungefähr hat Herder seine Ideen zu Papier gebracht.[1] Anlaß war das literarische Großereignis des europäischen 18. Jahrhunderts. Kein anderes Buch hat je die Gemüter seiner Zeitgenossen so ergriffen wie Rousseaus Émile.[2]
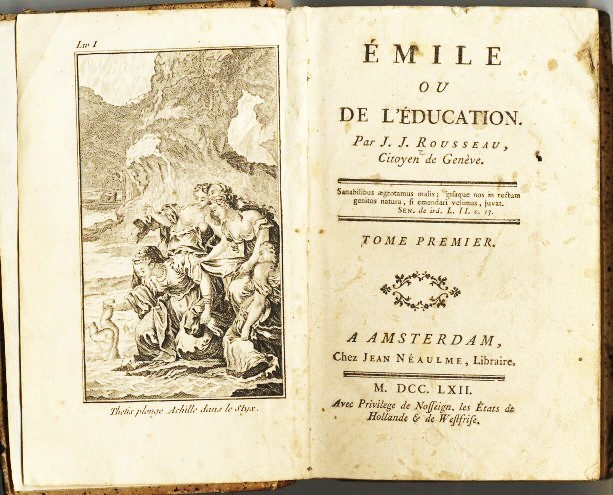 Die
Parole ‚Zurück zur Natur’ steht dort zwar nirgends geschrieben. Wie
anders hätten seine Leser den Gedanken, daß alles gut war, als es aus
der Hand des Schöpfers kam, und erst durch den gesellschaftlichen
Verkehr und seine Traditionen (alias Kultur) korrumpiert worden sei,
aber verstehen sollen! „Die erste Erziehung muß also rein negativ sein“,
lautete die Konsequenz – „nämlich nichts tun und verhüten, daß etwas
getan wird“.[3]
Herders trotzige Antwort war, daß „unser Geschlecht nur durch unser
Geschlecht gebildet“ werde – „und wie könnten wir dies besser als Überlieferung nennen?“[4]
Die
Parole ‚Zurück zur Natur’ steht dort zwar nirgends geschrieben. Wie
anders hätten seine Leser den Gedanken, daß alles gut war, als es aus
der Hand des Schöpfers kam, und erst durch den gesellschaftlichen
Verkehr und seine Traditionen (alias Kultur) korrumpiert worden sei,
aber verstehen sollen! „Die erste Erziehung muß also rein negativ sein“,
lautete die Konsequenz – „nämlich nichts tun und verhüten, daß etwas
getan wird“.[3]
Herders trotzige Antwort war, daß „unser Geschlecht nur durch unser
Geschlecht gebildet“ werde – „und wie könnten wir dies besser als Überlieferung nennen?“[4]
Im
Lebenswerk Rousseaus hatte sich das kritische Prinzip der Aufklärung
gegen sie selber gewendet. Es hat seine eigne Ironie, wie ihr
Grundgedanke von der Allmacht der Erziehung prompt bei einem unserer
drei großen Antiaufklärer[5]
ein neues Zuhause fand – und sich dabei zur bloßen Tradition beschied.
Ebenso ironisch ist es, daß die wissenschaftliche Beschäftigung mit den
Fragen der Pädagogik durchaus nicht bei deren Apologeten ihren Ausgang
nahm, sondern bei den Kritikern.
Daß ‚die Praxis’ von alleine ‚zur Theorie drängt’, ist eine Legende. Solang es geht, wird sie sich auch vor neuen Herausforderungen mit dem Spiel von Versuch und Irrtum begnügen. Damit Erziehung in den Bereich wissenschaftlichen Denkens geriet, mußte auf Seiten der Wissenschaft das Interesse – ein logisches wie ein sachliches – erwachsen sein, auch diesen Ausschnitt der Welt zu vereinnahmen. Mit andern Worten, Wissenschaft mußte beginnen, sich zur öffentlich allzuständigen Instanz zu bilden, indem… die Wissenschaftler begannen, sich als gesellschaftlicher Stand festzusetzen.
 Descartes hatte mit seiner Unterscheidung der Zwei Substanzen[6]
die Physik aus den Fesseln der Theologie befreit und der
Naturwissenschaft einen gewaltigen Aufschwung beschert. Aber er hatte
einen Zwiespalt in die Welt gesetzt, der das Denken beunruhigte. Spinoza[7] hatte den Zwiespalt behoben, indem er die res cogitans ihrerseits als extensa, oder richtiger: als ‚sich ausdehnend’ definiert hatte.[8] Doch in dieser more geometrico rekonstruierten Welt war alles nur ‚Gesetz’ und ‚Determination’. Die
Individualität, die doch, diesseits aller theoretischen Kon- und
Rekonstruktion, zu den lebenspraktisch vordringlichen Realitäten gehört,
ging unter. Das ‚Ich’ in eine mathematisch erfaßte Welt wieder
einzuführen, war das Hauptanliegen von Leibniz.[9]
Außer einer ausgedehnten, unendlich teilbaren Materie müsse es wohl
noch „wesentliche Einheiten“ geben, die den toten Stoff zu etwas
Wirklichem formen. „Man könnte sie metaphysische Punkte nennen: sie
haben etwas Lebendiges und eine Art Wahrnehmung“.[10]
Die charakteristische Form ihrer Wahrnehmung ist die mathematische:
weil „bei der ersten Hervorbringung der Dinge eine gewisse göttliche
Mathematik oder ein metaphysischer Mechanismus zur Anwendung kommt“.[11] Diese ‚Monaden’[12] sind geistige Einheiten und sind das eigentlich Reale.
Descartes hatte mit seiner Unterscheidung der Zwei Substanzen[6]
die Physik aus den Fesseln der Theologie befreit und der
Naturwissenschaft einen gewaltigen Aufschwung beschert. Aber er hatte
einen Zwiespalt in die Welt gesetzt, der das Denken beunruhigte. Spinoza[7] hatte den Zwiespalt behoben, indem er die res cogitans ihrerseits als extensa, oder richtiger: als ‚sich ausdehnend’ definiert hatte.[8] Doch in dieser more geometrico rekonstruierten Welt war alles nur ‚Gesetz’ und ‚Determination’. Die
Individualität, die doch, diesseits aller theoretischen Kon- und
Rekonstruktion, zu den lebenspraktisch vordringlichen Realitäten gehört,
ging unter. Das ‚Ich’ in eine mathematisch erfaßte Welt wieder
einzuführen, war das Hauptanliegen von Leibniz.[9]
Außer einer ausgedehnten, unendlich teilbaren Materie müsse es wohl
noch „wesentliche Einheiten“ geben, die den toten Stoff zu etwas
Wirklichem formen. „Man könnte sie metaphysische Punkte nennen: sie
haben etwas Lebendiges und eine Art Wahrnehmung“.[10]
Die charakteristische Form ihrer Wahrnehmung ist die mathematische:
weil „bei der ersten Hervorbringung der Dinge eine gewisse göttliche
Mathematik oder ein metaphysischer Mechanismus zur Anwendung kommt“.[11] Diese ‚Monaden’[12] sind geistige Einheiten und sind das eigentlich Reale.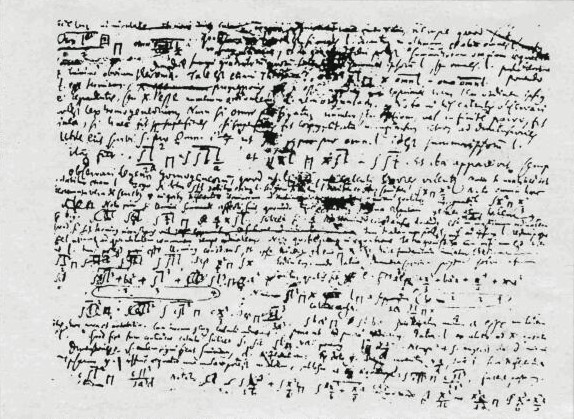 Diese
Metaphysik war gewaltsam konstruiert, und Leibniz macht kein Hehl
daraus, daß sie weniger auf Gründen beruht als auf Motiven: Sie kommt
ihm „vorteilhaft“ und „schön“ vor.[13] Doch
läßt sie sich nachträglich rechtfertigen, indem man sie zu einem –
gewissermaßen selbsttragenden – logischen System ausbaut: Wenn alle
Teile zusammenpassen, muß das Ganze wohl stimmen. Diesen Ausbau besorgte
Christian Wolff,[14]
der damit in Deutschland zum beherrschenden Denker seines Jahrhunderts
wurde. Rationalismus hieß: die Welt mit Worten ausmessen – und das war
„Aufklärung“! Die zahllosen Adepten des ‚Wolff-Leibniz’schen Systems’
machten sich über jeden Winkel der Welt und der Vorstellung her und
meinten, eine Sache begriffen zu haben, sobald sie sie definieren
konnten. Seither bedeutet Vernunft in Deutschland: sehr, sehr viele
Wörter.
Diese
Metaphysik war gewaltsam konstruiert, und Leibniz macht kein Hehl
daraus, daß sie weniger auf Gründen beruht als auf Motiven: Sie kommt
ihm „vorteilhaft“ und „schön“ vor.[13] Doch
läßt sie sich nachträglich rechtfertigen, indem man sie zu einem –
gewissermaßen selbsttragenden – logischen System ausbaut: Wenn alle
Teile zusammenpassen, muß das Ganze wohl stimmen. Diesen Ausbau besorgte
Christian Wolff,[14]
der damit in Deutschland zum beherrschenden Denker seines Jahrhunderts
wurde. Rationalismus hieß: die Welt mit Worten ausmessen – und das war
„Aufklärung“! Die zahllosen Adepten des ‚Wolff-Leibniz’schen Systems’
machten sich über jeden Winkel der Welt und der Vorstellung her und
meinten, eine Sache begriffen zu haben, sobald sie sie definieren
konnten. Seither bedeutet Vernunft in Deutschland: sehr, sehr viele
Wörter.Kopernikanische Wende
Als Doktrin scheint Philosophie gar
nicht nötig, sondern als Kritik.
Kant
nicht nötig, sondern als Kritik.
Kant
 Und dann kam Émile.
Immanuel Kants Kritiken gehen unmittelbar auf diesen Anstoß – nein: auf
diesen Stoß zurück. Die Aufklärung wandte sich auch hier gegen sich
selbst. Kant hatte Jahrzehnte lang selber das Wolff’sche System gelehrt;
unzufrieden zwar mit seinen schwachen Gründen, aber wo war die
Alternative? Bei Rousseau hat er den Anhaltspunkt gefunden, auf dem die
Vernunft neu bauen konnte: das ‚transzendentale Ich’ und seine Freiheit.[15]
Das war die „kopernikanische Wende“ der Philosophie, die sich seit
Des-cartes angebahnt hatte: Nicht die Äußerungen eines objektiv Seienden
sind Ursache unseres Wissens, sondern die eigenen Leistungen eines
Subjekts, dem nichts Gegebenes selbstverständlich ist und das sich
seiner guten Gründe auf Schritt und Tritt immer wieder versichern muß.
Kants Kritiken schlugen in Deutschland ein wie zuvor der Émile in Europa.
Eine systematische Gesamtdarstellung seiner Philosophie ist ihm nicht
mehr gelungen, sein Werk liegt in Einzelteilen und Bruchstücken vor.
Halbheiten und Widersprüche blieben da nicht aus und haben sogleich den
lebendigsten Teil der akademischen Jugend zum Selberdenken angespornt.
Ausgerech-net für die Pädagogik hatte Kant aus seiner Freiheitslehre am
wenigsten Konsequenzen gezogen. In seinen eignen Vorlesungen[16]
macht er sich zum Echo seines gehässigen Erzfeindes Herder: „Der Mensch
kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was
Erziehung aus ihm macht.“[17]
Und dann kam Émile.
Immanuel Kants Kritiken gehen unmittelbar auf diesen Anstoß – nein: auf
diesen Stoß zurück. Die Aufklärung wandte sich auch hier gegen sich
selbst. Kant hatte Jahrzehnte lang selber das Wolff’sche System gelehrt;
unzufrieden zwar mit seinen schwachen Gründen, aber wo war die
Alternative? Bei Rousseau hat er den Anhaltspunkt gefunden, auf dem die
Vernunft neu bauen konnte: das ‚transzendentale Ich’ und seine Freiheit.[15]
Das war die „kopernikanische Wende“ der Philosophie, die sich seit
Des-cartes angebahnt hatte: Nicht die Äußerungen eines objektiv Seienden
sind Ursache unseres Wissens, sondern die eigenen Leistungen eines
Subjekts, dem nichts Gegebenes selbstverständlich ist und das sich
seiner guten Gründe auf Schritt und Tritt immer wieder versichern muß.
Kants Kritiken schlugen in Deutschland ein wie zuvor der Émile in Europa.
Eine systematische Gesamtdarstellung seiner Philosophie ist ihm nicht
mehr gelungen, sein Werk liegt in Einzelteilen und Bruchstücken vor.
Halbheiten und Widersprüche blieben da nicht aus und haben sogleich den
lebendigsten Teil der akademischen Jugend zum Selberdenken angespornt.
Ausgerech-net für die Pädagogik hatte Kant aus seiner Freiheitslehre am
wenigsten Konsequenzen gezogen. In seinen eignen Vorlesungen[16]
macht er sich zum Echo seines gehässigen Erzfeindes Herder: „Der Mensch
kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was
Erziehung aus ihm macht.“[17] Die Radikalen unter Kants Anhängern hatten sich um das Philosophische Journal gesammelt, das seit 1795 von Friedrich Immanuel Niethammer, seit 1797 gemeinsam mit Johann Gottlieb Fichte herausgegeben wurde und seinen größten Ruhm, aber auch sein Ende im Atheismusstreit des Jahres 1798/99 finden sollte. Das war die erste wissenschaftliche Publikation, die theoretische Fragen der Pädagogik in Eigenbeiträgen sowohl wie in Rezensionen und Literaturberichten regelmäßig behandelt hat. Dort wurde (m. W. erstmals) aus der offenkundigen Spannung zwischen ‚Freiheit’ und ‚Erziehung’ die Notwendigkeit abgeleitet, Pädagogik zu einer systematischen Wissenschaft zu entwickeln.[18]
 Das
neue Interesse an Pädagogik war nicht nur philosophisch. Die geistige
Situation Deutschlands wurde durch ein Phänomen geprägt, dessen Spuren
wir bis heute tragen: das Aufkommen eines „akademischen Proletariats“ –
Sturm und Drang und die Romantik wären ohne das gar nicht denkbar. Die
deutschen Universitäten entließen weit mehr Absolventen, als das
bürgerlich unterentwickelte Land gebrauchen konnte. Die erste Station
auf dem Weg des Jungakademikers in eine öffentliche Anstellung – oder in
die Verlumpung – war regelmäßig der Posten eines Hauslehrers. Weder
Kant noch Hegel blieb sie erspart, und Hölderlin hat sie um den Verstand
gebracht. Doch Fichte
hatte etwas daraus gemacht. Er war in die Schweiz gegangen und hatte
die Gelegenheit genutzt, um die Bekanntschaft Pestalozzis zu suchen. Auf
dem Höhepunkt des Atheismusstreits konnte er daher schreiben, eine
Philosophie sei „nicht eher vollendet, bis sie pädagogisch wird“.[19] Oder anders, nur als vollendete Philosophie ist Pädagogik zu vertreten!
Das
neue Interesse an Pädagogik war nicht nur philosophisch. Die geistige
Situation Deutschlands wurde durch ein Phänomen geprägt, dessen Spuren
wir bis heute tragen: das Aufkommen eines „akademischen Proletariats“ –
Sturm und Drang und die Romantik wären ohne das gar nicht denkbar. Die
deutschen Universitäten entließen weit mehr Absolventen, als das
bürgerlich unterentwickelte Land gebrauchen konnte. Die erste Station
auf dem Weg des Jungakademikers in eine öffentliche Anstellung – oder in
die Verlumpung – war regelmäßig der Posten eines Hauslehrers. Weder
Kant noch Hegel blieb sie erspart, und Hölderlin hat sie um den Verstand
gebracht. Doch Fichte
hatte etwas daraus gemacht. Er war in die Schweiz gegangen und hatte
die Gelegenheit genutzt, um die Bekanntschaft Pestalozzis zu suchen. Auf
dem Höhepunkt des Atheismusstreits konnte er daher schreiben, eine
Philosophie sei „nicht eher vollendet, bis sie pädagogisch wird“.[19] Oder anders, nur als vollendete Philosophie ist Pädagogik zu vertreten! Freilich nicht als eine positive Lehre, deren einzelne Sätze als Verhaltensregeln taugen. „Unser philosophisches Denken bedeutet nichts und hat nicht den mindesten Gehalt. Und es ist nicht einmal Mittel, das Leben zu bilden. Es ist lediglich Mittel, das Leben zu erkennen.“ Der Philosophie „Hauptnutzen ist negativ und kritisch. Ihr Einfluß auf die Gesinnung des Menschengeschlechts ist, daß sie ihnen Kraft, Mut und Selbstvertrauen beibringt, indem sie den Menschen auf seine eignen Füße stellt.“[20] In der Erziehung geht es darum, „die innere Kraft des Zöglings nur zu entwickeln, nicht aber ihr die Richtung zu geben. Die Erziehung muß sich erst bescheiden, mehr negativ zu sein als positiv; nur Wechselwirkung mit dem Zögling, nicht Einwirkung auf ihn.“[21]
Die Entdeckung des Ästhetischen
Es gibt keine Wissenschaft des
Schönen, sondern nur Kritik.
Kant
Schönen, sondern nur Kritik.
Kant
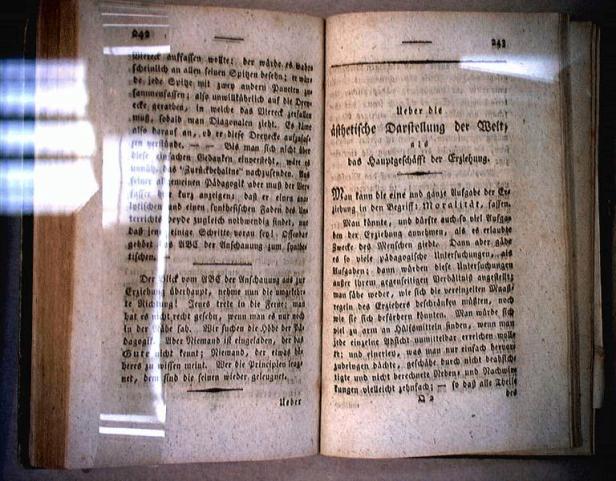 Einer der ersten und eifrigsten Hörer Fichtes war Johann Friedrich Herbart [22] gewesen. Er hatte zu seinem engeren Kreis gehört, der Jenenser Gesellschaft freier Männer.
Von seiner Philosophie hat er sich bald abgewandt, aber seinem Weg zu
Pestalozzi ist er gefolgt. Er wurde Hauslehrer in Bern, und die Freude
daran hat ihn fürs Leben geprägt. Bei seiner ersten pädagogischen
Schrift handelt es sich um einen Kommentar zu Pestalozzis Idee eines ABC der Anschauung.[23]
Im Anhang zu deren 2. Auflage 1804 formuliert er, bevor er noch die
Allgemeine Pädagogik ‚aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet’ hatte,[24] seine pädagogische Grundeinsicht, die seither hätte Epoche machen sollen und es künftig sicher tut: Das Hauptgeschäft der Erziehung ist die ästhetische Darstellung der Welt.[25]
So schräg das noch heute klingt, so bieder lautet aber der erste Satz
seiner Abhandlung: „Man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in
dem Begriff Moralität fassen“. Die Aufgabe – Moralität; das
Geschäft – ästhetische Darstellung? Einen dieser Begriffe, oder alle
beide, muß Herbart wohl in einem sehr eignen Sinn verwenden.
Einer der ersten und eifrigsten Hörer Fichtes war Johann Friedrich Herbart [22] gewesen. Er hatte zu seinem engeren Kreis gehört, der Jenenser Gesellschaft freier Männer.
Von seiner Philosophie hat er sich bald abgewandt, aber seinem Weg zu
Pestalozzi ist er gefolgt. Er wurde Hauslehrer in Bern, und die Freude
daran hat ihn fürs Leben geprägt. Bei seiner ersten pädagogischen
Schrift handelt es sich um einen Kommentar zu Pestalozzis Idee eines ABC der Anschauung.[23]
Im Anhang zu deren 2. Auflage 1804 formuliert er, bevor er noch die
Allgemeine Pädagogik ‚aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet’ hatte,[24] seine pädagogische Grundeinsicht, die seither hätte Epoche machen sollen und es künftig sicher tut: Das Hauptgeschäft der Erziehung ist die ästhetische Darstellung der Welt.[25]
So schräg das noch heute klingt, so bieder lautet aber der erste Satz
seiner Abhandlung: „Man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in
dem Begriff Moralität fassen“. Die Aufgabe – Moralität; das
Geschäft – ästhetische Darstellung? Einen dieser Begriffe, oder alle
beide, muß Herbart wohl in einem sehr eignen Sinn verwenden. ‚Ästhetik’ ist, wie ‚Bildung’,[26] eine typisch-deutsche Prägung. Sie wurde von A. G. Baumgarten eingeführt. Das Werk, das diesen Titel trägt,[27]
ist ein charakteristisches Produkt der Wolff’schen Schule: Wörter
werden durch Wörter bestimmt. Ästhetik wird, der griechischen Wurzel
gemäß,[28]
als Wissenschaft des sinnlichen Erkennens definiert, aber darunter sind
sowohl die Theorie der schönen Künste als auch die „untere
Erkenntnislehre“, das Wissen von den Sinnesreizen gefaßt, und diese
Vieldeutigkeit blieb den ästhetischen Debatten bis heut erhalten. Kant
hat das Ästhetische in seine kritische Erkenntnistheorie aufgenommen und
in Gestalt der Urteilskraft als eine Art Mittelglied zwischen das
theoretische Vermögen (das auf Erkenntnis des Seienden gerichtet ist)
und das praktische Vermögen (das ‚aus Freiheit’ postuliert, was sein
soll) geschoben;[29]
ohne daß immer klar würde, ob es sich dabei um ein selbständiges
Drittes handelt oder um einen Übergang oder um eine Schnittmenge. Oder
womöglich um die höhere Einheit? (So hat Fichte sie genommen.)
‚Ästhetik’ ist, wie ‚Bildung’,[26] eine typisch-deutsche Prägung. Sie wurde von A. G. Baumgarten eingeführt. Das Werk, das diesen Titel trägt,[27]
ist ein charakteristisches Produkt der Wolff’schen Schule: Wörter
werden durch Wörter bestimmt. Ästhetik wird, der griechischen Wurzel
gemäß,[28]
als Wissenschaft des sinnlichen Erkennens definiert, aber darunter sind
sowohl die Theorie der schönen Künste als auch die „untere
Erkenntnislehre“, das Wissen von den Sinnesreizen gefaßt, und diese
Vieldeutigkeit blieb den ästhetischen Debatten bis heut erhalten. Kant
hat das Ästhetische in seine kritische Erkenntnistheorie aufgenommen und
in Gestalt der Urteilskraft als eine Art Mittelglied zwischen das
theoretische Vermögen (das auf Erkenntnis des Seienden gerichtet ist)
und das praktische Vermögen (das ‚aus Freiheit’ postuliert, was sein
soll) geschoben;[29]
ohne daß immer klar würde, ob es sich dabei um ein selbständiges
Drittes handelt oder um einen Übergang oder um eine Schnittmenge. Oder
womöglich um die höhere Einheit? (So hat Fichte sie genommen.)  „Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken.“[30]
Was ist daran ästhetisch? Ästhetisch wird es, wenn das Allgemeine als
der Zweck, als die höhere Bestimmung des Besondern aufgefaßt wird:
„Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie,
ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird.“[31]
Schönheit ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck; oder schön ist, was als Zweck
seiner selbst erscheint – und so gerät das Ästhetische in ganz intime
Nähe zum ‚Sinn der Welt’! Denn immerhin erscheint unserm theoretischen
Verstand die ganze Natur „so, als ob“ sie zweckmäßig eingerichtet sei; so, daß immer eins genau zum andern paßt; so, als ob sie nach einem Plan gemacht ist.[32]
Das ist zunächst einmal eine nützliche Fiktion, wenn es darum geht, die
Dinge der Welt industriell brauchbar zu machen, und rechtfertigt sich
durch den Erfolg. Aber abgesehen davon? Abgesehen davon erscheint die
Zweckmäßigkeit der Welt ohne Zweck. Es ist eine ästhetische Idee, die
unserer Umgangssprache als Sinn geläufig ist. „Unter einer
ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der
Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend
ein bestimmter Gedanke, d. h. Begriff adäquat sein kann, die folglich
keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann.“[33]
Die Einbildungskraft ist nämlich das „produktive Erkenntnisvermögen“,
ihr Geschäft ist die „Schaffung gleichsam einer andern Natur aus dem
Stoff, den ihr die wirkliche gibt.“[34]
Die andere, unstoffliche, überwirkliche ‚Natur’, das ist die Welt des
Sinns; des moralischen, des ästhetischen – gleichviel: „Das Schöne ist
das Symbol des Sittlichen.“[35]
„Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken.“[30]
Was ist daran ästhetisch? Ästhetisch wird es, wenn das Allgemeine als
der Zweck, als die höhere Bestimmung des Besondern aufgefaßt wird:
„Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie,
ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird.“[31]
Schönheit ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck; oder schön ist, was als Zweck
seiner selbst erscheint – und so gerät das Ästhetische in ganz intime
Nähe zum ‚Sinn der Welt’! Denn immerhin erscheint unserm theoretischen
Verstand die ganze Natur „so, als ob“ sie zweckmäßig eingerichtet sei; so, daß immer eins genau zum andern paßt; so, als ob sie nach einem Plan gemacht ist.[32]
Das ist zunächst einmal eine nützliche Fiktion, wenn es darum geht, die
Dinge der Welt industriell brauchbar zu machen, und rechtfertigt sich
durch den Erfolg. Aber abgesehen davon? Abgesehen davon erscheint die
Zweckmäßigkeit der Welt ohne Zweck. Es ist eine ästhetische Idee, die
unserer Umgangssprache als Sinn geläufig ist. „Unter einer
ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der
Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend
ein bestimmter Gedanke, d. h. Begriff adäquat sein kann, die folglich
keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann.“[33]
Die Einbildungskraft ist nämlich das „produktive Erkenntnisvermögen“,
ihr Geschäft ist die „Schaffung gleichsam einer andern Natur aus dem
Stoff, den ihr die wirkliche gibt.“[34]
Die andere, unstoffliche, überwirkliche ‚Natur’, das ist die Welt des
Sinns; des moralischen, des ästhetischen – gleichviel: „Das Schöne ist
das Symbol des Sittlichen.“[35]Die Kritik der Urteilskraft war ein Nachzügler, die dritte der Kritiken, und führte den Autor zu Ergebnissen, die er nicht erwartet hatte. Den erwähnten Halbheiten und Widersprüchen fügte sie das ihre hinzu. Die obige Darstellung ist nicht bloß eine Raffung, sondern eine Interpretation. Andere sind möglich; ob sie aber schlüssiger wären? Diese hier tut dem Geschmack des Autors immerhin keine Gewalt: hatte er doch seinen Abfall vom Wolff-Leibniz’schen System mit den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen[36] eingeleitet, wo er sich – halb versuchsweise und tändelnd – an die Kunst- und Schönheitsmetaphysik des Grafen Shaftesbury anschloß.[37] Jedenfalls wurde die Kritik der Urteilskraft zu so etwas wie der Geburtsakte von Romantik und ‚Wissenschaftslehre’.
Schillers Spieltrieb
Es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen
Menschen vernünftig zu machen, als daß man
denselben zuvor ästhetisch macht.
Schiller
Menschen vernünftig zu machen, als daß man
denselben zuvor ästhetisch macht.
Schiller
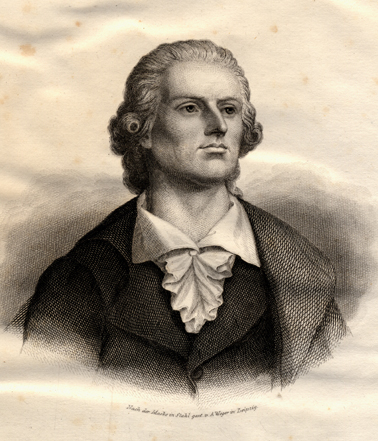 Vermittelnd
trat Friedrich Schiller dazwischen. Sein Interesse am Ästhetischen ist
von vornherein nicht bloß theoretisch, sondern politisch und
pädagogisch. Seine Ästhetische Erziehung des Menschen entstand 1793/94 und rechtfertigt seine Abkehr von der (französischen) Revolution.[38] Die Kritik an der bürgerlichen
Gesellschaft ist ungebrochen, er knüpft weiterhin an Rousseau an: „Die
Kultur, weit davon entfernt, uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit
jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis,“[39]
das uns gefangen nimmt, indem es das System der Arbeitsteilung
hervorbringt, das den Menschen vereinseitigt und auf einen bestimmten
Beruf festlegt. „Wir sehen ganze Klassen von Menschen nur einen Teil
ihrer Anlagen entfalten, während dass die übrigen, wie bei verkrüppelten
Gewächsen, kaum in matter Spur angedeutet sind. Ewig nur an ein
einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der
Mensch selbst nur als ein Bruchstück aus“ und wird dabei „bloß zum
Abdruck seines Geschäfts“.[40]
Schiller erkennt aber auch den Fortschritt darin: „Die mannigfaltigen
Anlagen im Menschen zu entwickeln, war kein anderes Mittel, als sie
einander entgegenzusetzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große
Instrument der Kultur. Einseitigkeit in Übung der Kräfte führt zwar das
Individuum unausbleiblich zum Irrtum, aber die Gattung zur Wahrheit.“[41]
Vermittelnd
trat Friedrich Schiller dazwischen. Sein Interesse am Ästhetischen ist
von vornherein nicht bloß theoretisch, sondern politisch und
pädagogisch. Seine Ästhetische Erziehung des Menschen entstand 1793/94 und rechtfertigt seine Abkehr von der (französischen) Revolution.[38] Die Kritik an der bürgerlichen
Gesellschaft ist ungebrochen, er knüpft weiterhin an Rousseau an: „Die
Kultur, weit davon entfernt, uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit
jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis,“[39]
das uns gefangen nimmt, indem es das System der Arbeitsteilung
hervorbringt, das den Menschen vereinseitigt und auf einen bestimmten
Beruf festlegt. „Wir sehen ganze Klassen von Menschen nur einen Teil
ihrer Anlagen entfalten, während dass die übrigen, wie bei verkrüppelten
Gewächsen, kaum in matter Spur angedeutet sind. Ewig nur an ein
einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der
Mensch selbst nur als ein Bruchstück aus“ und wird dabei „bloß zum
Abdruck seines Geschäfts“.[40]
Schiller erkennt aber auch den Fortschritt darin: „Die mannigfaltigen
Anlagen im Menschen zu entwickeln, war kein anderes Mittel, als sie
einander entgegenzusetzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große
Instrument der Kultur. Einseitigkeit in Übung der Kräfte führt zwar das
Individuum unausbleiblich zum Irrtum, aber die Gattung zur Wahrheit.“[41] Soll nun im Gattungsinteresse das Individuum dazu verurteilt bleiben, „über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäumen“? Wenn die Kultur mit ihren Künsten die Verkümmerung der Individuen unausweichlich machte, dann gilt es, durch eine „höhere Kunst“ die Totalität der Person wiederherzustellen.[42] Wer soll das tun, und wie? Die Revolution hatte alle Hoffnung auf den Staat gesetzt, aber die Menschen waren für die Freiheit noch nicht reif, die Republik wurde zur „Tyrannei gegen das Individuum“, bis es sich am Ende gar zur alten Unterdrückung zurück-sehnen mochte![43] Der Staat fällt als Mittel der Befreiung aus. Umgekehrt, ein freier Staat wird erst möglich, wenn die Individuen zur Freiheit gebildet sind. „Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der Staat nicht hergibt.“ Da er selber Künstler war, mußte Schiller nicht lange suchen: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst.“[44]
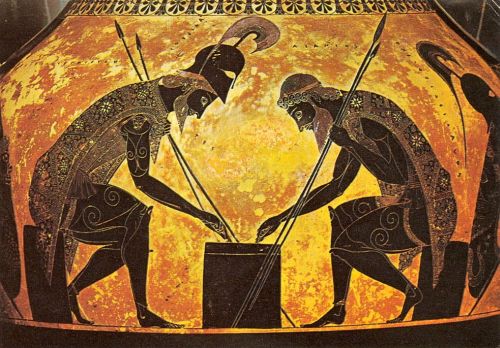 Die
Doppelnatur des Menschen, mal Natur-, mal Vernunftwesen, kommt in
seiner zwiespältigen Triebstruktur zum Ausdruck: Dem „sinnlichen Trieb“,
der auf die
Befriedigung der Bedürfinisse in der Zeit gerichtet ist, steht ein
„Formtrieb“ gegenüber, der auf die – logische und moralische – höhere
Bestimmung des Menschen in der Ewigkeit zielt. Der eine kommt aus dem
prallen Leben, der andre reißt ihn über dessen Verstrickungen hinaus.
Nur seinem sinnlichen Trieb preisgegeben, bleibt der Mensch eine Art
Gemüse. Nur dem Formtrieb verfallen, erstirbt er dem Leben. Doch es gibt ein Drittes, „in welchem beide verbunden wirken“: der Spieltrieb. [45]
Der Gegenstand des sinnlichen Triebs heißt Leben, der des Formtriebs
heißt Gestalt; „der Gegenstand des Spieltriebs wird also lebende Gestalt
heißen können – ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten
der Erscheinung und dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt,
zur Bezeichnung dient“.[46]
Im Spiel sind beide Naturen des Menschen zwanglos vereint, indem
„gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, das ihn vollständig macht
und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet. Mit dem Angenehmen“ – dem
Gegenstand des Bedürfnisses, – „mit dem Guten und Vollkommenen“ – dem
Gegenstand des Formtriebs – „ist es dem Menschen nur ernst“, und wer
kann das aushalten? „Aber mit der Schönheit spielt er. Der Mensch soll
mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit
spielen. Er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“[47]
Die
Doppelnatur des Menschen, mal Natur-, mal Vernunftwesen, kommt in
seiner zwiespältigen Triebstruktur zum Ausdruck: Dem „sinnlichen Trieb“,
der auf die
Befriedigung der Bedürfinisse in der Zeit gerichtet ist, steht ein
„Formtrieb“ gegenüber, der auf die – logische und moralische – höhere
Bestimmung des Menschen in der Ewigkeit zielt. Der eine kommt aus dem
prallen Leben, der andre reißt ihn über dessen Verstrickungen hinaus.
Nur seinem sinnlichen Trieb preisgegeben, bleibt der Mensch eine Art
Gemüse. Nur dem Formtrieb verfallen, erstirbt er dem Leben. Doch es gibt ein Drittes, „in welchem beide verbunden wirken“: der Spieltrieb. [45]
Der Gegenstand des sinnlichen Triebs heißt Leben, der des Formtriebs
heißt Gestalt; „der Gegenstand des Spieltriebs wird also lebende Gestalt
heißen können – ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten
der Erscheinung und dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt,
zur Bezeichnung dient“.[46]
Im Spiel sind beide Naturen des Menschen zwanglos vereint, indem
„gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, das ihn vollständig macht
und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet. Mit dem Angenehmen“ – dem
Gegenstand des Bedürfnisses, – „mit dem Guten und Vollkommenen“ – dem
Gegenstand des Formtriebs – „ist es dem Menschen nur ernst“, und wer
kann das aushalten? „Aber mit der Schönheit spielt er. Der Mensch soll
mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit
spielen. Er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“[47] Dann – mit dem 19. Brief – bricht Schiller seinen Gedankengang plötzlich ab. Soeben hat er Fichtes „Wissenschaftslehre“ gelesen.[48] Die beiden ‚Triebe’ läßt er nun beiseite, als legten sie einander brach: „Die Entgegensetzung zweier Naturnotwendigkeiten gibt der Freiheit ihren Ursprung”! Seither gibt es „in dem Menschen keine andere Macht als seinen Willen“. Jene „mittlere Stimmung“, wo die Triebe verstummen und der Mensch in seinen ursprünglichen „negativen Zustand der bloßen Bestimmungslosigkeit“ zurückkehrt, diesen „Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit“ muß man „den ästhetischen heißen“. „In dem ästhetischen Zustand ist der Mensch also Null“,

nämlich „an Inhalt völlig leer“, und findet sich in der Freiheit wieder, „aus sich selbst zu machen, was er will. Das Vermögen, welches ihm in der ästhetischen Stimmung zurückgegeben wird“, ist „als die höchste aller Schenkungen zu betrachten“, und es ist „nicht bloß poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man die Schönheit unsre zweite Schöpferin nennt.“[49]
Produktive Einbildungskraft
Das Anschauen, im Gegensatz
zum Gefühl, ist Tätigkeit.
J. G. Fichte
zum Gefühl, ist Tätigkeit.
J. G. Fichte
Das
war das erstemal, daß der Erziehung ein gesellschaftspolitischer Zweck
zugemutet wurde, und natürlich geschah es auf deutschem Boden, in
deutscher Sprache. Immerhin, Ort dieser Pädagogik ist der ästhetische
Zustand, und ihr Medium ist das Spiel – das wär so ein schlechter Ansatz
nicht gewesen. Das war es auch nicht, was den von Schiller namentlich
in Anspruch genommenen Fichte auf den Plan rief. Erst vor wenigen
Monaten hatte er Skandal gemacht, als er – der einzige namhafte Deutsche
– die französische Revolution auch nach dem jakobinischen Terror noch
uneingeschränkt gerechtfertigt hatte.[50] Sollte er sich jetzt als Zeugen für deren Vergeblichkeit aufbieten lassen? Für Schillers Horen
verfaßte er eine eigne ästhetische Abhandlung „Über Geist und Buchstab
in der Philosophie“ – die den politischen Streitpunkt nicht hinter dem
philosophischen versteckt: Nicht müssen die Menschen erst ästhetisch
gebildet werden, um sie zur Freiheit zu befähigen, sondern umgekehrt:
Erst müssen sie frei werden – von der materiellen Not zumal -, um zu
ästhetischer Bildung die Muße zu finden.
 „Selbst
die Erkenntnis wird zunächst nicht um ihrer selbst willen, sondern für
einen Zweck außer ihr gesucht. Mit der Kargheit der Natur haben wir
nicht Zeit, bei der Betrachtung der Dinge um uns herum zu verweilen;
emsig fassen wir die brauchbaren Beschaffenheiten derselben auf, um
Nutzen
von ihnen zu ziehen. Das Menschengeschlecht muß erst zu einem gewissen
äußern Wohlstand und zur Ruhe gekommen sein, ehe dasselbe ohne Absicht
auf das gegenwärtige Bedürfnis – und selbst mit der Gefahr, sich zu
irren – beobachten, bei seinen Beobachtungen verweilen und unter dieser
müßigen und liberalen Betrachtung den ästhetischen Eindrücken sich
hingeben kann. Wenn es von der einen Seite nicht ratsam ist, die
Menschen freizulassen, ehe ihr ästhetischer Sinn entwickelt ist, so ist
es von der andern Seite unmöglich, diesen zu entwickeln, ehe sie frei
sind; und die Idee, durch ästhetische Erziehung den Menschen zur
Würdigkeit der Freiheit und mit ihr zur Freiheit selbst zu erheben,
führt uns im Kreise herum, wenn wir nicht vorher ein Mittel finden, in
Einzelnen aus der großen Menge den Mut zu erwecken, niemandes Herren und
niemandes Knecht zu sein“.[51]
„Selbst
die Erkenntnis wird zunächst nicht um ihrer selbst willen, sondern für
einen Zweck außer ihr gesucht. Mit der Kargheit der Natur haben wir
nicht Zeit, bei der Betrachtung der Dinge um uns herum zu verweilen;
emsig fassen wir die brauchbaren Beschaffenheiten derselben auf, um
Nutzen
von ihnen zu ziehen. Das Menschengeschlecht muß erst zu einem gewissen
äußern Wohlstand und zur Ruhe gekommen sein, ehe dasselbe ohne Absicht
auf das gegenwärtige Bedürfnis – und selbst mit der Gefahr, sich zu
irren – beobachten, bei seinen Beobachtungen verweilen und unter dieser
müßigen und liberalen Betrachtung den ästhetischen Eindrücken sich
hingeben kann. Wenn es von der einen Seite nicht ratsam ist, die
Menschen freizulassen, ehe ihr ästhetischer Sinn entwickelt ist, so ist
es von der andern Seite unmöglich, diesen zu entwickeln, ehe sie frei
sind; und die Idee, durch ästhetische Erziehung den Menschen zur
Würdigkeit der Freiheit und mit ihr zur Freiheit selbst zu erheben,
führt uns im Kreise herum, wenn wir nicht vorher ein Mittel finden, in
Einzelnen aus der großen Menge den Mut zu erwecken, niemandes Herren und
niemandes Knecht zu sein“.[51] Anders als Schiller hat Fichte nie eines Fürsten Gunst erworben und hat das Proletarierkind nie verleugnet. Die Lehre von den drei Trieben ähnelte zu sehr den tatsächlichen Klassenverhältnissen – die Arbeit den einen, das Denken den andern; dazwischen, spielend überlegen, der Artist. Zweck der Arbeit und wahrer Reichtum war ihm vielmehr „die Muße, die Allen nach vollbrachter Arbeit bleibt“, denn „in dieser Ruhe Eures Körpers werdet Ihr, so Gott will, durch Langeweile genötigt werden, an Euern Geist zu denken, zu bemerken, daß ihr einen habt“, heißt es noch in seinen letzten Vorlesungen.[52] So unterscheidet sich der Sozialrevolutionär vom Höfling. Schiller hat seinen Aufsatz in den Horen nicht gebracht, Fichte mußte ihn Jahre später im Philosophischen Journal selbst veröffentlichen.[53]
Ein philosophischer Unterschied war auch da. Fichte hatte die wie in erratischen Brocken verstreut daliegende Kant’sche Kritik in der Wissenschaftslehre radikalisiert und zu einem System gebildet. Die Lehre von den Vermögen war eine Halbheit. „Alle besonderen Triebe und Kräfte im Menschen sind lediglich besondere Anwendungen der einzigen unteilbaren Grundkraft im Menschen“ – die indes nicht als eine bio- oder psychologische Tatsache vor uns liegt: Wahrnehmbar ist immer nur ihre jeweilige Wirkung, und „von dieser schließen wir auf die Ursache im selbsttätigen Subjekt zurück, und lediglich auf diese Weise gelangen wir zur Idee vom Dasein jenes Triebes“ – er wird nicht ‚erkannt’, sondern erschlossen.[54]
„Der Strenge nach ist aller Trieb praktisch, da er zur Selbsttätigkeit treibt, und in diesem Sinne gründet alles im Menschen sich auf den praktischen Trieb, da nichts in ihm ist, außer durch Selbsttätigkeit.“[55] Solange freilich die Notdurft den Menschen an sein Bedürfnis fesselt, zielt der Trieb nur auf die ‚brauchbaren Beschaffenheiten’ der Dinge, und macht bloß Erfahrung. „Sowie jene dringende Not gehoben ist und nichts mehr uns treibt, den möglichen Geisteserwerb gierig zusammenzuraffen, um ihn sogleich wieder für den notwendigen Gebrauch ausgeben zu können, erwacht der Trieb nach Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Wir fangen an, unser geistiges Auge auf den Gegenständen hingleiten zu lassen, und erlauben ihm, dabei zu verweilen; wir betrachten sie von mehreren Seiten, ohne gerade auf einen möglichen Gebrauch derselben zu rechnen; wir wagen die Gefahr einer zweifelhaften Voraussetzung, um in Ruhe den richtigen Aufschluß abzuwarten. Wir wagen es, etwas anzulegen an Versuche, die uns mißlingen können. Es entsteht Liberalität der Gesinnung – die erste Stufe der Humanität. Unter dieser ruhigen und absichtslosen Betrachtung der Gegenstände, indes unser Geist sicher ist und nicht über sich wacht, entwickelt sich ohne alles unser Zutun unser ästhetischer Sinn“ – zunächst noch am Leitfaden der Wirklichkeit. Doch schließlich „erhebt sich denn bald die dadurch zum Geist der Freiheit erzogene Einbildungskraft zur völligen Freiheit. Einmal im Gebiet des ästhetischen Triebes angelangt, bleibt sie in demselben, und stellt Gestalten dar, wie sie gar nicht sind, aber nach der Forderung jenes Triebes sein sollten: und dieses freie Schöpfungsvermögen heißt Geist. Der Geschmack beurteilt das Gegebene, der Geist erschafft. Nur der Sinn für das Ästhetische ist es, der in unserem Innern uns den ersten festen Standpunkt gibt.“[56]
Den Seins-Urteilen des theoretischen Vermögens gehen die Sollens-Urteile des praktischen Vermögens voran. Dem zu Grunde liegt die Urteilskraft – als das Vermögen der qualifizierenden Anschauung. Sie ist schlechthin produktiv: ihren Stoff und ihre Form gibt sie sich selbst; sie ist einbildend. Alles, was wir vorfinden, begegnet uns als Etwas oder als etwas Anderes. Daß es ist, haben wir nicht bestimmt, aber was es ist; und anders ‚gibt es’ gar nichts.
 „Die
Einbildungskraft setzt überhaupt keine feste Grenze; denn sie hat
selbst keinen festen Standpunkt. Nur die Vernunft setzt etwas Festes –
dadurch, daß sie erst selbst die Einbildungskraft fixiert.
Die Einbildungskraft ist ein Vermögen, das zwischen Bestimmung und
Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem und Unendlichem in der Mitte
schwebt.“ Was der reflektierende Verstand als seine Gegenstände
vorfindet, ist ihr Produkt: „Sie bringt dasselbe gleichsam während ihres
Schwebens und durch dieses Schweben hervor.“ Ohne sie gäbe es für uns
keine Wirklichkeit, zu der wir uns verhalten könnten, und insofern ist
die Wirklichkeit nicht ‚gegeben’, sondern gemacht. „Im praktischen Felde
geht die Einbildungskraft fort ins Unendliche, bis zu der schlechthin
unbestimmbaren Idee der höchsten Einheit, die nur nach der vollendeten
Unendlichkeit möglich wäre, welche selbst unmöglich ist.“ Nach ihrer
äußeren Grenze hin ist die Wirklichkeit daher problematisch. Doch auch
von ihrem Grunde her. Die produktive Einbildungskraft ist nichts anderes
als die Ichheit selbst, und auch die ist nicht ‚gegeben’, sondern
lediglich aus ihren Taten erschlossen: Weil wir wirklich anschauen,
müssen wir denken, daß wir es konnten; daß ein Vermögen da war vor der
Tat. Aber das ist ein „durch die Spontaneität des Reflexionsvermögens
künstlich hervorgebrachtes Faktum“. ‚Wirklich’ ist das Einbilden; das
vorauszusetzende ‚Subjekt’ ist ihm nachträglich hinzugedacht. „Das
Vorausgesetzte läßt sich nur durch das Gefundne, und das Gefundne läßt
sich nur durch das Vorausgesetzte erklären.“[57] Das Ich ist keine vorfindliche Substanz; es ‚ist’ überhaupt nur, sofern es einbildet.
„Die
Einbildungskraft setzt überhaupt keine feste Grenze; denn sie hat
selbst keinen festen Standpunkt. Nur die Vernunft setzt etwas Festes –
dadurch, daß sie erst selbst die Einbildungskraft fixiert.
Die Einbildungskraft ist ein Vermögen, das zwischen Bestimmung und
Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem und Unendlichem in der Mitte
schwebt.“ Was der reflektierende Verstand als seine Gegenstände
vorfindet, ist ihr Produkt: „Sie bringt dasselbe gleichsam während ihres
Schwebens und durch dieses Schweben hervor.“ Ohne sie gäbe es für uns
keine Wirklichkeit, zu der wir uns verhalten könnten, und insofern ist
die Wirklichkeit nicht ‚gegeben’, sondern gemacht. „Im praktischen Felde
geht die Einbildungskraft fort ins Unendliche, bis zu der schlechthin
unbestimmbaren Idee der höchsten Einheit, die nur nach der vollendeten
Unendlichkeit möglich wäre, welche selbst unmöglich ist.“ Nach ihrer
äußeren Grenze hin ist die Wirklichkeit daher problematisch. Doch auch
von ihrem Grunde her. Die produktive Einbildungskraft ist nichts anderes
als die Ichheit selbst, und auch die ist nicht ‚gegeben’, sondern
lediglich aus ihren Taten erschlossen: Weil wir wirklich anschauen,
müssen wir denken, daß wir es konnten; daß ein Vermögen da war vor der
Tat. Aber das ist ein „durch die Spontaneität des Reflexionsvermögens
künstlich hervorgebrachtes Faktum“. ‚Wirklich’ ist das Einbilden; das
vorauszusetzende ‚Subjekt’ ist ihm nachträglich hinzugedacht. „Das
Vorausgesetzte läßt sich nur durch das Gefundne, und das Gefundne läßt
sich nur durch das Vorausgesetzte erklären.“[57] Das Ich ist keine vorfindliche Substanz; es ‚ist’ überhaupt nur, sofern es einbildet.Indes, das alles ist nur Philosophie. Fürs Leben bedeutet es fast gar nichts. Doch gibt es eine Stelle, wo die Philosophie „übergeht“ ins wirkliche Leben, und das ist „die Ästhetik“. Aus dem gewöhnlichen Gesichtspunkt sowohl des Lebens als auch der reellen Wissenschaft erscheint die Welt als gegeben, dem philosophischen Gesichtspunkt erscheint sie als gemacht; „auf dem ästhetischen erscheint die Welt als gegeben, so als ob wir sie gemacht hätten und wie wir sie machen würden.“[58] Und zwar ist das die Stelle, wo sich die schöne Kunst befindet: Diese „bildet nicht, wie der Gelehrte, nur den Verstand, oder wie der moralische Volkslehrer, nur das Herz; sondern sie bildet den ganzen vereinigten Menschen. Das, woran sie sich wendet, ist nicht der Verstand, noch ist es das Herz, sondern es ist das ganze Gemüt. Sie macht den transzendentalen Gesichtspunkt zu dem gemeinen.“[59] Und wer wäre empfänglicher dafür als „unsere eigenen Kinder“, indem ihnen „von Natur ein leichter Sinn beiwohnt für das Zeitliche“! [60] So soll man es auffassen, daß die Philosophie vollendet, nämlich pädagogisch wird.
Dies sei „eine radikale Künstlerphilosophie“, wurde gesagt. „Und die Romantiker verstanden sie und machten Fichte zu ihrem Propheten.“[61] Die Brüder Schlegel waren in seinen Vorlesungen, auch Novalis und Brentano. Und Hölderlin. „Ich bin überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, indem sie alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist, und daß Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind“, heißt es im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. „Ehe wir die Ideen ästhetisch, d. h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse, und umgekehrt: ehe die Mythologie vernünftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen.“[62]
Herbarts Geschmack
Der sittliche Geschmack ist nicht verschieden von
dem poetischen, musikalischen, plastischen Geschmack.
Joh. Fr. Herbart
dem poetischen, musikalischen, plastischen Geschmack.
Joh. Fr. Herbart
Wie weit er den Begriff des Ästhetischen fasse, könne Schiller sich nicht einmal vorstellen, schrieb Fichte [63];
der Atheismusstreit hat ihn dann vom Wege abgebracht. Kant hatte die
Urteilskraft noch zu einem verschämten philosophischen Gottesbeweis
benutzt. Wir müßten so urteilen, als ob „in der Natur gar nichts ohne
Zweck sei. Allein, den Endzweck der Natur suchen wir in ihr vergeblich.“
Als dessen Gewährsmann dient ihm Gott: „Folglich müssen wir eine
moralische Weltursache (einen Welturheber) annehmen, um uns einen
Endzweck vorzusetzen.“[64]
Fichte hatte für diesen gewundenen „Schluß vom Begründeten auf den
Grund“, auf „ein besonderes Wesen als die Ursache desselben“, nur Spott
übrig: „Die moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir
annehmen! Es wird konstruiert durch das Rechttun. Jene lebendige und
wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines anderen
Gottes und können keinen andern fassen.“[65] Eine Moral, die auf einen Garanten für ihren Erfolg rechnet, ist keine
Mit dem Verzicht auf einen ‚Schöpfer’ ist freilich der Rangunterschied zwischen Ethik und Ästhetik eingeebnet. Unsere Neigung, moralischen Urteilen einen logisch höheren Wert zuzuschreiben als ästhetischen, beruht auf einer heimlichen theologischen Prämisse: daß nämlich diese den Absichten unseres Schöpfers gewissermaßen ‚näher stehen’ als jene. Fällt diese Prämisse fort, unterscheiden sie sich nur noch hinsichtlich ihres Anwendungsfelds; denn autonome Werturteile sind sie beide.
Johann Friedrich Herbart hat diesen Schluß ausdrücklich gezogen. In unserem Vorstellen kommen Bestimmungen vor, bei denen „das Denken nicht bei bloßer Verdeutlichung still stehen kann“, sondern vielmehr „einen Zusatz herbeiführt, der in dem Urteile des Beifallens oder Mißfallens besteht“: Das gilt für Ethik und Ästhetik gleichermaßen; indem sie gemeinsam auf „Wertbestimmungen durch Lob und Tadel beruhen“, fallen sie „in eine Hauptklasse zusammen“. Dabei umfaßt der Begriff der Ästhetik den weiteren Geltungsbereich, er bezieht sich auf alle denkbaren Verhältnisse; die Ethik dagegen nur auf „gefallende und mißfallenden Willensverhältnisse“. Ästhetik und praktische Philosophie verhalten sich so zu einander, „daß jene die weitere, diese die engere Sphäre sei“.[66]
 Das spezifisch ästhetische Vermögen ist der Geschmack. „Nicht in der Masse, sondern in den Verhältnissen liegt der ästhetische Wert.“[67]
Ge-schmack ist „nichts anderes als der allgemeine Name für die
Beurteilung einzelner Verhältnisse“. Das spezifisch moralische Vermögen
ist folglich sittlicher Geschmack. „Der sittliche Geschmack, als
Geschmack überhaupt, ist nicht verschieden von dem poetischen,
musikalischen, plastischen Geschmack. Aber spezifisch verschieden ist
der Gegenstand“: Was zu beurteilen ist, liegt „hier außer uns, dort in
uns selber“.[68]
Das Gute ist das „sittlich Schöne“, doch spricht der Geschmack jeweils
nur im einzelnen Fall, „in lauter absoluten Urteilen, ganz ohne Beweis.
Für verschiedene Gegenstände gibt es ebensoviele ursprüngliche Urteile,
die sich nicht aufeinander berufen, um logisch auseinander abgeleitet zu
werden.“[69] Sittliche Bildung ist Geschmacksbildung – und umgekehrt.
Das spezifisch ästhetische Vermögen ist der Geschmack. „Nicht in der Masse, sondern in den Verhältnissen liegt der ästhetische Wert.“[67]
Ge-schmack ist „nichts anderes als der allgemeine Name für die
Beurteilung einzelner Verhältnisse“. Das spezifisch moralische Vermögen
ist folglich sittlicher Geschmack. „Der sittliche Geschmack, als
Geschmack überhaupt, ist nicht verschieden von dem poetischen,
musikalischen, plastischen Geschmack. Aber spezifisch verschieden ist
der Gegenstand“: Was zu beurteilen ist, liegt „hier außer uns, dort in
uns selber“.[68]
Das Gute ist das „sittlich Schöne“, doch spricht der Geschmack jeweils
nur im einzelnen Fall, „in lauter absoluten Urteilen, ganz ohne Beweis.
Für verschiedene Gegenstände gibt es ebensoviele ursprüngliche Urteile,
die sich nicht aufeinander berufen, um logisch auseinander abgeleitet zu
werden.“[69] Sittliche Bildung ist Geschmacksbildung – und umgekehrt.Allerdings – eine Einbildungskraft kommt bei Herbart nicht vor; überhaupt kein produktives Vermögen. „Die Vernunft vernimmt; und sie urteilt, nachdem sie vernahm.“[70] Das intellektive Vermögen des Menschen ist rein rezeptiv; Herbart hat mit der kritischen Philosophie gebrochen! Es heißt, Herbart sei ein realistischer Denker gewesen. Nur bedeutet das im philosophischen Gebrauch so etwa das Gegenteil wie in der Umgangssprache. Hier beziehen sich ‚Realismus’ und ‚Idealismus’ allein auf die Frage nach der Herkunft unserer Erkenntnis. Realistisch heißt jene Lehre, wonach der Erkenntnisvorgang in den Dingen selbst (lat. res) seinen Ausgang nimmt, indem sie ihre Qualitäten in unser Bewußtsein prägen. Zuerst hat Plato diese Lehre ausgesprochen. Seine Ideen waren ebenjene ‚Dinge’, die sich in unserm Geiste abbilden;[71] jeder ‚Realist’ ist immer auch irgendwie Platoniker. Idealistisch (von gr. ideîn, sehen) heißt dagegen die Auffassung, wonach das Erkennen in einem Akt des Erkennenden seinen Ursprung hat. Und ‚kritisch’ nannten Kant und Fichte ihren Idealismus, weil sie diesen Akt nicht spekulativ behaupten, sondern phänomenologisch ergründen wollten.[72]
Das Ding, in dem Herbarts Erkenntnis seinen Ausgang nimmt, nennt er ein Reale (Pl. die Realen).[73] Es ist eine geistige Größe, ein „metaphysischer Punkt“ wie Leibniz’ Monade, und hat mit der materiellen Welt aber auch gar nichts zu tun: „Diese Welt ist eine Scheinwelt. Sie gehorcht der Mathematik und lebt, wie diese, von Widersprüchen. Als ein wahres Reales kann Materie ebensowenig gedacht werden, wie Bewegung als ein wirkliches Geschehen; aber die Gesetzmäßigkeit des Scheins aus dem Realen zu erklären, das läßt sich leisten.“[74] Das erinnert stark an Platos Höhlengleichnis[75] und begründet die Kehrtwendung zur Leibniz’schen Spekulation – auf höherer Ebene. Doch während Plato uns an den Ideen immerhin ‚teilhaben’ ließ, bleiben uns Herbarts Realen so unzugänglich wie Kants Ding-an-sich.[76] Er müsse wohl den transzendentalen Gedanken nie ganz verstanden haben, mutmaßte Fichte.[77]
Tatsächlich hat er ihn für eine Art Skeptizismus höherer Ordnung gehalten, durch den ein tüchtiger Kopf wohl hindurch gehen, wo er aber nicht stehen bleiben mußte.[78] Des Reflektierens müde, kehrte auch Herbart ‚hinter Sokrates zurück’. Doch nicht (um, wie Nietzsche, die Metaphysik zu begraben) zum bodenlosewigen Werden des Heraklit, sondern (um die Metaphysik zu restaurieren) zum festen Halt am ewigen Sein der Eleaten;[79] mit trocknem Witz vorgetragen, aber blutig ernst gemeint.
Auf
seinen Schöpfer verzichtet das neubarocke System nicht: „Gott, das
reelle Zentrum aller praktischen Ideen und ihrer schrankenlosen
Wirksamkeit, der Vater der Menschen und das Haupt der Welt“.[80]
Nicht als vorgestellter Zeuge allgemeiner Zweckmäßigkeit ohne Zweck,
sondern als wirkende Kraft, deren „unfehlbarer Erfolg“ im Gemüt der
leibhaftigen Menschen „ebenso notwendig“ ist wie die ursächlichen
Wirkungen „in der Körperwelt“![81]
 Wirksam
wurde Herbart nicht als Philosoph, sondern als Begründer der
wissenschaftlichen Psychologie und der wissenschaftlichen Pädagogik.
Aber leider hing eins am andern, und das hat die Sache verdorben. Am
wirksamsten wurde seine Pädagogik durch das Falscheste daran. Das war
die Scheidung in einen ‚praktischen’ Teil – der den Zweck darstellt:
„die ästhetische Auffassung der umgebenden Welt“[82] – und einen davon unabhängigen theoretischen Teil, der die Methode
begründet – seine rationalistische Psychologie: „Psychologische
Pädagogik ist rein theoretisch. Sie macht jedes schlechte Verfahren und
sein Wirken ebenso begreiflich als das rechte. So ist sie jedem brauchbar. Er mag nun seine Zwecke bestimmen, wie er immer will.“[83]
Herbart hat die englische Assoziations- psychologie in Deutschland
eingeführt, allerdings mit einem charakteristischen Zusatz. Er hat sie
dynamisch gemacht – aber vor allem mechanisch, das heißt
mathematisierbar. „Das Merken beruht auf der Kraft einer Vorstellung
gegen die andern, welche ihr weichen sollen, also teils auf ihrer
absoluten Stärke, teils auf der Leichtigkeit des Zurückweichens der
übrigen.“[84]
Vorstellungen gelten ihm als ‚Massen’, die einander verdrängen oder an
einander anknüpfen können, als hätten sie ‚Haken und Ösen’. Das
Verdrängen und Verknüpfen der Vorstellungen steuern – das wäre die
technische Seite der pädagogischen Arbeit.[85]
Wirksam
wurde Herbart nicht als Philosoph, sondern als Begründer der
wissenschaftlichen Psychologie und der wissenschaftlichen Pädagogik.
Aber leider hing eins am andern, und das hat die Sache verdorben. Am
wirksamsten wurde seine Pädagogik durch das Falscheste daran. Das war
die Scheidung in einen ‚praktischen’ Teil – der den Zweck darstellt:
„die ästhetische Auffassung der umgebenden Welt“[82] – und einen davon unabhängigen theoretischen Teil, der die Methode
begründet – seine rationalistische Psychologie: „Psychologische
Pädagogik ist rein theoretisch. Sie macht jedes schlechte Verfahren und
sein Wirken ebenso begreiflich als das rechte. So ist sie jedem brauchbar. Er mag nun seine Zwecke bestimmen, wie er immer will.“[83]
Herbart hat die englische Assoziations- psychologie in Deutschland
eingeführt, allerdings mit einem charakteristischen Zusatz. Er hat sie
dynamisch gemacht – aber vor allem mechanisch, das heißt
mathematisierbar. „Das Merken beruht auf der Kraft einer Vorstellung
gegen die andern, welche ihr weichen sollen, also teils auf ihrer
absoluten Stärke, teils auf der Leichtigkeit des Zurückweichens der
übrigen.“[84]
Vorstellungen gelten ihm als ‚Massen’, die einander verdrängen oder an
einander anknüpfen können, als hätten sie ‚Haken und Ösen’. Das
Verdrängen und Verknüpfen der Vorstellungen steuern – das wäre die
technische Seite der pädagogischen Arbeit.[85]Herbart blieb stets ein Gegner der Institution Schule, sein Ideal war der im familiären Alltag ästhetisierend wirksame Hauslehrer. Solche Feinheiten bekümmerten die Herbartianer nicht mehr.[86] Der Zweck der Pädagogik stand fest; Moralität, was sonst? Und die Methode mußte ja, wenn sie wissenschaftlich war, überall dieselbe sein! Mit ihrer Pedantisierung des Wie, der technischen Seite der Pädagogik – ohne Rücksicht auf das Was als ihrem Sinn – begründeten sie die Lernschule in Deutschland, wie wir sie bis heute kennen. Dem Standesbedürfnis der Lehrer war das recht. Das wissenschaftliche Interesse an der Pädagogik hat entweder philosophische oder beschäftigungspolitische Gründe; und wo nicht die philosophischen vorwalten, tun’s die andern. Denen verdanken wir die Technologisierung der Pädagogik zur ‚Methode’ und die leviathanische Erfassung des Heranwachsens durch die Staatsorgane ebenso wie das akademische Bastardfach ‚Erziehungswissenschaft’ als ihr Feigenblatt; und unsern Platz auf der Pisa-Skala sowieso.
Noch eine jede pädagogische Reformbewegung mußte damit beginnen, die Frage nach dem Was der Erziehung, als ihrem Rechtsgrund, neu aufzuwerfen. Geschmacksbildung – das ist das Was der Pädagogik, die ästhetische Darstellung der Welt ist ihr Wie: Herbarts elementare Einsicht freizulegen unterm technokratischen Gestrüpp, das aus seiner radikal verfehlten Metaphysik wuchert – das ist die Aufgabe des fälligen pädagogischen Neuanfangs. Die ästhetische Auffassung der Pädagogik läßt sich allein kritisch begründen; allerdings auch nur sie.
Zuerst erschienen in PÄD Forum: unterrichten erziehen, Heft 5/31 (Oktober 2003)
[1] J. F. Herder, Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, (1784-91) Darmstadt 1966
2] J.J. Rousseau, Émile ou De l’éducation (Amsterdam 1762); dt. Emil oder Über die Erziehung, Paderborn 1971
[3] ebd, S. 72f.
[4] Herder aaO, S. 228; 227
[5] neben Johann Georg Hamann und Friedrich Heinrich Jacobi
[6] s. hierzu J. Ebmeier, Die Grenzen der pädagogischen Vernunft in PÄD Forum: unterrichten erziehen, Heft 3/03, S. 173f.
[7] Benedictus (Baruch) de Spinoza, holländischer Philosoph und Optiker; 1632-1677
[8] Die sich-selber-zur-Welt-ausdehnende denkende Substanz ist niemand anders als ‚Gott’, deus sive natura, und „die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dasselbe (idem est) wie die Ordnung undVerknüpfung der Dinge“; in: Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, (dt./lat.): Die Ethik, Stgt. 1977 (Reclam), II. Teil, 7. Lehrsatz; S. 122f.
[9] Gottfried Wilhelm Leibniz, dt. Philosoph und Mathematiker; 1646-1716 [10] Leibniz, Neues System der Natur in: ders., Fünf Schriften zur Logik und Metaphysik, Stgt. 1966 (Reclam), S. 23
[11] ebd, S. 42
[12] von gr. monás: Einheit
[13] Leibniz aaO, S. 33
[14]
1679 bis 1754; 1740 von Friedrich d. Gr. auf seinen Lehrstuhl in Halle
zurückberufen, von dem ihn 1723 die Pietisten vertrieben hatten.
[15] s. Ernst Cassirer, Kant und Rousseau in: ders., Rousseau, Kant, Goethe, Hbg. 1991 (PhB)
[16]
die so ‚eigen’ allerdings nicht waren; er folgte dabei den Lehrbüchern
anderer Autoren. Sie dürften auch vor dem Erscheinen der Kritiken
entstanden sein.
[17] Immanuel Kant, Über Pädagogik, Werke (Hg. Weischedel), Bd. XII, S. 699
[18] Hr. Ritter: Kritik der Pädagogik zum Beweis der Notwendigkeit einer allge-meinen Erziehungswissenschaft
in: Philosophisches Journal, Bd. VIII., 2. Heft (Jena 1798); bei dem
Verf. handelt es sich wohl nicht um Johann Wilhelm R., der sich damals
in Jena aufhielt und dem Kreis um Fichte und die Romantiker angehörte. –
Der Heraus-geber Niethammer selbst wurde mit dem Pamphlet Der Streit des Philanthropinismus und der Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts
(1808; neu: Wein-heim 1968) zum Begründer des sog. Neuhumanismus, der
dann das deutsche Gymna-sium beherrschte; da hatte er sich von der
kritischen Philosophie schon abgewandt.
[19] Rückerinnerungen, Antworten, Fragen (März 1799) in: J. G. Fichte, Gesamt-ausgabe, II. Abt. (Nachlaß) Bd. 5; Stuttgart 1979, S. 125
[20] ebd . S. 118; 122f.
[21] J. G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre in: Philosophisches Journal, Bd. VI (1797); neu: Sämtliche Werke Bd. I, Berlin 1971, S. 507
[22] dt. Philosoph und Psychologe, 1776-1842
[23] (1803) Herbart, Sämtliche Werke (Hg. Hartenstein) Bd. 11, Hbg./Lpzg. 1892
[24] ders., Allgemeine Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet (1806) in: aaO, Bd. 10, 1891; neu u. a.: (Hg. Holstein) Bochum 61983
[25] Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäftder Erzie-hung ,
[26]
Die Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung gibt es nur im
Deutschen; sie stammt, nicht dem Wort, aber dem Sinn nach, von Fr. I.
Niethammer (s. Anm. 18)
[27] Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica, 2 Bde. Ffm 1750/58
[28] gr. aísthesis, Sinneswahrnehmung
[29] Kritik der Urteilskraft in: Kant, Werke (Hg. Weischedel) Bd. 6, Ffm. 1968
[30] ebd, S. 87
[31] ebd, S. 155
[32] ebd, S. 89. – Heute kommt uns die Natur eher als ein Reich der Vergeudung vor, wo auf 1000 Versuche kaum 1 Treffer gelingt.
[33] ebd, S. 249f.
[34] ebd, S. 250
[35] ebd, S. 297
[36] (1764) in: aaO, Bd. 2, S. 823-884
[37]
Anthony Ashley-Cooper, Earl of Shaftesbury (1671-1713); trug seine
Philosophie in dichterischer Form vor; wurde von Francis Hutcheson
(1694-1746) systematisiert: An den knüpft Kant an.
[38] Über die ästhetische Erziehung des Menschen. In einer Reihe von Briefen, zuerst erschienen in Schillers Zs. Horen; hier zit. nach: Fr. Schiller, Ausgewählte Werke Bd. 6, Stuttgart 1950 (Cotta)
[39] ebd, S. 250
[40] ebd, S. 252f.
[41] ebd., S. 257
[42] ebd, S. 259
[43] ebd, S. 259-261 (7. Brief)
[44] ebd, S. 263
[45] ebd, S. 285
[46] ebd, S. 287
[47] ebd, S. 290f.
[48] FichtesGrundlagen der gesamten Wissenschaftslehre erschienen seit dem Früh-jahr 1794 bogenweise als Handschrift für seine Zuhörer. Neu: Hamburg 1979 (PhB); auch in: Fichte, Sämtliche Werke Bd. I, Berlin 1971. – Beide waren Professo-ren in Jena, Schiller für Geschichte, Fichte für Philosophie.
49] Schiller aaO, S. 305-310
[50] Die Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution® waren 1793 zwar anonym erschienen, aber Fichtes Verfasserschaft war ein offenes Geheimnis; in: ders., SW Bd. VI
[51] ders., Über Geist und Buchstab in der Philosophie; SW Bd. VIII, S. 286f.
[52] System der Rechtslehre (1812), SW Bd. X, S. 543; 537
[53] in Bd. IX (1798)
[54] Über Geist und Buchstab…, aaO, S. 278f.
[55] aaO, S. 279
[56] aaO, S. 288-291
[57] J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, (PhB) S. 136-139; 145
[58] ders., Wissenschaftslehre nova methodo, Hbg. 1982 (PhB), S. 244
59] ders., System der Sittenlehre, SW Bd. IV, S. 353
[60] ders., 2. Rede an die deutsche Nation, SW Bd. VII, S. 287
[61] Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, Bd. II; Mchn 1948; S. 501
62] hier zit. nach: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke,
Ffm. 1961; S. 1015f. Die Verfasserschaft des ‚Systemprogramms’ ist ein
echt romantisches Mysterium. Es ist in der Handschrift Hegels
überliefert, aber als Autor kommt nur einer in Frage, der unterm Einfluß
Fichtes und des Jenaers Kreises stand – also Hegels Zimmernachbarn
Schelling oder Hölderlin.
[63] Fichte an Schiller, 27. 7. 1795; in: Fichte, Briefe, Bln. (O) 1986, S. 154
64] Kant, Kritik der Urteilskraft; aaO, S. 417; 413
[65] Fichte, Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung (1798) in Philosophisches Journal Bd. VIII (1798); neu: SW Bd. V, S. 186; 185
[66] ders., Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (1813); Hamburg 1993, S. 52; 50; 143; 53
[67] ders., Allgemeine Pädagogik…, hier zit. nach: (Hg. Holstein) Bochum 983, S. 103
[68] ders., Allgemeine praktische Philosophie (1808) in: SW Bd. 8, Hamburg 1890, S. 29; 23
[69] ders., Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung; hier zit. nach: Gerhard Müßener (Hg.), S. 108 [70] ebd, S. 107
[71] Phaidon IV, 72e-74a
[72]
Mit dem kritischen (‚transzendentalen’) Idealismus ist übrigens eine
andere als eine rein ‚materialistische’, streng auf Erfahrungstatsachen
gegründete Naturwissenschaft nicht vereinbar; geschweige denn eine
übersinnliche ‚Weltursache’.
[73] Herbart, Hauptpunkte der Metaphysik (1806), SW Bd. 3, 1884
[74] ders., Einleitung in die Philosophie, S. 330
[75] Politeia VII, 514a-518b
[76] Streng genommen handelt es sich also gar nicht mal um ‚Realismus’; vgl. W. Windelband/H. Heimsoeth, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1950, S. 488
[77] F. an Schelling am 22. 10. 1799; Briefe, S. 270
[78] Herbart, Einleitung…, S. 66-80
[79] gr. Philosophenschule im süditalienischen Elea, im 5. Jhdt. v. Chr.: Xenophanes, Parmenides, Zenon
[80] Herbart, Die ästhetische Darstellung…, S. 118
[81] ebd, S. 103
[82] ebd, S. 115
[83] ders., Aphorismen zur Pädagogik, SW Bd. 11, 1892; S. 430
[84] ders., Allgemeine Pädagogik, S. 89
[85]
H. hat diese technische Seite in einem Gebäude von mathematischen
Gleichungen formalisiert; gemäß dem über Leibniz von Descartes
übernommenen Wissenschafts-programm. Vgl. Lehrbuch zur Psychologie (1816); SW Bd. 5, 1886; S. 15-36
[86] an ihrer Spitze Tuiscon Ziller (1817-1882) und Wilhelm Rein (1847-1929)
oder Wie das Wissen über seinen Schatten springt
gekürzt aus: PÄD Forum, Heft 6/2003
gekürzt aus: PÄD Forum, Heft 6/2003
Wenn sich wer unterfängt, auf eigne Gefahr das pädagogische Problem in seiner Gänze darzustellen[1]
– neurobiologisch, anthropologisch, sozialhistorisch,
wissenschaftskritisch, ideengeschichtlich -, ist das nicht bescheiden.
Seit einer halben Ewigkeit gabs das nicht mehr.
 Weniger
wäre heute aber nicht genug. Ein Zyklus kommt zum Ende. Vor zweihundert
Jahren, als die Arbeitsgesellschaft sich zur großen Industrie
vollendete, erwuchs ein Stand erwerbsmäßiger Pädagogen, entstand
eine pädagogische Wissenschaft, wurde die Schule zur normierenden
gesellschaftlichen Instanz; begann, kurz gesagt, die technokratische
Verfaßtheit des Heranwachsens: Leviathan bei den Kleinen. Die
Arbeitsgesellschaft schwindet, doch Institutionen sind zäh – weil
materielle Vorteile daran hängen. In unserm Fall: die Verkümmerung der
Pädagogik zur ‚Methode’, die auch der erlernen kann, der nicht dazu
berufen ist – und trotzdem sein Auskommen findet. Indes, nur als
Vollendung der Philosophie läßt Pädagogik sich rechtfertigen. Und
rechtfertigen muß sie sich, sofern sie nämlich etwas Besonderes sein
will und öffentliche Geltung beansprucht.
Weniger
wäre heute aber nicht genug. Ein Zyklus kommt zum Ende. Vor zweihundert
Jahren, als die Arbeitsgesellschaft sich zur großen Industrie
vollendete, erwuchs ein Stand erwerbsmäßiger Pädagogen, entstand
eine pädagogische Wissenschaft, wurde die Schule zur normierenden
gesellschaftlichen Instanz; begann, kurz gesagt, die technokratische
Verfaßtheit des Heranwachsens: Leviathan bei den Kleinen. Die
Arbeitsgesellschaft schwindet, doch Institutionen sind zäh – weil
materielle Vorteile daran hängen. In unserm Fall: die Verkümmerung der
Pädagogik zur ‚Methode’, die auch der erlernen kann, der nicht dazu
berufen ist – und trotzdem sein Auskommen findet. Indes, nur als
Vollendung der Philosophie läßt Pädagogik sich rechtfertigen. Und
rechtfertigen muß sie sich, sofern sie nämlich etwas Besonderes sein
will und öffentliche Geltung beansprucht.
Das Wertesystem des Industriezeitalters verfällt. Ein Neuaufbau ist fällig. „Alle, auch die bekanntesten Erscheinungen erhalten innerhalb der Renaissancen einen neuen Fraglichkeitscharakter“[2]. Die erste Etappe einer jeden Renaissance ist Ratlosigkeit: Die hatten wir schon.[3] Die zweite ist der Rückblick auf die Ursprünge.
 Weniger
wäre heute aber nicht genug. Ein Zyklus kommt zum Ende. Vor zweihundert
Jahren, als die Arbeitsgesellschaft sich zur großen Industrie
vollendete, erwuchs ein Stand erwerbsmäßiger Pädagogen, entstand
eine pädagogische Wissenschaft, wurde die Schule zur normierenden
gesellschaftlichen Instanz; begann, kurz gesagt, die technokratische
Verfaßtheit des Heranwachsens: Leviathan bei den Kleinen. Die
Arbeitsgesellschaft schwindet, doch Institutionen sind zäh – weil
materielle Vorteile daran hängen. In unserm Fall: die Verkümmerung der
Pädagogik zur ‚Methode’, die auch der erlernen kann, der nicht dazu
berufen ist – und trotzdem sein Auskommen findet. Indes, nur als
Vollendung der Philosophie läßt Pädagogik sich rechtfertigen. Und
rechtfertigen muß sie sich, sofern sie nämlich etwas Besonderes sein
will und öffentliche Geltung beansprucht.
Weniger
wäre heute aber nicht genug. Ein Zyklus kommt zum Ende. Vor zweihundert
Jahren, als die Arbeitsgesellschaft sich zur großen Industrie
vollendete, erwuchs ein Stand erwerbsmäßiger Pädagogen, entstand
eine pädagogische Wissenschaft, wurde die Schule zur normierenden
gesellschaftlichen Instanz; begann, kurz gesagt, die technokratische
Verfaßtheit des Heranwachsens: Leviathan bei den Kleinen. Die
Arbeitsgesellschaft schwindet, doch Institutionen sind zäh – weil
materielle Vorteile daran hängen. In unserm Fall: die Verkümmerung der
Pädagogik zur ‚Methode’, die auch der erlernen kann, der nicht dazu
berufen ist – und trotzdem sein Auskommen findet. Indes, nur als
Vollendung der Philosophie läßt Pädagogik sich rechtfertigen. Und
rechtfertigen muß sie sich, sofern sie nämlich etwas Besonderes sein
will und öffentliche Geltung beansprucht.Das Wertesystem des Industriezeitalters verfällt. Ein Neuaufbau ist fällig. „Alle, auch die bekanntesten Erscheinungen erhalten innerhalb der Renaissancen einen neuen Fraglichkeitscharakter“[2]. Die erste Etappe einer jeden Renaissance ist Ratlosigkeit: Die hatten wir schon.[3] Die zweite ist der Rückblick auf die Ursprünge.
Was ist Wahrheit?
Die Sonne ist neu an jedem Tag.
Heraklit, fr. 6
Heraklit, fr. 6
Ist oder ist nicht.
Parmenides, fr. 8
Parmenides, fr. 8
Ursprung und Angelpunkt des abendländischen Denkens war die Frage nach dem Wahren. In der Sinnenwelt ist alles Trug. Sie scheint mal so, mal so, je nach Standort. Alles, was wird, wird vergehen. Wahr ist, was währt, das ewige Sein; doch es liegt unterm Werden verhüllt. Nur dem Denken ist es kenntlich, „denn dasselbe ist Denken und Sein“, sagt Parmenides.[4] Die Frage nach dem wahren Sein ist die Frage, wonach sich mein Leben in der Mannigfaltigkeit trügerischer Erscheinungen richten soll. Man erkennt es beim Vergleich mit Heraklit, gegen den Parmenides angetreten war: Nicht zweimal könne man in einen Fluß steigen;[5] der Fluß sei ein anderer geworden und der Mensch auch. Hinter dem Werden ist Nichts, wahr ist der Schein: Das möchte man einen heroischen Nihilismus nennen; ein aristokratisches Leben auf eigne Faust, das sich nicht jeder leisten kann. Die Vermutung, daß der Sinn der Welt zwar verborgen, aber jedenfalls in ihr liegt, macht dagegen auch kleinen Leuten Mut. Nicht anders konnte die Arbeitsgesellschaft siegen, nicht anders konnte Europa die Welt erobern.
 Die Erkenntnis, daß nach dem Sinn gefragt werden muß, war die Geburtsstunde des Abendlands.
Der ebenbürtige Zeitgenosse von Heraklit und Parmenides war Aischylos –
der als erster die Schuld der Menschen zum Thema gemacht hat; nämlich
daß sie ihre Wege selber wählen. Es wurde zum Thema der westlichen
Kultur. Man mag auch meinen, es sei die Conditio humana selbst. Nur
wurde sie nicht überall ihrer bewußt.
Die Erkenntnis, daß nach dem Sinn gefragt werden muß, war die Geburtsstunde des Abendlands.
Der ebenbürtige Zeitgenosse von Heraklit und Parmenides war Aischylos –
der als erster die Schuld der Menschen zum Thema gemacht hat; nämlich
daß sie ihre Wege selber wählen. Es wurde zum Thema der westlichen
Kultur. Man mag auch meinen, es sei die Conditio humana selbst. Nur
wurde sie nicht überall ihrer bewußt.Das Wahre, das Ansich-Seiende, das Absolute; Wert, Bedeutung, Geltung, Sinn – das alles sind verschiedene Worte für ein Problem. Nämlich dies, daß der Mensch sich nicht mit dem Leben begnügen kann, sondern immer sein Leben führen muß. Führen wo hin, wo lang? Er muß sich orientieren. Das, woran er sich orientiert hat, um dessentwillen er gelebt hat, nennt er, rückblickend, ‚das Wahre’, ‚das Absolute’, den ‚Sinn’. Das Erkennen ist zirkulär. Warum? Es kommt a posteriori. Denn gesetzt wird der Sinn immer in actu, hier und jetzt, an jedem Wegkreuz neu. Dem (nachträglichen) Erkennen erscheint es darum als a priori. ‚Das Wahre’, ‚das Absolute’, der ‚Sinn’ ist – reell wie ideell – eben keine Sache, sondern ein Problem. Es ist aber keins, worauf die Menschen ebensogut verzichten könnten. Sie waren tätig, bevor sie erkennend wurden. Aber sie müssen erkennend sein, um selbsttätig zu werden.
Der savoyische Vikar
Die bestimmende Ursache liegt in ihm selbst.
J. J. Rousseau
J. J. Rousseau
„Kein materielles Wesen ist durch sich selbst tätig; ich aber bin es. Man kann es mir bestreiten: ich fühle es, und dieses Gefühl, das zu mir spricht, ist stärker als die Vernunft, die es bestreitet.“[6] Schlichte Worte, aber sie begründeten die Kopernikanische Wende der Vernunft: Das Herzstück von Jean-Jacques Rousseaus Émile bildet das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars. Dort hat Immanuel Kant sein ‚transzendentales Ich’ gefunden.[7]
Wenn es die Geistesgeschichte des Abendlands ausmacht, daß dort nach dem Sinn gefragt werden muß, konnte es nicht fehlen, daß schließlich die Freiheit zu ihrem Standardproblem wurde. Wer fragt, muß endlich antworten. Und sich verantworten: Warum so und nicht anders? „Welches ist also die Ursache, die seinen Willen bestimmt? Es ist seine Urteilskraft. Die bestimmende Ursache liegt in ihm selbst.“[8] Eins ist mit Sicherheit wahr: So wahr ich urteile, urteile ich. Das ist keine Hypothese, kein Postulat, kein Problem; sondern wenn überhaupt etwas gewiß ist, ist es das. Doch aus welchen Gründen ich urteile, ist ein ganz andre Frage.
Das paradoxale Thema der Transzendentalphilosophie ist dies: Immer, wenn ich ein Urteil fälle, das weiter reicht als bis zu meinem Vorteil („Erhaltungswert“) und wahr sein will, habe ich durchaus nicht den Eindruck, nach freier Willkür zu verfahren, sondern – ‚ich kann nicht anders’. Die Gründe sind zwingend, ein Gefühl des Genötigtseins tritt ein. Wo ist da Freiheit? (Denn wenn die Gründe nicht zwingend sind und mein Urteil unsicher bleibt – dann komme ich mir erst recht nicht frei vor.)
Die
Transzendentale Freiheit (gegen die Joh. Fr. Herbart so heftig zu Felde
zog) hat mit dem Belieben der empirischen Person, so oder anders zu
antworten, noch gar nichts zu tun. Sondern damit, daß ich überhaupt antworten muß, weil ich überhaupt fragen
muß. Und das Transzendentale Ich ist nicht das, was mich als Individuum
von den andern unterscheidet, sondern diejenige Qualität, die mich
überhaupt zum Subjekt macht – und die ich mit den andern teile.
Als transzendentales Ich bezeichnet Kant jene Instanz, die die mannigfaltigen sinnlichen Eindrücke aufeinander bezieht und zur ‚Erfahrung’ zusammenfaßt. Vom transzendentalen Ich wissen wir nur, weil dieser Akt des Zusammenfassens tatsächlich geschieht; weil und indem wir wirklich Erfahrungen machen: weil und insofern wir urteilen. Eine ‚Substanz’ des Ich – die ja nur die „Seele“ der Theologen sein könnte – schließt Kant dagegen aus der Wissenschaft ganz aus: weil sie jenseits möglicher Erfahrung liegt.
 Auch die Befunde der aktuellen Hirnforschung erlauben eine solche Hypothese nicht: Eine Kommandozentrale
im Gehirn, die die Synthesis der Einzeleindrücke besorgt (Homunculus),
läßt sich nicht ausmachen. ‚Ich’ ist vielmehr ein Funktionszusammenhang,
der sich immer wieder neu herstellen muß. Wir müßten uns „das Ich als
einen räumlich verteilten, sich selbst organisierenden Zustand denken“,
sagt der Neurophysiologe Wolf Singer.[9]
Auch die Befunde der aktuellen Hirnforschung erlauben eine solche Hypothese nicht: Eine Kommandozentrale
im Gehirn, die die Synthesis der Einzeleindrücke besorgt (Homunculus),
läßt sich nicht ausmachen. ‚Ich’ ist vielmehr ein Funktionszusammenhang,
der sich immer wieder neu herstellen muß. Wir müßten uns „das Ich als
einen räumlich verteilten, sich selbst organisierenden Zustand denken“,
sagt der Neurophysiologe Wolf Singer.[9]
Das transzendentale Ich als erkenntnislogisches Konstrukt und das Ich als Idee, als Bild, das mir als meine Bestimmung vorschwebt, sind von der empirischen Person gleich weit entfernt. Sie bezeichnen beide etwas, das an der Ichheit notwendig, und nicht das, was daran zufällig ist. Mit der empirischen Person haben sie dies gemein: Sie teilen ihr einen Sinn mit; teils, wo sie herkommt, teils, wo sie hinsoll.
Die poietische Fiktion
Als transzendentales Ich bezeichnet Kant jene Instanz, die die mannigfaltigen sinnlichen Eindrücke aufeinander bezieht und zur ‚Erfahrung’ zusammenfaßt. Vom transzendentalen Ich wissen wir nur, weil dieser Akt des Zusammenfassens tatsächlich geschieht; weil und indem wir wirklich Erfahrungen machen: weil und insofern wir urteilen. Eine ‚Substanz’ des Ich – die ja nur die „Seele“ der Theologen sein könnte – schließt Kant dagegen aus der Wissenschaft ganz aus: weil sie jenseits möglicher Erfahrung liegt.
 Auch die Befunde der aktuellen Hirnforschung erlauben eine solche Hypothese nicht: Eine Kommandozentrale
im Gehirn, die die Synthesis der Einzeleindrücke besorgt (Homunculus),
läßt sich nicht ausmachen. ‚Ich’ ist vielmehr ein Funktionszusammenhang,
der sich immer wieder neu herstellen muß. Wir müßten uns „das Ich als
einen räumlich verteilten, sich selbst organisierenden Zustand denken“,
sagt der Neurophysiologe Wolf Singer.[9]
Auch die Befunde der aktuellen Hirnforschung erlauben eine solche Hypothese nicht: Eine Kommandozentrale
im Gehirn, die die Synthesis der Einzeleindrücke besorgt (Homunculus),
läßt sich nicht ausmachen. ‚Ich’ ist vielmehr ein Funktionszusammenhang,
der sich immer wieder neu herstellen muß. Wir müßten uns „das Ich als
einen räumlich verteilten, sich selbst organisierenden Zustand denken“,
sagt der Neurophysiologe Wolf Singer.[9]Das transzendentale Ich als erkenntnislogisches Konstrukt und das Ich als Idee, als Bild, das mir als meine Bestimmung vorschwebt, sind von der empirischen Person gleich weit entfernt. Sie bezeichnen beide etwas, das an der Ichheit notwendig, und nicht das, was daran zufällig ist. Mit der empirischen Person haben sie dies gemein: Sie teilen ihr einen Sinn mit; teils, wo sie herkommt, teils, wo sie hinsoll.
Die poietische Fiktion
Die Einbildungskraft geht fort
bis ins Unendliche, bis zur schlechthin unbestimmbaren
Idee der höchsten Einheit.
J. G. Fichte
Nur weil der Mensch ein Leben führt, dessen Sinn weit über seine bloße Erhaltung hinaus reicht (wenn er es will), hat er das Problem der Freiheit. Ob er es will, ist damit noch nicht entschieden. Wenn einer sagt: Die Befriedigung meiner Bedürfnisse ist mir genug – wie kann ich ihm widersprechen? Es gibt noch viele, die sich mehr gar nicht leisten können.
Aber eine Kultur, wo verknappter Luxus schon wie Not erscheint, lebt im Überfluß. Dieses ist eine Sinnbehauptung: Es sollte eine Welt des Reichtums entstehen, damit Menschen in die Lage kommen, ihre Freiheit bestimmen zu können. Nur darum gibt es die Frage nach der Wahrheit. Aber die ist ein Paradox.
Was
ich tun soll, ist eine Frage von Bedeutungen. Ist Sache eines Urteils.
Und dafür brauche ich Gründe, die gelten. Deren Geltung muß ihrerseits
begründet sein, und so fort. Machen wir’s kurz: Wenn überhaupt etwas
gelten soll, muß es irgendwo einen Grund geben, der schlechterdings gilt
und in letzter Instanz, ohne alle Bedingung – die Bedingungen von Ort
und Zeit zumal. In der Welt, die ‚der Fall ist’, wird man ihn nicht
antreffen. Er ist „nicht von dieser Welt“, ich muß ihn mir hinzu denken.
 Daß der menschliche Geist „notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muß und dennoch von der andern Seite anerkennen muß, daß dasselbe für ihn da
sei, ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem
er aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht
hat, und entflieht, sobald man es auffassen will.“[10]
Es „kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar
nicht vorgegeben wird, daß ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas
entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind
Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe
begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewußtsein vor.“[11]
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, daß es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
Daß der menschliche Geist „notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muß und dennoch von der andern Seite anerkennen muß, daß dasselbe für ihn da
sei, ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem
er aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht
hat, und entflieht, sobald man es auffassen will.“[10]
Es „kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar
nicht vorgegeben wird, daß ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas
entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind
Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe
begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewußtsein vor.“[11]
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, daß es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
 Daß der menschliche Geist „notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muß und dennoch von der andern Seite anerkennen muß, daß dasselbe für ihn da
sei, ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem
er aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht
hat, und entflieht, sobald man es auffassen will.“[10]
Es „kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar
nicht vorgegeben wird, daß ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas
entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind
Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe
begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewußtsein vor.“[11]
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, daß es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.
Daß der menschliche Geist „notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muß und dennoch von der andern Seite anerkennen muß, daß dasselbe für ihn da
sei, ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem
er aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht
hat, und entflieht, sobald man es auffassen will.“[10]
Es „kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von welchem gar
nicht vorgegeben wird, daß ihm in der wirklichen Welt außer uns etwas
entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden. Sie sind
Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die Aufgabe
begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewußtsein vor.“[11]
Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist
so gestellt, daß es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll
sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox. Das ist nicht bloß eine Idee. Das ist eine ästhetische Idee.[12] Es ist, recht besehen, die ästhetische Idee schlechthin, die in alle tatsächlich vorkommenden Bestimmungen nach Ort und Zeit vorgängig hineingreift, die all die Qualitäten vereint, die ich an den Dingen „wertnehme“, bevor ich sie wahrnehme, und von der ich erst durch eine besondere Anstrengung des reflektierenden Verstandes wieder abstrahieren kann.
Es „ist“ nichts so. Aber so muß ich es mir vorstellen, wenn ich mir überhaupt Etwas vorstellen will. Das Wissen kann seinen eignen Grund nicht erkennen. Es muß ihn sich ein-bilden. Der höchste Akt der Vernunft sei ein ästhetischer, hieß es im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus[13]. Ob er wirklich stattgefunden hat, ist nicht entscheidend. Es scheint uns so, als ob er stattgefunden hätte. Er ist so wahr wie ein Mythos sein kann. Will sagen, er muß sich bewähren.
Bewähren in Sonderheit in meinem täglichen Tun und Lassen – als Sittlichkeit. „Die Ethik ist transzendental“, schrieb Ludwig Wittgenstein, um gleich hinzu zu fügen: „Ethik und Ästhetik sind eins.“[14] Und es sei klar, daß sie sich als solche „nicht aussprechen“ lassen…
Geht alles?
Anything goes.
Die Frage nach dem „Grund“ – wie altertümlich! Die Dunkelmänner der Postmoderne wissen es längst: das Wahre ist nur ein Mythos, der falsche Schein, dem das Abendland verfallen war und all seine Perversionen schuldet – von der Inquisition über Auschwitz bis zum Gulag. Darüber ist der Zeitgeist längst hinweg, seine Schamanen psalmodieren das Ende der Ideologien, der Geschichte sogar, und als der Weltweisheit letzter Schrei erweist sich Cole Porters Hit aus den Dreißigern: „Anything goes!“
Wahr ist alles, was funktioniert – und solange, wie es funktioniert: Das war ein brauchbares regulatives Prinzip einer exakten Naturwissenschaft, die Forschung um ihrer technischen Verwertung willen trieb. Als Zweck der Wissenschaft definierte der Pragmatismus ausdrücklich: Vorhersagen machen. Das mochte einem Chemiker des 19. Jahrhunderts genügen – einem Astrophysiker und Kosmologen unserer Tage nicht! Es gibt keine Grundlagenforschung ohne die Frage nach Wahrheit.[15]
 Was
in der Naturwissenschaft bloß überholt ist, wird in den
Geisteswissenschaften, wo’s um die Sinnfragen geht, zur Mummenschanz.
Wahrheit = ein patchwork, Flickenteppich, Narrengewand: Hauptsache bunt!
Unter der Firma des ‚Konstruktivismus’ darf jeder sein Glück versuchen,
warum auch nicht, Wahrheiten kommen und gehen, nehmt’s doch nicht so
ernst! Statt der Philosophie haben wir Bindestrich-Philosophien. Und
statt Pädagogik nur Bindestrich-Pädagogiken. Ganz wichtig zwar, aber daß
es ihren Zöglingen nicht gelingt, sie ernst zu nehmen – wen wird es
wundern?
Was
in der Naturwissenschaft bloß überholt ist, wird in den
Geisteswissenschaften, wo’s um die Sinnfragen geht, zur Mummenschanz.
Wahrheit = ein patchwork, Flickenteppich, Narrengewand: Hauptsache bunt!
Unter der Firma des ‚Konstruktivismus’ darf jeder sein Glück versuchen,
warum auch nicht, Wahrheiten kommen und gehen, nehmt’s doch nicht so
ernst! Statt der Philosophie haben wir Bindestrich-Philosophien. Und
statt Pädagogik nur Bindestrich-Pädagogiken. Ganz wichtig zwar, aber daß
es ihren Zöglingen nicht gelingt, sie ernst zu nehmen – wen wird es
wundern?Alles fließt? Der Zeitgeist bestimmt. Er kommt aus den Hochglanz-Postillen, und da soll man ihn ruhig lassen. Ernster klingt der (scheinbar) entgegengesetzte Einwand: ‚Ein Erster Grund, den sich jeder selber setzt?! Das hieße der Beliebigkeit Tür und Tor öffnen!’ Wie bitte? Wenn sich einer ‚seinen’ Grund als ein Absolutes setzt – wird es dadurch zu einem Relativen? Muß ich Eines, um es als mein Absolutes setzen zu dürfen, zugleich als das Absolute der Andern erkennen können? Weil Eines, um mir absolut gelten zu können, von Andern als absolut anerkannt worden sein muß? Ich dürfte also immer nur das Absolute der Andern anerkennen!
Für das Ästhetische behauptet das keiner. Vom Sittlichen denken das Alle. Warum? Weil sie meinen, der Zusammenhalt des Gemeinwesens hinge davon ab. Sie verwechseln es mit dem Recht. Das freiheitlich-demokratische Gemeinwesen beruht – nicht in der Wirklichkeit, aber wir sehen es so an, als ob: Das macht seinen Sinn aus! – auf dem freien Vertrag autonomer Subjekte. Ein Absolutes, worüber sich zwei verständigen konnten, wird ipso facto ein Relatives: So ‘rum wird ein Schuh draus. Das Absolute ist weder konsensfähig noch konsensbedürftig.
Die Sittlichkeit sagt, was ich mir selber schulde, das Recht sagt, was ich andern schulde. Dieses ist meine Pflicht, jenes sind die Ansprüche der andern gegen mich. Über jene müssen – und können – wir uns verständigen, über diese nicht. Mein erster, letzter, absoluter Grund muß sich, als rechtes Handeln, in meinem Leben bewähren. Ich muß mich dann „in der Welt“ bewähren – per Verhandlung und Vertrag, wenn’s sein soll. Das ergäbe einen Nachtwächterstaat ohne Pathos und Würde? Sein Pathos und seine Würde ist, daß er die Freiheit einer jeden Person, sich zu ihrer eignen Pflicht zu bestimmen, zu seinem Rechtsgrund macht. Ist das wem zu wenig, soll er’s sagen.
Ach, Leviathans Kinderfänger, die Pädagogen! „Die Menschen brauchen Orientierung!“ Nein, gerade das brauchen sie nicht. Es muß sich ein jeder selber orientieren. „Die Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit ist das, was man Erziehung nennt.“[16] Sie aber meinen in Wahrheit: Die Menschen sollen sich von ihnen orientieren lassen – ausgerechnet! Gottlob meinen sie’s nicht ernst. Ein Absolutes käme ihnen, Zeitgeist behüte, gar nicht in den Sinn. Werte – ein „verbindlicher Werteunterricht“ tut’s auch.
Daß sie das Absolute zu Häppchen farcieren, macht die Sache zwar nicht besser, denn irgendwas, irgendwer (?) müßte deren Geltung doch verbürgen können. Ein „bißchen Wahrheit“ gibt’s so wenig wie ein bißchen… Unschuld. Doch ich hab eine Ahnung: Anything goes! Wahr ist, was funktioniert. Um den Ruf unserer Schulen ist es nicht gut bestellt. Daß sie junge Menschen bilden, glaubt kaum einer. Nun ein neuer Schibboleth, ein weiteres Gadget, noch ein Bindestrich: Werte-Pädagogik! Man kann einen Ausbildungsgang dafür einrichten, mit C4-Professur. Wenn’s funktioniert…
Man muß wetten
Gott wird, wo alle Kreaturen Gott aussprechen.
Meister Eckhart
 Denen,
die an der Existenz Gottes zweifeln, hat der Mathematiker Blaise Pascal
eine Wette vorgeschlagen: Sie sollten nur immer so leben, als ob es Gott gibt.[17]
Denn dabei müßten sie in jedem Fall gewinnen. Wenn es ihn gibt,
sowieso. Und wenn nicht, dann wären sie immerhin anständig durchs Leben
gekommen – und hätten auch gewonnen! Wenn alle so tun, als ob es Gott
gäbe, dann ist es so gut, als ob es Gott gibt. „Gott wird, wo alle
Kreaturen Gott aussprechen“, predigte Meister Eckhart.[18]
Das Göttliche werde „konstruiert durch das Rechttun. Jene lebendige und
wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott. Wir bedürfen keines
anderen Gottes und können keinen anderen fassen“, erläuterte Fichte.[19]
„Ich glaube nicht, daß Gott da war, sondern daß er erst kommt. Aber
nur, wenn man ihm den Weg kürzer macht als bisher“, ergänzte ein Dichter
des 20. Jahrhunderts.[20]
Denen,
die an der Existenz Gottes zweifeln, hat der Mathematiker Blaise Pascal
eine Wette vorgeschlagen: Sie sollten nur immer so leben, als ob es Gott gibt.[17]
Denn dabei müßten sie in jedem Fall gewinnen. Wenn es ihn gibt,
sowieso. Und wenn nicht, dann wären sie immerhin anständig durchs Leben
gekommen – und hätten auch gewonnen! Wenn alle so tun, als ob es Gott
gäbe, dann ist es so gut, als ob es Gott gibt. „Gott wird, wo alle
Kreaturen Gott aussprechen“, predigte Meister Eckhart.[18]
Das Göttliche werde „konstruiert durch das Rechttun. Jene lebendige und
wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott. Wir bedürfen keines
anderen Gottes und können keinen anderen fassen“, erläuterte Fichte.[19]
„Ich glaube nicht, daß Gott da war, sondern daß er erst kommt. Aber
nur, wenn man ihm den Weg kürzer macht als bisher“, ergänzte ein Dichter
des 20. Jahrhunderts.[20]Mal angenommen, ein besonderes Fach namens Pädagogik solle es wirklich geben. Was wäre dann der Zweck, durch den es sich rechtfertigt? ‚Den Weg kürzer machen’ ohne Zweifel. Wie? Indem sie Kinder verlockt, auf den Sinn zu wetten.
Durch so viel Formen geschritten
Doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu.
Das ist eine Kinderfrage.
Es wurde dir spät bewußt:es gibt nur eines: ertrage
- ob Sinn, ob Sucht, ob Sage -
dein fernbestimmtes: du mußt.
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere -
was alles erblühte, verblich.Es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich.
G. Benn
Das ist die verzweifelte Alternative. Nicht, daß man sie widerlegen könnte. Ob man aber damit ein Leben anständig führen kann? Sache der Pädagogik wäre, solange dazu noch Zeit ist, dies: die „Kinderfrage“ festzuhalten, auszumalen und immer wieder auszusprechen. Der Sinn des Lebens ist, daß du nach ihm fragst. Das ist Wahrheit. Das Leben selber kommt auch ohne aus. Nur hat es dann keine Würde: Dies Problem so zur Darstellung bringen, daß es lockt – das ist Kunst, das muß man können.
Das ist die verzweifelte Alternative. Nicht, daß man sie widerlegen könnte. Ob man aber damit ein Leben anständig führen kann? Sache der Pädagogik wäre, solange dazu noch Zeit ist, dies: die „Kinderfrage“ festzuhalten, auszumalen und immer wieder auszusprechen. Der Sinn des Lebens ist, daß du nach ihm fragst. Das ist Wahrheit. Das Leben selber kommt auch ohne aus. Nur hat es dann keine Würde: Dies Problem so zur Darstellung bringen, daß es lockt – das ist Kunst, das muß man können.

[1] s. Jochen Ebmeier, Von der Pisa-Studie und der Neurobiologie des Lernens in PÄDForum, Heft 1/ Jg. 30, Feb. 2002; Das Kind im Mann, aaO, Heft 5/ Jg. 30, Okt. 2002; Homo ludens victor, aaO, Heft 2/Jg. 31, April 2003; Die Grenzen der pädagogischen Vernunft, aaO, Heft 3/Jg. 31, Juni 2003; Herbarts Einsicht, aaO, Heft 5/31. Jg., Okt. 2003. – Der Redaktion sei Dank, daß sie sich auf das Wagnis eingelassen hat.
[2] Max Scheler, Probleme einer Soziologie des Wissens, in: ders., Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 3/1980, S. 110
[3] vgl. Chr. Griese, Ad fontes! in: PÄD Forum, Heft 2/31. Jg., April 2003
[4] Fragment 3; nach H. Diels (Hg.), Fragmente der Vorsokratiker, Hamburg 1957, S. 45
[5] Fragment 49a; ebd. S. 26
[6]J. J. Rousseau, Emil oder Über die Erziehung, Paderborn 1971, S. 292
[7] vgl. Ernst Cassirer, Kant und Rousseau; in: Rousseau, Kant, Goethe, Hamburg 1991 (PhB)
[8] Rousseau, S. 293
[9]
Wolf Singer, Vom Bild zur Wahrnehmung, unveröfftl. Ms. (Vortrag auf der
Tagung Iconic Turn im April 2003 an der Universität München)
[10] J. G. Fichte, Sämtliche Werke, Berlin 1971; Bd I, S. 281, 283
[11] ebd, Bd. IV, S. 65
[12] Immanuel Kant, Werke (Hg. Weischedel), Frankfurt/M 1968; Bd. VI, S. 249f.
[13] z. B. in: Fr. Hölderlin, Sämtliche Werke, Ffm. 1961, S. 114ff.
[14] L. Wittgenstein, Werke Bd. I, Frankfurt/M., S. 81
[15] vgl. Stephen Toulmin, Voraussicht und Verstehen; Frankfurt/M. 1968
[16] J. G. Fichte, aaO, Bd. III, S. 39
[17] Pascal, Pensées Nr. 233 (éd. Brunschvicg)
[18] Mr. Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, München 1963, S. 273 (Pr. 26)
[19] Fichte, aaO Bd. V, S. 185f.
[20] Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1952, S. 1022






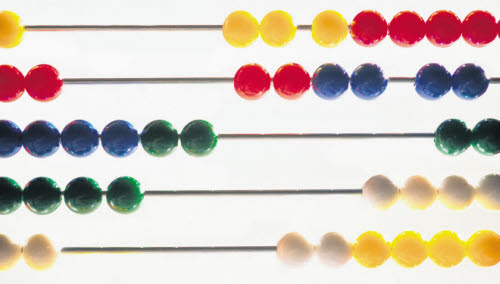








Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen