in: Neues Deutschland vom 14. 4. 1994
Schrumpft die Schule!
Gesellschaft
heißt Arbeitsteilung und Kooperation. Wer in der Gesellschaft lebt,
lebt von der Gesellschaft. Zivilisationsmüdigkeit ist – Kunststück –
ein Zivilisationsprodukt. „Zurück zur Natur“ ist die Luxusparole derer,
die schon alles haben. Wer mit dem Ausstieg ernstmachen wollte, müßte
zuerst der Gesellschaft zurückerstatten, was er bereits von ihr genommen
hat. Dann mag er ziehen…
Der Mensch ist ein Kulturwesen; das Kulturwesen. Neben seiner ersten, physiologischen, hat er eine zweite, historische und selbstgemachte Natur. Oder richtiger: Da er Kulturwesen ist, hat er auch seine erste Natur nur als Kulturgeschöpf; er kann nicht mehr wählen. Daß er überhaupt wählen will, verdankt er seiner selbstgemachten Geschichte und zeigt, daß er schon gewählt hat: Nur als Kulturmensch kann er Naturwesen sein wollen.
Ob Kinder in die Gesellschaft und ihre Kultur hineinwachsen sollen oder nicht, steht nicht im Ermessen ihrer (zufälligen) Eltern. Jene sind selber Kulturprodukte und mögen, wenn sie die Bedingung erfüllen, die Kultur fliehen; aber andere ungefragt ins Exil schicken, das dürfen sie nicht. Die allgemeine Schulpflicht ist selbst ein kultureller Reichtum.
Denn Aufgabe der Schule ist es, das kulturelle Erbe der Menschheit an die nachwachsende Generation weiter zu reichen. Ihr Zweck ist Bildung.
Ausbildung für den Arbeitsmarkt ist ihr erst in neuerer Zeit als Pensum zugewachsen, mit der Industrialisierung und ihren verallgemeinerten Qualifikationsstandards. Die Schule hörte auf, privilegiertes Bildungsinstitut der herrschenden Klassen zu sein, und wurde allgemeine Dienstleistungsindustrie für den Arbeitsmarkt: vergesellschaftete Produktion des Arbeitsvermögens…
Die Realschule drängte das Gymnasium in die Defensive.
Heute ist das, was man in der Schule lernen kann, so unbrauchbar für das berufliche Fortkommen wie nie zuvor. Was du gestern gelernt hast, ist heute schon veraltet. Der technologische Fortschritt macht jeden Tag neue Fertigkeiten und, was fast dasselbe ist, neue Formen der Arbeitsteilung erforderlich. Wer sich am Arbeitsmarkt halten will, muß sich permanent „weiterbilden“. Die Idee, die Schule könne den Heranwachsenden „mit allem ausstatten, was er im Leben mal brauchen wird“, ist vorsintflutlich und findet einen (wackligen) Anhaltspunkt nur noch im beschäftigungspolitischen Standesinteresse der Lehrerschaft.
Max Scheler hat in seiner Wissenssoziologie unser Wissen in drei Klassen geschieden. ‚Herrschaftswissen’ bezeichnet all jene Kenntnis, die die Mächtigkeit der Menschen über ihre Lebensumstände erweitert: Wissen, das nützt. ‚Bildungswissen’ ist ein solches, das man „nur so“ besitzt: um seiner selbst willen; die Bekanntschaft mit Kunst und Philosophie etwa. „Heilswissen“ schließlich ist alles, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat.
Die propagierte Verwissenschaftlichung der Schule im letzten Vierteljahrhundert hat sich am Ende als die flachselbstverständliche Subsumtion aller möglichen Wissensgehalte unters Diktat der Nützlichkeit erwiesen. Deutschunterricht wird heute so erteilt, als ginge es lediglich um die Ausbildung neuer Deutschlehrer. Griechisch und Latein sind ganz entfallen; wer will denn heut auch schon noch Altphilologe werden?
Von Humanismus am Gymnasium keine Spur ; es ist selbst nur noch eine große (und nicht enden wollende) Realschule.
Der Pflasterstein, den die Finanzpolitiker dieser Tage in den Froschteich geworfen haben, kann zum Befreiungsschlag der Bildungspolitik werden. Der gesunde Menschenverstand hat vernehmlich das Wort ergriffen, und das laute Quaken der ‚Betroffenen’ läßt ahnen, daß er ins Schwarze getroffen hat.
Natürlich muß das dreizehnte Schuljahr gestrichen werden. Die jungen Leute werden viel zu lange vom allgemeinen gesellschaftlichen Verkehr ferngehalten, und der ist schließlich selber eine kulturierende Instanz.
Aber gewiß nicht, um den unnützen Ausbildungsplunder von dreizehn Jahren nun in deren zwölfe zu stopfen. Es muß die Chance beim Schopf ergriffen werden, die Lehrpläne gründlich auszumisten – nicht von Bildungswissen, sondern von unbrauchbaren Realien. Es ist völlig in der Ordnung, daß die Inhalte abendländischer Bildung zuerst einmal für die Schule gelernt werden und nicht „fürs Leben“: Nützen können sie sowieso nicht, und wertschätzen wird man sie erst aus gewonnenem Abstand. Aber daß Kenntnisse, die der persönlichen Karriere zugedacht waren, ausschließlich fr den Lehrer und die nächste Klassenarbeit gebüffelt, dann aber schleunigst vergessen werden, um neuem Dreitageschrott Platz zu machen, das ist ein Unrecht an den Schülern und eine Zumutung für den Steuerzahler.
Nur wenn die Schule wieder Stätte allgemeiner Bildung wird und die Ausbildung für den Arbeitsmarkt spezialisierten Instituten überläßt, die was davon verstehen, kann auf die Dauer die allgemeine Schulpflicht gegen die Ivan Illichs und andere luxurierende Kulturflüchter verteidigt -, und kann verhindert werden, daß Bildung schließlich wieder zum Privileg weniger Auserwählter wird.
Bildung aber braucht Muße.
Input und Output haben da nichts zu suchen. Schulstreß und Bildung schließen einander aus. Es ist also klar, in welche Richtung jede ernstgemeinte Diskussion um weitere Schulreform nunmehr zu gehen hat: Reduktion der Stundenpläne, Rückgewinnung von freier Zeit.
Und es gibt keinen Grund, damit bis zur gymnasialen Oberstufe zu warten. Indianerspiele, Kokeln hinterm Haus, Streunen durch Keller und Dachböden, zielloses Vagieren in Stadt und Land weiten den Blick und wecken den Wunsch, mehr zu wissen. Sie sind echte Bildungselemente, wie die elektronischen Medien übrigens auch.
Und alles braucht seine Zeit.
Lehrer, die der angeblich wachsenden Gewaltbereitschaft an den Schulen nicht mehr Herr werden, sollten sich zusammenschließen und dafür starkmachen, ihre Schüler nicht mehr länger, als zu Bildungszwecken unvermeidlich, zu klaustrieren, aus der Welt auszusperren und in ihrem natürlichen Unternehmungsgeist zu hemmen. Eine Menge Probleme erledigen sich dann von selbst, und die Kultur gewinnt.
Kampf dem Schulstreß! Arbeitszeitverkürzung auch für Kinder!
Nieder mit der Ganztagsschule! Rettet den schulfreien Nachmittag!
Der Mensch ist ein Kulturwesen; das Kulturwesen. Neben seiner ersten, physiologischen, hat er eine zweite, historische und selbstgemachte Natur. Oder richtiger: Da er Kulturwesen ist, hat er auch seine erste Natur nur als Kulturgeschöpf; er kann nicht mehr wählen. Daß er überhaupt wählen will, verdankt er seiner selbstgemachten Geschichte und zeigt, daß er schon gewählt hat: Nur als Kulturmensch kann er Naturwesen sein wollen.
Ob Kinder in die Gesellschaft und ihre Kultur hineinwachsen sollen oder nicht, steht nicht im Ermessen ihrer (zufälligen) Eltern. Jene sind selber Kulturprodukte und mögen, wenn sie die Bedingung erfüllen, die Kultur fliehen; aber andere ungefragt ins Exil schicken, das dürfen sie nicht. Die allgemeine Schulpflicht ist selbst ein kultureller Reichtum.
Denn Aufgabe der Schule ist es, das kulturelle Erbe der Menschheit an die nachwachsende Generation weiter zu reichen. Ihr Zweck ist Bildung.
Ausbildung für den Arbeitsmarkt ist ihr erst in neuerer Zeit als Pensum zugewachsen, mit der Industrialisierung und ihren verallgemeinerten Qualifikationsstandards. Die Schule hörte auf, privilegiertes Bildungsinstitut der herrschenden Klassen zu sein, und wurde allgemeine Dienstleistungsindustrie für den Arbeitsmarkt: vergesellschaftete Produktion des Arbeitsvermögens…
Die Realschule drängte das Gymnasium in die Defensive.
Heute ist das, was man in der Schule lernen kann, so unbrauchbar für das berufliche Fortkommen wie nie zuvor. Was du gestern gelernt hast, ist heute schon veraltet. Der technologische Fortschritt macht jeden Tag neue Fertigkeiten und, was fast dasselbe ist, neue Formen der Arbeitsteilung erforderlich. Wer sich am Arbeitsmarkt halten will, muß sich permanent „weiterbilden“. Die Idee, die Schule könne den Heranwachsenden „mit allem ausstatten, was er im Leben mal brauchen wird“, ist vorsintflutlich und findet einen (wackligen) Anhaltspunkt nur noch im beschäftigungspolitischen Standesinteresse der Lehrerschaft.
Max Scheler hat in seiner Wissenssoziologie unser Wissen in drei Klassen geschieden. ‚Herrschaftswissen’ bezeichnet all jene Kenntnis, die die Mächtigkeit der Menschen über ihre Lebensumstände erweitert: Wissen, das nützt. ‚Bildungswissen’ ist ein solches, das man „nur so“ besitzt: um seiner selbst willen; die Bekanntschaft mit Kunst und Philosophie etwa. „Heilswissen“ schließlich ist alles, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat.
Die propagierte Verwissenschaftlichung der Schule im letzten Vierteljahrhundert hat sich am Ende als die flachselbstverständliche Subsumtion aller möglichen Wissensgehalte unters Diktat der Nützlichkeit erwiesen. Deutschunterricht wird heute so erteilt, als ginge es lediglich um die Ausbildung neuer Deutschlehrer. Griechisch und Latein sind ganz entfallen; wer will denn heut auch schon noch Altphilologe werden?
Von Humanismus am Gymnasium keine Spur ; es ist selbst nur noch eine große (und nicht enden wollende) Realschule.
Der Pflasterstein, den die Finanzpolitiker dieser Tage in den Froschteich geworfen haben, kann zum Befreiungsschlag der Bildungspolitik werden. Der gesunde Menschenverstand hat vernehmlich das Wort ergriffen, und das laute Quaken der ‚Betroffenen’ läßt ahnen, daß er ins Schwarze getroffen hat.
Natürlich muß das dreizehnte Schuljahr gestrichen werden. Die jungen Leute werden viel zu lange vom allgemeinen gesellschaftlichen Verkehr ferngehalten, und der ist schließlich selber eine kulturierende Instanz.
Aber gewiß nicht, um den unnützen Ausbildungsplunder von dreizehn Jahren nun in deren zwölfe zu stopfen. Es muß die Chance beim Schopf ergriffen werden, die Lehrpläne gründlich auszumisten – nicht von Bildungswissen, sondern von unbrauchbaren Realien. Es ist völlig in der Ordnung, daß die Inhalte abendländischer Bildung zuerst einmal für die Schule gelernt werden und nicht „fürs Leben“: Nützen können sie sowieso nicht, und wertschätzen wird man sie erst aus gewonnenem Abstand. Aber daß Kenntnisse, die der persönlichen Karriere zugedacht waren, ausschließlich fr den Lehrer und die nächste Klassenarbeit gebüffelt, dann aber schleunigst vergessen werden, um neuem Dreitageschrott Platz zu machen, das ist ein Unrecht an den Schülern und eine Zumutung für den Steuerzahler.
Nur wenn die Schule wieder Stätte allgemeiner Bildung wird und die Ausbildung für den Arbeitsmarkt spezialisierten Instituten überläßt, die was davon verstehen, kann auf die Dauer die allgemeine Schulpflicht gegen die Ivan Illichs und andere luxurierende Kulturflüchter verteidigt -, und kann verhindert werden, daß Bildung schließlich wieder zum Privileg weniger Auserwählter wird.
Bildung aber braucht Muße.
Input und Output haben da nichts zu suchen. Schulstreß und Bildung schließen einander aus. Es ist also klar, in welche Richtung jede ernstgemeinte Diskussion um weitere Schulreform nunmehr zu gehen hat: Reduktion der Stundenpläne, Rückgewinnung von freier Zeit.
Und es gibt keinen Grund, damit bis zur gymnasialen Oberstufe zu warten. Indianerspiele, Kokeln hinterm Haus, Streunen durch Keller und Dachböden, zielloses Vagieren in Stadt und Land weiten den Blick und wecken den Wunsch, mehr zu wissen. Sie sind echte Bildungselemente, wie die elektronischen Medien übrigens auch.
Und alles braucht seine Zeit.
Lehrer, die der angeblich wachsenden Gewaltbereitschaft an den Schulen nicht mehr Herr werden, sollten sich zusammenschließen und dafür starkmachen, ihre Schüler nicht mehr länger, als zu Bildungszwecken unvermeidlich, zu klaustrieren, aus der Welt auszusperren und in ihrem natürlichen Unternehmungsgeist zu hemmen. Eine Menge Probleme erledigen sich dann von selbst, und die Kultur gewinnt.
Kampf dem Schulstreß! Arbeitszeitverkürzung auch für Kinder!
Nieder mit der Ganztagsschule! Rettet den schulfreien Nachmittag!
Kurz, schrumpft die Schule.
Die Einführung des schulfreien Nachmittags…
…in Deutschland
Nicht wahr, lieber Leser: Dass allein in Deutschland und im benachbarten Österreich die Kinder nur vormittags zur Schule gehen und am Nachmittag frei haben – das hielten auch Sie für einen Beweis teutonischer Hinterwäldlerei? Ein Relikt aus dem Mittelalter…!.
Tatsächlich aber war der schulfreie Nachmittag bei uns die allererste Errungenschaft deutscher Reformpädagogik, und zwar in… Preußen, wo die allgemeine Schulpflicht das Licht der Welt erblickt hat!
Hier ein unverdächtiger, ganz unbestechlicher Zeuge:
“In
Berlin ist infolge der großen Hitze letzten Sommer in mehreren
höheren Schulen der Nachmittagunterricht ganz aufgehoben und die
Morgenschulstunden um eine verlängert [worden].
Die Folgen waren ganz unerwartet, die Jungen kamen enorm rasch voran,
und die Sache soll jetzt auf größerem Maßstab versucht werden.”
.
Friedrich Engels an Karl Marx, Manchester, den 14. Oktober 1868
in: Marx-Engels-Werke, Bd. 32, S. 183f.
in: Marx-Engels-Werke, Bd. 32, S. 183f.
_________________________________________________________
Ach,
was ich noch sagen wollte: Deutschland hat bei PISA ja wirklich nicht
so gut abgeschnitten. Aber das verfreundete Österreich mit seinem
gleichfalls freien Nachmittag schon viel besser!
Und was für Schulen hat übrigens das Dutzend Länder, die beim PISA-Ranking noch hinter Deutschland liegen?
Ganztagsschulen.
Na, wenn uns das keine Warnung ist!
Und was für Schulen hat übrigens das Dutzend Länder, die beim PISA-Ranking noch hinter Deutschland liegen?
Ganztagsschulen.
Na, wenn uns das keine Warnung ist!
Die ideale Schule gibt es nicht, weil die Schule selbst kein Ideal ist.
Der Streit um die Gliederung des Schulsystems und um den richtigen Zeitpunkt für eine allfällige Scheidung in Leistungszweige ist dogmatisch und wird es immer bleiben; das heißt, er kann nur als Glaubenskrieg geführt werden und nie als wissenschaftliche Diskussion.
Warum? Weil sein Ausgangspunkt nicht kritisch ist, sondern dogmatisch. Er geht von der historischen Gegebenheit der Schule aus - und behandelt sie wie eine Naturtatsache. “Schule muss sein.” Alle zu erwägenden Gesichtspunkte werden von da an ausschließlich innerhalb dieses gedanklichen Rahmens geschöpft; und stehen einander im Weg und können sich von einander nicht lösen.
Der “positive” Zugang wäre bei diesem Thema aber ein kritischer: Die Schule ist nur ein Notbehelf.
Am besten lernen Kinder, wenn sie allein oder in einer kleinen Gruppe von drei, vier Geschwistern oder Freunden in allen oder fast allen Fächern von stets derselben Person unterrichtet werden. Das ist der Wissen- schaftlichen Pädagogik bekannt, seit es sie gibt, nämlich seit Johann Friedrich Herbart. Alle empirischen Untersuchungen werden das bestätigen, aber das ist gar nicht notwendig; denn das
 Problem liegt nicht bei der theoretischen
Glaubwürdigkeit, sondern bei der praktischen Machbarkeit: “Es geht nicht.”
Problem liegt nicht bei der theoretischen
Glaubwürdigkeit, sondern bei der praktischen Machbarkeit: “Es geht nicht.” Die modernen hoch arbeitsteiligen Gesellschaften beruhen auf der weitest möglichen Anwendung von Wissenschaft. Um sich in ihnen zurecht zu finden, reicht nicht mehr bloß erfahrungsmäßiges Learning by doing, sondern ist eine lange Einführungsphase von fachlich differenzierter Unterweisung nötig. Nicht etwa, dass nun jeder wissenschaftlich denken können müsste; aber jeder muss den täglichen Umgang mit den Erzeugnissen der Wissenschaft beherrschen. Das liegt im öffentlichen Interesse und muss öffentlich gewährleistet werden; d. h. finanziert. Und die Öffentlichkeit kann ein Hauslehrer-System schlechterdings nicht bezahlen.
Nur darum “müssen” Schulen sein.
Denn in allen erdenklichen pädagogischen Hinsichten sind die dem Hauslehrer-Prinzip klaftertief unterlegen.*
Daraus folgt: Maßstab für die pädagogischen Erwägungen über die Schulen dürfen nicht diese selbst sein, denn sie sind ja nur ein unvermeidliches Übel; sondern muss als Orientierungspunkt das sein, was durch Hauslehrer erbracht werden könnte. Wenn sich dann findet, dass man es so nicht machen kann, weil es zu teuer würde, dann muss man es auch so sagen. Und nicht die beste Lösung suchen, die unter schulischer Prämisse möglich ist, sondern die zweitbeste Lösung unter Hauslehrer-Prämissen: Die wäre pädagogisch immer noch sinnvoller – und vielleicht eben noch bezahlbar.
Es geht also nicht um diese oder jene institutionelle Maßnahme, es geht um die gesamte Perspektive.
Und von diesem Standpunkt aus ist es eben nicht wahr, dass ‘Kinder am besten lernen, wenn sie möglichst lange gemeinsam unterrichtet werden’. Wahr ist: Am besten hätte jedes Kind seine Schule ganz für sich allein – vielleicht mit den Geschwistern dabei oder den besten Freunden. Von diesem Standpunkt aus ist es wahr, dass die Schulen gar nicht differenziert genug sein können – und gar nicht früh genug mit dem Differenzieren beginnen!
 Bleibt freilich die Frage: Wer differenziert? Auf Grund welcher Kriterien?
Bleibt freilich die Frage: Wer differenziert? Auf Grund welcher Kriterien?Das ist aber ausschließlich ein Problem der Lehrer. Sie sind es, die keine verlässlichen Kriterien haben (und es wissen), sie sind es, die ihrer Urteilskraft nicht vertrauen. Das liegt nicht an den Kindern und sagt gar nichts über den Sinn früher Differenzierung.
Und dass die Differenzierung für alle auf einmal zum selben Zeitpunkt geschehen muss, ist ein rein administratives Problem der Schulen als Verwaltungsapparat, und hat mit Kindern und Pädagogik wiederum nichts zu tun.
Kurz und gut, das Problem ist nicht, dass diffenziert wird, sondern dass nicht genügend differenziert wird; und dass für alle derselbe Zeitpunkt festgesetzt ist.
Und dass nicht genügend differenziert wird, bedeutet zugleich: dass Differenzierungen praktisch immer nur in die eine Richtung möglich sind. Eine echte Differenzierung wäre jederzeit umkehrbar.
Der Klamauk um unser dreigliedriges Schulsystem ist eine Mummenschanz. Dahinter verstecken die kriegführenden Parteien ihre besondern Interessen, deren Originalanblick sie dem Publikum nicht zumuten wollen.

www.scherning.de
*) Und man komme mir nicht mit dem “sozialen Lernen”! Das erledigen Kinder auf die bestmögliche Weise in den selbstgefundenen Formen der Kindergesellschaft - so weit weg von der Schule wie möglich. Die Zwangs- promiskuität der Pausenhöfe und Klassenräume fördert die spontan dissozialen Neigungen der Kinder: Die haben sie nämlich ebenso wie die Erwachsenen. Beweis: Die Rütli-Schule in Neukölln und das jüngste Manifest der Schulleiter aus Berlin-Mitte.
23. 1. 2009
... Das ist der entscheidende Gedanke: Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben setzt heute eine Menge Wissen voraus, das der Mensch nicht einfach so nebenher und ganz von alleine erwirbt. Das ist weniger selbst- verständlich, als es klingt. Denn bis vor rund anderthalb Jahrhunderten galt dieser Satz nur für die Angehörigen der herrschenden Klassen. Deren Kinder brauchten immer eine ganz besondere Schule, die sie später zum Herr- schen - und dazu gehört das glaubwürdige Repräsentieren der Herrschaft - befähigte. Und gleich an dieser Stel- le fällt auf: Eine Schule musste diese Schule nicht unbedingt sein, denn eine solche taugte wohl für werdende Kleriker, nicht aber für künftige Krieger und Regenten. Doch einer besonderen Lehrzeit im Dienst bei einem Fürsten mussten auch die Kinder des Adels sich unterziehen.
Die Kinder der einfachen Leute, und die waren die große Mehrheit, wuchsen in den Haushalt ihrer Familie hinein, und die war in der agrarischen Gesellschaft die eigentliche Produktions- und Wirtschaftsstätte. Zum Bauern wuchs man auf dem eigenen Hof heran. (Die Kinder der Tagelöhner lernten Vieh hüten.) Das zünf- tige Handwerk mit seinem ausgefeilten Lehrlings- und Gesellensystem gehörte schon zu dem privilegierteren Teil der städtischen Gesellschaften.
Und schließlich die kaufmännischen Patrizier - waren die Gesellschaftsklasse, in der "die Schule" zur Norm geworden ist. Die städtischen Bürgerschulen wurden, nach der Reformation zumal, zum Grundbestand, auf dem unser heutiges Schulwesen aufgebaut ist, auf sie geht das humanistische Gymnasium zurück, das zum Paradigma der Schule wurde. Hier lernte man, was man als Bürger unter Bürgern wissen und können musste, als Berufsmensch, der sich unter seinesgleichen im Marktgeschehen zu orientieren und behaupten wusste. Und als dann das Kapital in die Industrie zu fließen begann, wurden neben den Kaufleuten immer mehr Ingenieure gebraucht. Die Realschulen machten den Gymnasien Konkurrenz, und die spezialisierten sich auf die Vorbereitung zum Höheren Staatsdienst.
Dagegen war die Volksschule von Anbeginn Restschule. Die bildete nicht zum Bürger, sondern konditionierte zum Untertan und Tagelöhner. Lesen, schreiben, das Kleine Einmaleins und der Katechismus, mehr wurde nicht benötigt. Das war der Typ des Proletariers, den die Industrialisierung brauchen konnte.
Die Geschichte der Schule im 20. Jahrhundert ist schließlich die Geschichte, wie das Schulsystem immer mehr zum Schatten und zum Wurmfortsatz der Verwaltungen wurde, der öffentlichen mehr noch als der wirtschaft- lichen. Mit der Explosion des Öffentlichen Dienstes explodierten die Gymnasien, und mit wachsender Masse sanken die Maßstäbe.
Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: Die Aufgabe einer Schule ist es, Wissen zu vermitteln, das der Mensch nicht einfach so nebenher und ganz von alleine erwirbt. Setzt die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben heute mehr Wissen voraus als früher, so dass eine längere Lernzeit erforderlich würde?
Jein. Einerseits ist die Masse von Wissen, das einer heute braucht, unermesslich, doch andererseits ist es so schnell überholt wie nie zuvor, und man tut gut daran, es sich nicht allzu gut zu merken, damit im Gedächtnis gleich Platz geschaffen werden kann, wenn neue Nachrichten eintreffen; und was man grad eben nicht gewärtig hat, darauf kann man jederzeit im Internet zugreifen.
Es ist nicht wirklich so, dass man heute (noch) mehr wissen muss als gestern; memorieren bis der Kopf raucht ist jedenfalls so unangebracht wie nie. Aber man müsste besser wissen. Was damit gemeint ist? Aber das wissen Sie doch längst selber! Gemeint ist, dass man das, was die (flüchtigen) Daten bedeuten, gründlicher verstehen soll- te - denn dann fällt man nicht jedesmal in Verwirrung, wenn man die alten Daten gegen neue auswechseln muss. Der Haken sei der, dass man das Verstehen der Schüler nicht mit einem Test erheben kann? Da haben Sie nun auch wieder Recht.
Und wenn man bei PISA I zuerst noch annahm, mit den 'Kompetenzen zur Welterschließung' sei Verständnis gemeint gewesen, wurde bald klar, dass lediglich die Testmethode des Multiple choice mit dem Brecheisen durchgesetzt werden sollte.
Dieses hinzugefügt habend, kann ich mich den Ausführungen von Prof. Schirlbauer weitgehend anschließen; doch nicht ohne anzumerken, dass es wohl in der Natur der Schule selber liegt, dass sie mehr zum Memorieren neigt als zum verstehen-Lehren.
8. 7. 15
Ins Stammbuch der Schulexperten

Rousseau hat glaube ich gesagt: ein Kind, das bloß seine Eltern kennt, kennt auch die nicht recht. Dieser Gedanke läßt sich [auf] viele andere Kenntnisse, ja auf alle anwenden, die nicht ganz reiner Natur sind: Wer nichts als Chemie versteht versteht auch die nicht recht.
_____________________________________________________
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher Heft J, N°860
Warum Schule schadet.
Wenn ich einen Text lese, ist mir die Denkaufgabe vorgegeben. Ich will diesen Text verstehen. Abschweifungen würden stören.
Wenn ich einen Text schreibe, ist mir die Denkaufgabe vorgegeben. Ich will diesen Gedanken formulieren. Abschweifungen würden stören.
Beides erfordert Konzentration, und die muss man üben.
Wenn ich die Welt bedenke, sind Abschweifungen notwendig, denn sie sind das Material, in dem ich suche und finde. Damit die Einbildungskraft spielen kann, braucht sie Entspannung.
Schulischer (und jeder andere) Unterricht verlangt Konzentration. Nicht nur ist Schule eine halbe Sache. Sie schadet sogar, wenn sie den Eindruck erweckt, Konzentration sei die Form des eigentlichen Denkens. Das konzentrierte Denken ist immer sekundär und in manchen Fällen nicht einmal erforderlich.
Unsere Schulen erwecken diesen Eindruck, denn ihr Funktionsmodus ist Unterricht und Übung.* Werden gelegentlich kreative Sequenzen eingeflochten, dann unterliegen sie entweder dem Lernziel der jeweiligen 'Stunde' (und sind in Wahrheit Konzentrationsgymnastik), oder lockeres Beiwerk. Auf jeden Fall erscheinen sie als der uneigentliche Teil des Denkens. Sie sind aber der eigentliche. Die Schule lenkt den Geist auf Abwege.
Das muss man sich erstmal klarmachen: Die jungen Leute werden acht bis dreizehn Jahre ihres jungen Lebens lang in die Irre geführt - ausnahmslos und von Amts wegen. Und wenn sie Pech haben, demnächst sogar ganz- tags.
*) Gr. schôlê hieß noch Muße; aber lat. studium heißt schon Eifer.
Nur Gattungen, keine Individuen.
Ein Schullehrer und Professor kann keine Individuen erziehn, er erzieht bloß Gattungen. Ein Gedanke, der sehr viele Beherzigung und Auseinandersetzung verdient.
____________________________________
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, H
Der Durchschnitt ist der Traum jeder Schule.

aus Die Presse, Wien, 2. 3. 2016 romberg.sitepark
Kein Einzelfall: Viele Hochbegabte bleiben unerkannt
Doris Miklauschinas Sohn Markus ist hochbegabt. Glauben wollte ihr das zuerst niemand. Kein Einzelfall. Lehrern fehlt oft die Ausbildung dafür, Hochbegabungen zu entdecken.
von Julia Neuhauser
Wien/Graz. „Aufgeweckt, wissbegierig, clever und zufrieden“, so sei ihr Sohn vor dem Eintritt in die Schule gewesen, erzählt Doris Miklauschina. Nach zwei Monaten in der ersten Klasse war alles anders. „Die Lehrerin beklagte, dass Markus im Unterricht überhaupt nicht mitmache, sich in Tagträumen verliere. Er wurde ein zunehmend unglückliches Kind.“ Die Mutter hatte einen Verdacht: Ihr Sohn könnte hochbegabt sein. Glauben wollte ihr das zunächst aber niemand.
Die Geschichte von Markus ist kein Einzelfall. „Es gibt einen höheren Prozentsatz unerkannter als erkannter Hochbegabter“, sagt Thomas Trautmann, Erziehungswissenschafter an der Uni Hamburg und einer der Vortragenden bei der derzeit in Wien stattfindenden Konferenz des European Council for High Ability (ECHA). Durchschnittlich seien zwei von 100 Personen hochbegabt. („Sie kommen nicht nur aus Professorenhaushalten.“) Doch viele werden nie getestet. Und selbst die Testinstrumente sind nicht unfehlbar. „Die Tests sind wie schlechtes Besteck. Sie messen ja nie die ganze Hochbegabung. Aber wir haben nichts Besseres“, sagt Trautmann.
An einfachen Erkennungsmerkmalen ist Hochbegabung nicht festzumachen. „Kein Hochbegabter ist wie der andere. Hochbegabung ist die Disposition für höchste, exzellente Leistungen. Man kann es mit einer Garage vergleichen. Man sieht sie von außen, aber weiß nicht, ob sich darin ein Porsche befindet und welche Reifen daran montiert sind“, erklärt Trautmann. So könne das Sprachverständnis eines hochbegabten Kindes extrem gut sein, aber die Wahrnehmungsgeschwindigkeit weit unter der Norm liegen.
Keine Normalität
Auch beim heute achtjährigen Markus wurde die Hochbegabung – trotz Hinweisen der Mutter – in der Schule nicht erkannt. „Als Elternteil redet man gegen eine Wand“, sagt Miklauschina. Als sie der Lehrerin sagte, dass ihr Sohn nicht über-, sondern unterfordert sei, habe sie ein „Glaubwürdigkeitsproblem“ gehabt. Eltern, die mehr Förderung verlangen, würden als übertrieben ehrgeizig wahrgenommen.
Auch Trautmann kennt viele solche Geschichten: „Überforderung und Unterforderung ähneln sich. Man darf die Lehrer deshalb nicht rügen. In ihrer Ausbildung bekommen sie meist kaum Wissen über Test- und Verhaltensdiagnostik mit.“ Auch in der Gesellschaft hätten es Hochbegabte häufig nicht leicht. „Es entspricht nicht der Normalität, dass ein Kind mit drei Jahren lesen kann. Deshalb wirft man den Eltern vor, dass sie übereifrig sind und ihr Kind zum Lernen zwingen.“
Markus absolvierte einen Test. „Seine Hochbegabung wurde objektiviert. Damit hatten wir einen Beweis“, sagt die Mutter. Die Probleme verschwanden dennoch nicht. Das Überspringen einer Klasse und der Schulwechsel brachten nichts. „Er braucht ständig Gehirnfutter. Als er das nicht bekommen hat, hat er Ticks entwickelt.“ Schlussendlich wurde Markus zum häuslichen Unterricht abgemeldet. „Das ging nur, weil ich nicht berufstätig war“, sagt Miklauschina. Nun wird sie selbst ein Bildungsunternehmen, eine Art Schule für Hochbegabte, gründen.
Eine eigene Begabtenschule
Schon ab Herbst soll an zwei Standorten (Wien und Graz) gestartet werden. Jeweils 30 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren werden aufgenommen. Lehrer werden noch gesucht. Das Öffentlichkeitsrecht, mit dem Privatschulen öffentlichen Schulen gleichgestellt werden, strebt Miklauschina nicht an. Geld vom Staat gibt es damit keines. So wird die Ausbildung rund 550 Euro pro Monat und Kind kosten.
„Eine reine Begabtenschule – das kann klappen, aber auch schwierig werden“, sagt Trautmann. Wichtig sei, dass sich auch öffentliche Schulen mehr um Hochbegabte kümmern. So brauche es einen Unterricht, in den sich Schüler mehr einbringen können, eine bessere Verzahnung mit dem Kindergarten, interessantere Didaktik und ein entspannteres Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern.
Nota. – Die Schule ist eine Massenveranstaltung, so ist sie entstanden und nur so hat sie einen Sinn: als Chance für die breite Masse der Menschen, ihren Kindern eine Ausbildung zu verschaffen, mit der sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten können. Die breite Masse hat nicht die Mittel – weder das Geld noch selber die dafür erforderliche Bildung –, ihre Kinder individuell und privat unterrichten zu lassen. Wäre es anders, hätte es niemals Schulen gebraucht, und sie wären als reine Zwangsanstalt des Obrigkeitsstaats erschienen, der die nachwachsende Generation beizeiten kaserniert sehen will.
Aber es war nicht anders, die allgemeine Schulpflicht lag nicht nur im Interesse des Vaters Staat und im Interesse der großen Industrie, sondern im ureigensten Interesse der breiten Volksmehrheit, und ist eine der größten Errungenschaften der Kulturgeschichte.
Richtiger: Sie lag und sie war. Inzwischen hat die materielle Zivilisation gewaltige Fortschritte gemacht, es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, das ganze gesellschaftliche Leben unterm Gesichtspunkt von Mangel und Knappheit zu betrachten. Ein Leben im Überfluss ist zumindest denkbar geworden, und es gibt keinen Grund, mit dem Denken länger zu warten.
Unter der Prämisse allgemeinen Mangels konnte es den Schulen als eine wohltätige Gesinnung angerechnet werden, wenn sie die benachteiligten Schüler der unteren Leistungsgruppen "kompensatorisch" zum Klassendurchschnitt aufschließen wollten. Unter der Prämisse der Knappheit konnte man nicht auch noch verlangen, dass sie sich der qualvollen Langeweile der ohnehin besser Begabten annahm, die hatten ja Mittel, für sich selbst zu sorgen.
So jedenfalls war der äußere Schein. In Wahrheit ist der Durchschnitt selbst die allgemeinste Prämisse der Schule; weil sie nach ihrem Wesen, ganz unabhängig von Mangel und Überfluss, eine Massenanstalt ist und weil sie nach dem Wesen aller Massenanstalten technokratisch verfasst ist; bürokratisch, genauer gesagt.
Der gesunder Menschenverstand sagt aber, dass jedes Kind – weil nämlich alle Menschen mehr oder weniger verschieden sind – am besten eine individuelle Erziehung erhalten sollte, ohne dabei doch in einer Zelle isoliert zu werden; also in – gelegentlich auch wechselnden – Gruppen von drei bis fünf.
Ein hehres Ideal, das einstweilen noch in weiter Ferne liegt? Mag sein, aber wie weit die Ferne liegt, hängt von unserm Denken heute ab. Und eines ist unbestritten: Die Schule liegt zwar nahe, aber ein Ideal ist sie nicht.
JE
Die Schule ist ein Labor und nicht 'das Leben'.
Das Labor und das Leben
Eine Welt braucht jeder von uns, weil wir unsre Umwelt verlassen haben. Aber eine gemeinsame Welt brau-chen wir, weil wir zusammen arbeiten müssen. Vereinfacht, aber kaum verkürzend kann man sagen: ‚Unsere’ Welt verdanken wir der Arbeitsgesellschaft, und Wissenschaft ist ihr Abbild. In der Arbeitsgesellschaft gilt ‚unsere’ Welt als die ganze Welt, was in ihr nicht vorkommt, ist nicht real. Aber nur in der Arbeitsgesellschaft kann keiner leben, nicht der Arbeiter und nicht einmal sein Chef. Nach Feierabend darf verkehrte Welt sein, wenn man’s bezahlen kann, und gilt ein Kunstwerk nicht nur als Sachanlage. Aber das liegt jenseits der Realität.
Die Schule will die Arbeitsgesellschaft als das wahre Leben und ‚unsere’ Welt als die wahre Welt, will Wissen-schaft als das wahre Wissen lehren. (Die musischen Fächer setzen ein paar Gänsfüßchen hintan, aber keiner nimmt sie ernst.) Und jedenfalls sind die Grenzen ihrer Welt die Grenzen ihrer Wörter: „Pädagogisches Handeln ist nur dort möglich, wo der wechselseitige Austausch von sprachlich erschlossenen Erfahrungen möglich ist“, schreibt Hermann Giesecke, und fügt hinzu, das sei „der Normalfall im privaten wie im gesell-schaftlichen Leben“.* Reden über unsere Welt – das wäre Erziehung! Nein, das ist nicht der Normalfall im privaten wie im gesellschaftlichen Leben. Das ist der Normalfall im pädagogischen Labor, und nirgends sonst. Nur weil schulische Pädagogik im Labor stattfindet, kann sie sich für ‚Wissenschaft’ halten; für ‚nomotheti-sches’ Herrschaftswissen zumal.
Normalisierung bedarf freilich eines mehrjährigen Aufenthalts im Labor. Dort wird auf das gesetzmäßig Ver-bindende abgesehen und das individuell Unterscheidende ausgeklammert – bei den wissenschaftlich bestimm-ten Lehrgegenständen, was dachten Sie? Na ja, wenn ich’s recht besehe – bei den Schülern auch. Natürlich werden die persönlichen Eigenheiten des einen und der andern ‚zugelassen’, aber als Ausnahmen von der Regel. Die Regel bleibt die Regel. Wie soll der Betrieb sonst funktionieren? „Standards“, na bitte, ick bün all do! Das ist der methodologische Sinn der Laborsituation: Störfaktoren ausschalten! Es ist nicht „das Leben“, wor-auf die Schule vorbereitet, sondern das Arbeitsleben. Und das ist nur ein Teil der Wirklichkeit, und zwar, am Ende der industriellen Zivilisation, ein schrumpfender.
Die Arbeitswelt war ‚unsere’ Welt, war Sinn und Zweck des Lebens. Es gab noch einen Rest, der war Randbe-dingung, Konsumsektor, Pause und Erholung. In der Arbeitsgesellschaft war Normalisierung ein ‚gerechtfertig-tes’, nämlich aus historischer Notdurft erwachsenes Postulat. Heute erscheint immer mehr die Arbeit als ein Rest, eine Randbedingung des Lebens, das seine Bestimmung verloren – oder, besser gesagt: seine Bestimmung als Unbestimmtes wiedergefunden hat. Das wirkliche Leben spielt (sic) sich immer in einer schwebenden Span-nung zwischen ‚unserer’ und ‚meiner’ Welt ab. Wie gut sich einer in dieser Schwebe hält, bleibt tagtäglich sein Problem. Jemanden für dies Problem zu wappnen, ist der einzig mögliche Sinn einer Erziehung, durch die ‚der Mensch zum Menschen wird’.
*) Hermann Giesecke, Pädagogik als Beruf, Weinheim 1987, S. 23
Fetisch Inklusion.
 kgs-ennepetal
kgs-ennepetalBevor SCHULE (ohne Artikel) in pädagogischer Hinsicht dieses oder jenes sein kann, ist sie schlechterdings erst einmal eins: eine Massenveranstaltung. Als eine solche ist ihr Maß der Durchschnitt.
Ist Sitzenbleiben gut oder schlecht? Da gibt es welche, die waren einfach noch zu kindlich für die xte Klasse, die haben mental noch mit Puppenlappen gespielt, denen tut es gut, nochmal zurücktreten zu können, und in der wiederholten Klasse begegnen sie lauter Dingen, von denen sie irgendwie schonmal gehört haben. Manche werden so zu richtig guten Schülern.
Sollen schlechte Schüler in Sonderschulen zusammengefasst oder sollen sie, wo immer möglich, in die Norma-lität inkludiert werden? Manch einen animiert es, wenn er unter Leuten ist, die schon einen Schritt weiter sind, und er legt etwas nach. Andere wiederum bedrückt es, ständig zurückgesetzt zu sein, und sie entfalten sich besser, wenn sie unter Ihresgleichen sind und durchatmen können.
Die Schule kann immer nur fragen, was im Durchschnitt der Fall ist.
Wenn fünfzig Prozent der Schüler zur Kategorie A gehören und fünfzig Prozent zur Kategorie Z, dann liegt der Durchschnitt irgendwo bei Kategorie M. Eine Schule, die sich an der Kategorie M orientiert, ist für die eine Hälfte der Kategorie A so ungeeignet wie für die andere Hälfte der Kategorie Z. Und zwar nicht, weil der Durchschnitt fehlerhaft ermittelt wurde, sondern weil es der Durchschnitt war, der ermittelt wurde.
Der Durchschnitt ist eine mathematische Fiktion. In der Wirklichkeit entspricht ihm nicht die Mehrheit, sondern nur zufällig mal eine Minderheit.
Das Problem mit der Schule ist nicht, dass sie so oder so ist, sondern dass sie Schule ist.
Berlin, den 11. 9. 2000
Sehr geehrter Herr Professor Markl,…Meinerseits habe ich Ihre Ansprache zur Jahreshaupt- versammlung [der Max-Planck-Gesellschaft] aufmerksam gelesen. Und bin natürlich an Ihrer Klage über den Mangel an naturwissenschaftlichem Nachwuchs gestolpert, denn der Stolz meines Schulprojekts [in Fürstlich Drehna] ist doch, daß ich den Zugang zur Cyberworld über das Ästhetische gewählt habe – und gerade nicht über Technik und Naturwissenschaft. Wäre da ein Widerspruch?
Ich glaube nicht, das Problem bestünde darin, daß die Schüler irgendwann die „schwierigen“ Fächer abwählen dürfen. Sondern darin, daß der naturwissenschaftliche Unterricht, den sie bis zu diesem Zeitpunkt genossen haben, so war, daß sie es wollen. Daß die Menschen Interesse nur an dem finden, was „Spaß“ macht, sagen bloß pädagogische Versager: Seit unsern Anfängen am Turkana-See ist das noch nie so gewesen. Warum sollte es über Nacht so geworden sein?
 Es trifft sich vorzüglich, daß Sie in Ihrer Ansprache den Akzent auf die Astrophysik legen.
Noch immer habe ich während meiner Berufstätigkeit – als
Sozialpädagoge! – für Furore gesorgt, wenn ich den Zehn- bis
Vierzehnjährigen von Sonne, Mond und Sternen, Schwarzen Löchern und
Quasaren erzählte (in meinen besten Tagen gerade auf dem Niveau von Bild der Wissenschaft).
Da haben selbst Quälgeister Maul und Ohren aufgesperrt. Aber – es
sollte mich wundern, wenn nur einer von denen, als es so weit war,
Physik nicht abgewählt hätte!
Es trifft sich vorzüglich, daß Sie in Ihrer Ansprache den Akzent auf die Astrophysik legen.
Noch immer habe ich während meiner Berufstätigkeit – als
Sozialpädagoge! – für Furore gesorgt, wenn ich den Zehn- bis
Vierzehnjährigen von Sonne, Mond und Sternen, Schwarzen Löchern und
Quasaren erzählte (in meinen besten Tagen gerade auf dem Niveau von Bild der Wissenschaft).
Da haben selbst Quälgeister Maul und Ohren aufgesperrt. Aber – es
sollte mich wundern, wenn nur einer von denen, als es so weit war,
Physik nicht abgewählt hätte!Wie paßt das zusammen? Sie selbst haben das Lösungswort gesagt: Sie reden von „eigentlich unvorstellbaren Vorstellungen“! Und war es das, womit die Schüler in Klasse 7 bis 10 konfrontiert worden waren? Bestimmt nicht. Was ihnen geboten wurde, war nicht nur vorstellbar, sondern war ihnen von fremden Leuten längst fix und fertig vor-gestellt worden – damit sie’s „behalten“ sollten. Es ist aber nicht so, daß man zuerst „Fakten“ sammelt und sich hinterher ein „Bild“ daraus zusammensetzt, sondern genau umgekehrt. Wie in der Geschichte der Wissenschaft, so in der Bildungsgeschichte der Personen. Mit andern Worten, die Kinder müssen zuerst die Abenteuer des Denkens kennen lernen und den thrill des Noch-Unbestimmten, ehe sie „memorieren“; weil man nämlich die Fakten gern vergißt, solange sie nichts bedeuten. Das Staunen ist der Anfang der Philosophie, nicht das Addieren von Kenntnissen.
Mit vielem Dank für Ihre nochmalige Aufmerksamkeit und den besten Grüßen verbleibe ich herzlichst
Ihr
Jochen Ebmeier
Freunde des Landschulheims Fürstlich Drehna e. V.
__________________________________________________________
Die Klippert-Schule

oder
Das Wie und das Was und die Were
in: PÄDForum 6/2004
Nach langer Tragezeit “ist es nun endlich soweit.”[1] Das Klippert-System hat die Grundschulen erreicht – und steht vor seiner Bewährungsprobe.
 Merkwürdig: Seit nun einem Jahrzehnt [2] schleicht sich eine Bewegung durch
die pädagogische Provinz, ohne daß es offiziell zur Sprache kommt – wie
kann das sein?
Merkwürdig: Seit nun einem Jahrzehnt [2] schleicht sich eine Bewegung durch
die pädagogische Provinz, ohne daß es offiziell zur Sprache kommt – wie
kann das sein?Die Pädagogik ist in Deutschland ein closed shop. In keinem andern Erwerbszweig werden die Jagdgründe so eifersüchtig gehütet. Kein Häufchen ist so gering, daß nicht wenigstens ein erziehungswissenschaftlicher Professor drauf säße, und die mögen nicht, wenn man ihre Kreise stört. Sie revanchieren sich durch Nichtbeachtung. Nicht eins der einschlägigen Fachblätter hat bislang dem Klippert-Phänomen Aufmerksamkeit gezollt.[3] Und unter den Praktikern fiebert auch nicht jeder nach Neuerung, mancher tut nur so.
Daß Heinz Klippert da eine regelrechte Schule um sich scharen konnte, ist selber eine pädagogische Leistung, auf die man neidisch sein darf. Und deutet an, daß auch in diesem Reich die bewährte Ordnung wackelt. Aber das Neue ist nicht gut, weil es neu ist, sondern weil, d.h. wenn es besser ist als das Alte. Ob es das ist, wird sich nun weisen. Die Grundschule ist der Testfall.
Scylla
Wenn Klippert “die bis heute vorherrschende Praxis des gedankenlosen Paukens und Rezipierens in unseren Schulen” beklagt[4] – wer will ihm widersprechen? “Die meisten Lehrerinnen und Lehrer halten mehr oder weniger verbittert und trotzig an den herkömmlichen direktiven, belehrenden Verfahrensweisen fest. Nach wie vor dominieren rezeptive Lehr/Lernverfahren, die den SchülerInnen eine passive Rolle zuweisen und vorrangig reaktive und reproduktive Lernleistungen induzieren.[5] Einseitige Betonung des Memorierens ist bis heute kennzeichnend für die schulische Leistungsmessung”, sie verleitet die Schüler “zum ebenso vordergründigen wie kurzfristigen Pauken des jeweiligen Lernstoffs."[6] PISA war die Quittung: “Die deutschen Kinder sind zu unselbständig, denken zu wenig, lernen zu sehr nach Schema F, tun sich schwer mit dem Erschließen und Anwenden von Wissen” und kommen mit komplexeren Aufgabenstellungen nicht zurecht.[7]
 Früher
mag die “alte Belehrungs- und Unterweisungsmethode”[8] ihren Zweck
erfüllt haben. Wenn sie heute nicht mehr genügt, dann sind die
gegenwärtigen “Sozialisationsbedingungen” schuld.[9] Die Familie
zerfällt, der Medienkonsum nimmt überhand… “Die Anzahl derjenigen
Kinder, die demonstrativ Desinteresse zeigen, die herumkaspern, verbal
ausfällig werden, Frustrationstoleranz vermissen lassen, ständig im
Mittelpunkt stehen wollen, ausgeprägt Zuwendung verlangen, ständig Spaß
haben wollen, das soziale Miteinander in der Klasse erschweren und
dennoch geliebt und möglichst vielfältig bestätigt werden wollen, ist
inzwischen ziemlich groß geworden.”[10]
Früher
mag die “alte Belehrungs- und Unterweisungsmethode”[8] ihren Zweck
erfüllt haben. Wenn sie heute nicht mehr genügt, dann sind die
gegenwärtigen “Sozialisationsbedingungen” schuld.[9] Die Familie
zerfällt, der Medienkonsum nimmt überhand… “Die Anzahl derjenigen
Kinder, die demonstrativ Desinteresse zeigen, die herumkaspern, verbal
ausfällig werden, Frustrationstoleranz vermissen lassen, ständig im
Mittelpunkt stehen wollen, ausgeprägt Zuwendung verlangen, ständig Spaß
haben wollen, das soziale Miteinander in der Klasse erschweren und
dennoch geliebt und möglichst vielfältig bestätigt werden wollen, ist
inzwischen ziemlich groß geworden.”[10]Das wäre die Lücke auf der Angebotsseite. Auf der Nachfrageseite klafft aber ein Abgrund. Die Anforderungen des Arbeitsmarkts haben sich radikal verändert. An die Stelle des ausführenden Handlangers, dem Vorarbeiter, Meister und Abteilungsleiter das Denken, Planen und Entscheiden abgenommen haben, ist der selbstdenkende und kooperationsbereite Mitarbeiter getreten. Neben der eigentlichen Fachqualifikation werden die sogenannten Schlüsselqualifikationen immer wichtiger: “Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen, ganzheitliches Denken in Prozessen, Teamwork, Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Initiative, Kreativität, Motivation, Zuverlässigkeit”.[11]
Natürlich könne auf Fachwissen auch weiterhin nicht verzichtet werden, “allerdings ist das fachspezifische Wissen inzwischen viel zu ‚flüchtig’ geworden, als daß es noch länger sinnvoll wäre, das traditionelle Detail- und Vorratslernen aufrechtzuerhalten. Die Halbwertszeit des beruflichen Fachwissens liegt mittlerweile bei 1-3 Jahren.”[12] Jedes zweite Unternehmen halte inzwischen Fachqualifikationen und Schlüsselqualifikationen für gleich wichtig, und ein Drittel würde im Zweifelsfall sogar den Schlüsselqualifikationen Vorrang geben. Selbst wenn also die alte “Lernschule”[13] noch funktionieren würde – es braucht sie keiner mehr.
…und Charybdis
Das ist nicht neu. Seit vielen Jahre heißt die Alternative: “Offenes Lernen”; also Gruppenarbeit, selbständige Versuche, Wochenpläne, PC-Recherchen, Präsentationen, Rollenspiele und Projektarbeiten aller Art… Doch “hinter die Praxis des Offenen Unterrichts ist ein Fragezeichen zu setzen.[14] Denn Fakt ist, daß viele Lehrkräfte Gruppenarbeit bis dato eher mit Zeitvergeudung, Unruhe, Disziplinlosigkeit, Unverbindlichkeit und Ineffektivität in Verbindung bringen und deshalb entsprechend zurückhaltend davon Gebrauch machen. In der Sekundarstufe I wird nachweislich nur in rund 9% der Unterrichtszeit Partner- und Gruppenarbeit praktiziert, aber in rund drei Viertel der Unterrichtszeit auf ‚Klassenunterricht’ (Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Demonstrationen etc.) abgestellt.[15] Zu groß sind die Bedenken und Ängste, dass das offene, problemlösende Lernen das Gros der Schüler überfordert und die anstehende Wissensvermittlung über Gebühr beeinträchtigt.[16]
Vor allem die große Gruppe der eher antriebsarmen, verwöhnten, leistungsschwächeren, ängstlichen, unsicheren und/oder entscheidungsschwachen ‚Mitläufer’ in den Klassen verfügt häufig weder über die nötige Eigeninitiative und Selbstsicherheit noch über die erforderlichen methodischen Fähigkeiten und Routinen, wie sie im Rahmen offener Arbeitsformen benötigt werden. Kein Wunder also, daß sie in Freiarbeits-, Wochenplan- oder Projektphasen eher hilflos herumtrödeln, vorschnell fragen und sich helfen lassen oder gedankenlos von irgendwelchen Mitschülern abschreiben.[17] Natürlich gibt es auch die anderen Kinder, die vom Offenen Lernen in hohem Maße profitieren. Nur ist die Zahl dieser ‚autodidaktischen Lerner’ mit ausgeprägter Methoden- und Sozialkompetenz verhältnismäßig gering.”[18]
Das Zwischending
Klippert teilt die “verbreiteten Vorbehalte, die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder z. B. gegenüber Gruppenarbeit und Projektarbeit vorbringen”,[19] und illustriert sie noch mit der Zeichnung ‚Freie Arbeit in der Karikatur’: Die einen toben, die andern dösen![20]
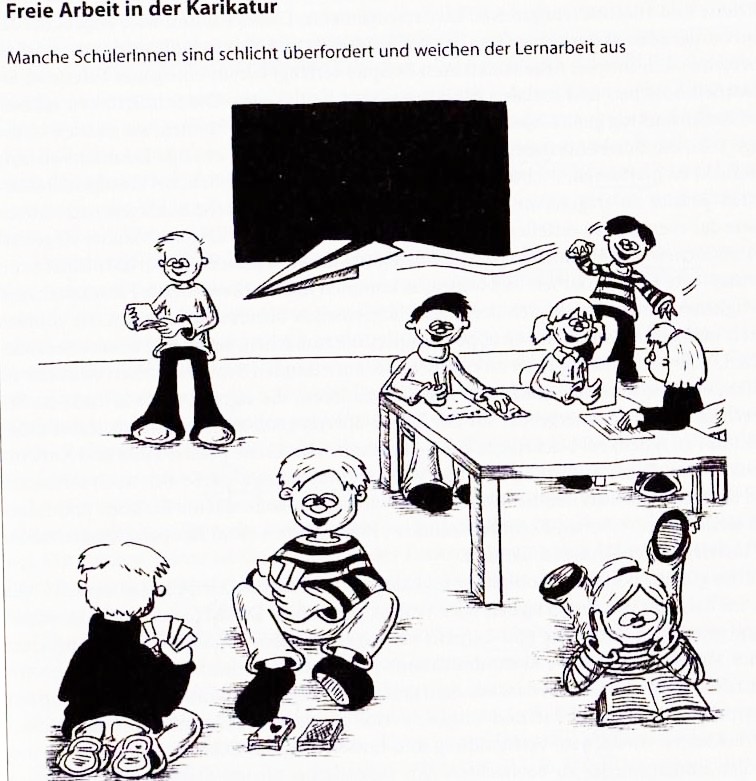
Denn
die Schüler sind für die “Hochformen des eigenverantwortlichen
Unterrichts” noch gar nicht reif! Man muß einen Zwischenschritt
einschieben, um sie zur Selbständigkeit zu ertüchtigen. Es fehle den
(meisten) Schülern nämlich an erprobten Verfahrensmustern, die ihnen
Halt geben: “ein Repertoire an fertigen Handlungsabläufen,
die durch wiederholtes Tun vorfabriziert, ganzheitlich abgespeichert
und zuverlässig zu reproduzieren und auf neue Gegebenheiten zu
übertragen sind.”[21] Nötig ist die Ausbildung von “Handlungsschemata”,
“strategische[n] Handlungsroutinen, die sich aus mehreren
Handlungselementen zusammensetzen, an die je relevantes Fachwissen
angelagert ist.”[22]
Da
geht es nicht um “Hochformen”, nicht um “Makromethoden”, die mehr an
den doktrinalen Vorlieben der Erziehungswissenschaft orientiert sind als
an den Bedürfnissen der Schüler; sondern um “die Beherrschung einfacher
Lern- und Arbeitstechniken: Markieren, Exzerpieren, Strukturieren
etc.”,[23] um einfache Skills
wie “Memorieren, Recherchieren, Visualisieren, Nachschlagen,
Klassenarbeiten vorbereiten, Zeitmanagement, Präsentieren, Interviewen,
Diskutieren, oder regelgebundene, konstruktive Arbeit im Team.”[24] Da
reichen nicht ein paar sporadische Übungen hier und da, sondern “ein
systematisches Methodentraining mit integrierten Reflexions- und
redundanten Übungsphasen” ist nötig.[25] Es geht um “Routinebildung im
besten Sinne des Wortes”,[26] und die muß “kleinschrittig
angebahnt” werden und “bereits in den ersten Klassen anlaufen”.[27]
Kleinschrittigkeit (sic), Redundanz[28] und Routine sind die
Schlüsselwörter des Klippert-Systems.
Und Reduktion! Daher seine zärtliche Sorge für das Markieren von Texten, das ihm von allen “Skills” am meisten am Herzen liegt: Unser Gehirn sei nämlich darauf angewiesen, “größere Informationsfülle gezielt zu reduzieren und etwaige Kernelemente möglichst augenfällig hervorzuheben”.[29] Darauf legt er soviel Wert, daß ihm unter der Hand die “Mikromethoden” zur Hochform anschwellen und sich sub titulo “Methodenbeherrschung” unversehens auf der Liste der (‚von der Wirtschaft geforderten’) Schlüsselqualifikationen wiederfinden.[30] Allerdings zum Preis einer kleinen Unsauberkeit. Hieß es eben noch – als Ergebnis ‚der Forschung’ -, Informationen müßten sinnfällig reduziert “und anschaulich verknüpft” werden,[31] so behält er im Fortgang nur die Reduktion bei und die anschauliche Verknüpfung fällt untern Tisch – weil sie nicht in seine Vorstellung vom Lernen als einem Stufengang paßt und in eine ganz andere Richtung weist…
Daß bei allem, was man tut, gewisse handwerkliche Fertigkeiten nützlich sind, wer wird es leugnen? Das Besondere des Klippert-Systems ist, daß das Methodische vom Inhaltlichen des Unterrichts getrennt und ihm vorangestellt werden soll: daß “in bestimmten Phasen des Unterrichts einzelne Lern-, Arbeits-, Kommunikations- und/oder bestimmte Kooperationstechniken ins Zentrum der Unterrichtsarbeit gerückt werden und gewollt Vorrang vor der erschöpfenden Behandlung der je anstehenden Inhalte erhalten.”[32] Mit gelegentlichen Übungen während des laufenden Sachunterrichts ist’s nicht getan, denn die “Dominanz der Inhalte verstellt den Blick für die Wertigkeit und die praktischen Feinheiten der Methodik”. Wirkliche ‚Methodenbeherrschung’ sei “nicht zu erreichen, wenn immer und überall die Inhalte über- mächtig im Vordergrund stehen und erschöpfend zu behandeln sind”.[33] Immer hübsch eins nach dem andern.
Der Prüfstein
Zwei Drittel des Buchs bestehen aus praktischen Übungen. Sie bieten eine ganz eigenartige Verbindung von Originalität und Pedanterie. Wir geben hier die Seiten 116/117 wieder: Rechts der hübsche Einfall, Wörter nach rein optischen Merkmalen des lateinischen Schriftbilds zu sortieren – in einer Kultur, die auf Schriftlichkeit beruht, ist das nicht entfernt so kindisch, wie der Normalstudienrat meint.

Aber links dann die unterrichtstechnische Gebrauchsanweisung: “kleinschrittig” (deutsch für: pedantisch) bis zum Exzeß.

Was anfing als ein unbefangenes und trotzdem ernstes Spiel mit Formen und Bedeutungen, endet als x-tes Exerzitium in “Methodentraining”. Die Freiheit der Einfälle steht hier wie überall in krasser Spannung zum Anspruch auf didaktische Systematik.
Die ‚systematische’ Prätention verdirbt die besten Ideen. Nehmen wir nur das Markieren: Da gibt es Übungen, wo zunächst jeder Schüler für sich einen Text markiert und hernach in der Gruppe darüber verhandelt, welche Wörter ‚wirklich’ die wichtigsten waren. Das sind vorzügliche Übungen, die bereits Grundschüler zwanglos auf eine kognitive Meta-Ebene locken: reden nicht nur über die Bedeutungen, sondern über die Bedeutungen von Bedeutungen. Das entführt sie auf eine Reflexionsebene, wo ihr Welt-Bild um eine ‚obere Etage’ erweitert wird. Doch das interessiert Klippert gar nicht. Ihm reicht “Routinebildung”.
Reflexion soll aber sein – freilich im Dienst der “Kleinschrittigkeit”: damit nix ausgelassen wird. Und so werden die Schüler zu ständiger Selbstkontrolle angehalten. Z. B. mit dem Formblatt auf S. 52 für ABC-Schützen:
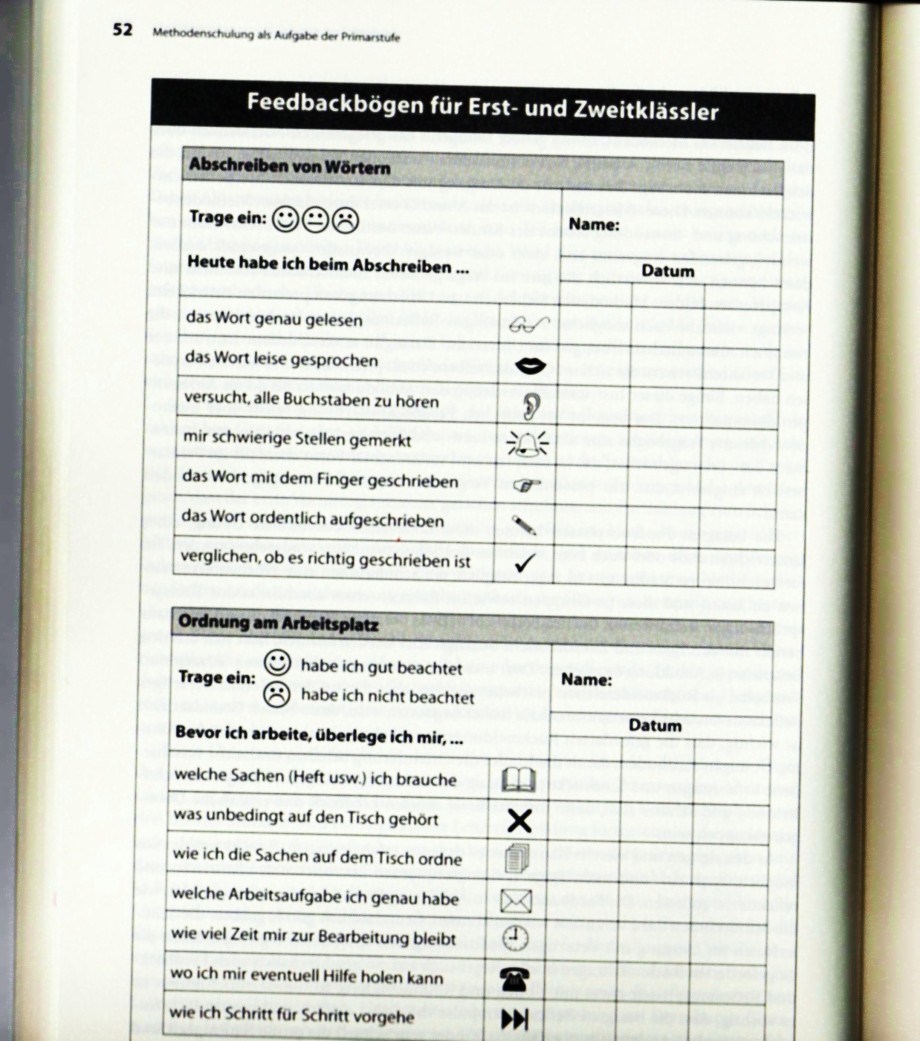
Pausenlose Selbstbeobachtung – bei sechs- bis zehnjährigen Kindern! Also in einem Alter, dessen Reichtum die unverstellte Hingewandtheit zur Welt ist und die Aufgeschlossenheit für Menschen und Dinge. Ihre Stärke ist nicht Genauigkeit, sondern Fülle der Anschauung. Weil sie sich nämlich jetzt den Vorrat anlegen, von dem sie ein Leben lang zehren werden. Statt sie in ihrem Weltbezug zu bestärken, trainiert sie das Klippert-System in Selbstbezogenheit – kleinschrittig, redundant und routiniert, als ob man gar nicht früh genug damit anfangen könnte. Es stellt die Dinge auf den Kopf.
Die Grundschule ist jene Bildungseinrichtung, wo der Grund gelegt wird für alles Kommende. Wenn sich Klipperts System hier bewährt, dann taugt es auch anderswo. Und wenn nicht, dann nicht. Alles kommt auf diese Frage an: Ist Lernen eine Aneinanderreihung von “Schritten” (seien sie klein oder groß)? Ein linearer Prozeß des kumulativen Anlagerns von Informationen, wo man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun darf, weil’s sonst um die “Anschlußfähigkeit” geschehen wär?

Dann müßte man beim Einfachsten anfangen und sukzessive zu immer komplexer zusammengesetzten Vorstellungsgebilden fortschreiten. Das Einfachste ist aber das Abstrakteste. In der sinnlichen Erfahrung, im Alltagserleben der Kinder kommt es gar nicht vor. Die Gegenstände der unmittelbaren Anschauung “zeigen sich” immer mannigfaltig und bunt. Das Einfache ist erst Produkt einer Reflexionsarbeit – bei der auf eine ‚Seite’ der Erscheinung und von allen andern Seiten abgesehen wurde. ‚Lernen’ ist also ein Prozeß der Umordnung, bei dem das weite Feld der je individuellen Anschauungen entlang entworfener ‚Sinn-Achsen’ umstrukturiert und in einen gedachten (‚gemeinten’) Zusammenhang gefügt wird.
Bei dem, was wir unsere Wahrnehmung nennen, geht nämlich doch der zweite Schritt gewissermaßen dem ersten voraus. Sie verfährt ‚erst’ synthetisch und ‚dann’ analytisch: stellt einen Zusammenhang her, den sie dann zerlegt. “Wahrnehmen ist das Verifizieren vorausgeträumter Hypothesen”, sagt der Hirnforscher Wolf Singer,[34] und der Hirnforscher Ernst Pöppel drückt dasselbe so aus: “Entwicklung: nicht Lernen, nur Bestätigen”.[35] Will sagen: ‚zu Grunde’ liegt ein Entwurf, eine spontane Vorstellungsleistung, die das Gehirn immer wieder mit den Meldungen unserer Sinneszellen konfrontiert und interpoliert.[36] Konfrontieren mit den Daten aus der Wirklichkeit – das ist etwas, was die Schule zu üben hat. Wäre nichts da, was sie konfrontieren kann, hätte sie nichts zu tun. Die Schule muß auf den Vorleistungen der Kinder aufbauen.[37] Sie braucht ihnen das Einbilden nicht erst beizubringen, das können sie, seit sie ‚zur Welt gekommen’ sind. Aber der Einbildungskraft das Material zeigen, an dem sie sich herausbilden kann – das könnte sie, und dafür ist sie da. Das ist der Grund der Schule, da muß sie anfangen. Zuerst geht es um Fülle, da gibt’s gar kein Verschwenden. Für Genauigkeit ist später Zeit. Erst kommt Pädagogik. Didaktik kann warten: Eins nach dem andern.
Erfolg
Klipperts System wird der Bestimmung der Grund-Schule nicht gerecht, weil es lediglich das Pauken von ‚Fakten’ durchs Pauken von ‚Methoden’ ersetzt, statt die Einbildungskraft zu stacheln. Das ist den Aufwand nicht wert. Es hat seine entscheidende Prüfung nicht bestanden.
Dennoch berichten seine Adepten von ihren Erfolgen gerade in der Grundschule! [38] Und man darf ihnen ruhig glauben. Wann immer ein Pädagoge mit Überzeugung – egal wovon – zu Werke geht, wird er bei seinen Zöglingen ganz andern Erfolg haben als einer, der nur seine Routine runterspult. Insofern ist jede neue Methode ein “Fortschritt”: jedesmal wieder. Und verweist uns auf das, was wir immer schon wußten und was die Methodenfetischisten peinlichst verdrängen wollen: Die Pädagogen sind es, auf die es bei der Pädagogik ankommt.
Was gemacht wird und wer es macht, das gehört zusammen – ein Wie hat sich noch immer gefunden. Dumm ist nur, daß Klipperts Methode so angelegt ist, daß sie die Bedingung für diesen ihren Erfolg “kleinschrittig” selber untergräbt: Zweck ist ja Routinebildung - erklärtermaßen nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern! Am Ende werden sie ihre Schüler wieder genauso langweilen wie vor Klippert. Dann ist, wie bei so mancher Unterrichtsreform, außer Spesen auch diesmal nichts gewesen.
 Wenn
zwar der gegenwärtige Erfolg der Klippert-Methode bei den Schülern
nicht überrascht, fragt sich immer noch: woher der Erfolg bei den
Lehrern? Ein Grund liegt auf der Hand: Das ist kein Hochschullehrer, der
seine Weisheit aus fremder Leute Büchern schöpft, sondern hier spricht
einer aus der Praxis für die Praxis. Eine gewisse Laxheit in
theoretischen Dingen sieht man ihm wohl nach.
Wenn
zwar der gegenwärtige Erfolg der Klippert-Methode bei den Schülern
nicht überrascht, fragt sich immer noch: woher der Erfolg bei den
Lehrern? Ein Grund liegt auf der Hand: Das ist kein Hochschullehrer, der
seine Weisheit aus fremder Leute Büchern schöpft, sondern hier spricht
einer aus der Praxis für die Praxis. Eine gewisse Laxheit in
theoretischen Dingen sieht man ihm wohl nach. Die ausführlichste Begründung seines Systems gibt Klippert, soweit ich sehe, in Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, S. 1-88. Lernforschung, Hirnforschung, Jugendforschung, Arbeitssoziologie, Konstruktivismus (PISA nicht zu vergessen) – er heizt mit jedem Holz. Für den Kritiker enttäuschend, kennzeichnet dieser Eklektizismus aber auch Klipperts stärkste Seite: Das ist alles nicht aus Begriffen konstruiert, sondern stammt direkt aus eigener Erfahrung; die Begründungen kamen hinterdrein.
Vielleicht ist es so, daß mit den Erfolgen auch die Widerstände wachsen. Dann muß man immer wieder eins draufsatteln; jedenfalls hat sich im Lauf der Jahre sein reiches Repertoire geistvoller Unterrichtseinfälle “kleinschrittig” zu einem regelrechten didaktischen System ausgewachsen. Was als Lose-Blatt-Sammlung[39] eine Bereicherung des Schulalltags und ein Elixier gegen die tödliche Langeweile wäre, riskiert als ‚systematische’ Routine zu einem Friedhof der Einbildungskraft zu werden.
Da regt sich ein Verdacht. Könnte es sein, daß der Erfolg der Klippert-Methoden bei den Lehrern auch darauf beruht: Man hat das gute Gefühl, man tut was für den Offenen Unterricht – und muß ihn doch nicht selber praktizieren? Klippert wirbt schließlich damit, daß sein Verfahren “ohne revolutionäre Umstellungen und unkalkulierbare Risiken gewagt werden kann”…[40]
Arbeitswelten
Pädagogik ist aber ohne Risiko nicht zu haben. Knaben müßten gewagt werden, meinte Herbart.[41] Und wer alle Risiken vorher “kalkulieren” will, der will keine – und das ist unter den Risiken der Pädagogik das größte; da darf er sich dann nicht beklagen, wenn er’s in diesem Beruf schwer hat. Pädagogik ist eben keine ‚Methode’, die man nur noch anwenden muß – das ist das ganze Problem. Das war schon immer das Problem. Allerdings hat es sich heute zugespitzt wie nie, und das liegt an den Veränderungen der Arbeitswelt, da hat Klippert ganz recht.
 Nicht
so sehr die Veränderungen bei der industriellen Fertigung sind der
Grund. Denn Leitbild der Volksschulpädagogik war im 20. Jahrhundert gar
nicht der Industriearbeiter. Das war er im Neunzehnten, und der damalige
Fabrikarbeiter war typischerweise ungelernt. Entsprechend ‚elementar’
konnte seine Bildung sein: ABC, 1×1
und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der
eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in
der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie
ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.
Und für die Volksschule hieß das: Schema F.
Nicht
so sehr die Veränderungen bei der industriellen Fertigung sind der
Grund. Denn Leitbild der Volksschulpädagogik war im 20. Jahrhundert gar
nicht der Industriearbeiter. Das war er im Neunzehnten, und der damalige
Fabrikarbeiter war typischerweise ungelernt. Entsprechend ‚elementar’
konnte seine Bildung sein: ABC, 1×1
und 10 Gebote. Im 20. Jahrhundert wurde mit dem Überwuchern der
eigentlichen Produktion durch die Verwaltung[42] der Angestellte auch in
der Industrie immer mehr zum Leitbild. Nicht der Geist der Industrie
ist es, der seither Alles durchdringt, sondern der Geist der Bürokratie.
Und für die Volksschule hieß das: Schema F.Das humanistische Gymnasium war auf den höheren Staatsdienst zugeschnitten. Die Realschulen bedienten ‚die Wirtschaft’. Als dort an die Stelle des Unternehmers als Maßstab der Leitende Angestellte trat, wurden die Realien dem (enthumanisierten) Gymnasium zugeschlagen, und so konnte es während der ‚demokratischen’ Bildungsreform der 70er Jahre zur allgemeinen Norm überdehnt werden[43] – auf die “Restschule” gehn die Zurückgebliebenen.
Ein Standard für alle – der Traum jeder Verwaltung! Das Bildungssystem ‚normalisierte’ sich zu einer großen Administration – mit dem Gymnasium als ihrem ‚höheren Dienst’. Daran wird die Grundschule seither gemessen. Die Neigung unserer Schulen zum Zergliedern der Welt in ‚Fächer’ und des Lebens in ‚Schritte’ stammt nicht, wie man meinen mag, aus der Arbeitsteilung in der Fabrik, sondern aus den ‚Vorgängen’ der bürokratischen Apparate. Das Wie ist dort Substanz, das Was nur Akzidenz, und der Routinier (”im besten Sinne des Wortes”) ist König. Diesen Zustand will die Klippert-Schule anscheinend optimieren.
 Daß
aber die Verwaltung neben der Zivilgesellschaft steht (d.h. wie ein
Mühlstein an ihrem Hals hängt), war mittelbar durchaus ein Resultat der
industriellen Arbeitsteilung. Je weiter die Produktion in Fächer und
Abteilungen aufgesplittert wurde, umso mehr Spezialisten fürs
Koordinieren wurden gebraucht, um die Einzelteile schließlich zueinander
zu fügen: Das Vermitteln wurde selbst zu einem ‚Fach’! Mit dem
Niedergang der Industriegesellschaft geht auch die Zeit der
Fachleute-für-Vermittlung zu Ende. Lean management ist angesagt.
Daß
aber die Verwaltung neben der Zivilgesellschaft steht (d.h. wie ein
Mühlstein an ihrem Hals hängt), war mittelbar durchaus ein Resultat der
industriellen Arbeitsteilung. Je weiter die Produktion in Fächer und
Abteilungen aufgesplittert wurde, umso mehr Spezialisten fürs
Koordinieren wurden gebraucht, um die Einzelteile schließlich zueinander
zu fügen: Das Vermitteln wurde selbst zu einem ‚Fach’! Mit dem
Niedergang der Industriegesellschaft geht auch die Zeit der
Fachleute-für-Vermittlung zu Ende. Lean management ist angesagt.Das Vermitteln wird in der medialen Zivilisation (daher der Name) wieder zum genuinen Bestandteil der Schaffensprozesse selbst; online. Wozu also optimieren, was schon jetzt ein Anachronismus ist? Die Arbeitswelt der Zukunft wird immer weniger von Leitenden Angestellten geprägt sein und immer mehr von selbst-entwerfenden und selbst-realisierenden ‚Unternehmern’. Wozu hätte sich ein heutiger Abiturient durch einem Notendurchschnitt von 1,0 denn ‚qualifiziert’? Für eine eigne Performance in den globalen Netzen ja nicht gerade. Eher doch für eine leitende Stelle im höheren Staatsdienst. Nur – eine sehr realistische Berufswahl ist das bald nicht mehr.
Wie oder was
Es geht gar nicht mehr darum, wie man sich das ‚Lernen’ vorstellt, sondern darum, was man unter ‚Wissen’ versteht. Die hergebrachte Lernschule stellt sich das Wissen als ein gut sortiertes Regal von eingeweckten Wahrheiten (‚Informationen’) vor, auf die “zuzugreifen” nur noch geübt werden müßte. Das entspricht keiner industriellen, sondern einer bürokratischen Welt-Sicht. Ein Offener Unterricht, der darauf beruht, ist – mit oder ohne vorherige Methodengymnastik – allerdings ein Paradox, und die Schüler boykottieren in zu recht.
Wer glaubt, daß die Welt schon entdeckt ist, dem werden die Kinder nicht abnehmen, daß es für sie da was zu entdecken gäbe. Er versäumt nicht etwa, sie zu “motivieren”, sondern er bricht geradezu ihr ureigenes originäres Motiv. Bei ihm sind sie immer zu spät gekommen. Aber das ist nicht wahr, das sind sie nicht.[44] Die Welt ist nicht entdeckt, es konstruiert ein jeder ‚seine’ Welt.
Daß es darüberhinaus eine ‚objektive’ Welt gibt, zu welcher die Einzelnen ihre Privatwelten ‚ins Verhältnis setzen’, liegt daran, daß sie in ihrem Alltag miteinander auskommen müssen. Unsere gemeinsamen Ansichten von der Welt stammen aus gemeinsamen Absichten in der Welt – die nämlich zu gemeinsamen Hinsichten auf die Welt veranlassen.[45] Und da wir nicht alle unsere Absichten mit andern teilen, teilen wir auch nicht alle unsere Ansichten. Ob oder ob nicht, das weiß man nicht im Voraus, man muß es drauf ankommen lassen. Darum kann man die Risiken der Pädagogik nicht “kalkulieren”!
Über die ‚wahren’ Ansichten entscheiden also die Hinsichten und die Absichten. Es ist eine Sinn-Frage, und sie ist keine theoretische, die sich durch ‚Lernen’ beantworten ließe, sondern eine praktische, die “aus Freiheit” zu entscheiden ist; nämlich jedesmal aufs Neue. Aufs Urteilsvermögen kommt es an. Das bedeutet, daß der Grund der Schule – das, worauf sie aufbaut – nicht Wissensbevorratung und Methodenturnen ist, sondern die Unterhaltung (!) der Einbildungskraft und das Wagen des eigenen Urteils.[46] Die Daseinsberechtigung der Grund-Schule ist Bildung. Um es ganz genau zu sagen: Geschmacks-Bildung.[47]
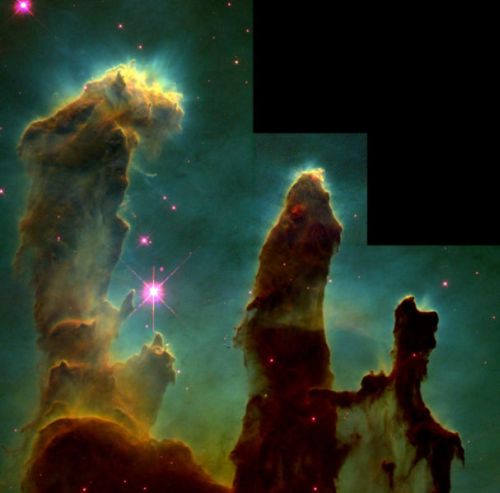
Und wer!
Der Lehrer muß selber gesehen haben, was er den Kindern zeigen will. Das ist nicht die Frage, wie er’s macht, sondern wer er ist; nämlich was er aus sich gemacht hat.[48] Und so soll zum Schluß Heinz Klippert das Lob zuteil werden, das er verdient. Der sachliche Kern von seinem methodischen Outfit sind seine Übungsblätter, und die sind (fast alle) ausgefallen und pfiffig. Mancher denkt zwar: Das muß ein rechter Kindskopp sein, dem sowas überhaupt einfällt. Aber das macht gerade den Unterschied aus zwischen dem Pädagogen und den Vielen, die ihren Beruf verfehlt haben.
Pädagogik ist eine Kunst. Sie besteht darin, daß ein Alter in die Welt mit den Augen der Neuen sehen kann und trotzdem nicht vergißt, was er alles vorher selber schon gesehen hat – und es den Neuen zeigt. Klippert scheint das zu können. Aber wo so viele andere es nicht können, da wird auch seine “Methode” nix helfen. Kunst kommt von Können, hat Max Liebermann gesagt. Denn käm’s von Wollen, dann hieße es Wulst. Das gilt für unsere Kunst noch mehr als für die andern.
_________________________________________________________
[1] Heinz Klippert, Frank Müller: Methodenlernen in der Grundschule; Weinheim-Basel (Beltz) 2003, S. 9 (im Folgenden zit. als GS)
[2] Die Kampagne begann 1994 mit: Methoden-Training (bei Beltz/Weinheim-Basel); seither erscheint jedes Jahr ein neues Buch. Eine Quintessenz bietet: Heinz Klippert, Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, Weinheim-Basel 2000, insbes. S. 10-86 (im Folgenden zit. als EVA).
[3] Wir sind die ersten. Unser Interesse ist allerdings auch mehr pädagogisch als erziehungswissenschaftlich.
[4] GS S. 28
[5] EVA S. 11f.
[6] GS S. 67
[7] GS S. 43
[8] EVA S. 3
[9]GS S. 21-24
[10] ebd. – In fast denselben Worten äußerte sich Hartmut von Hentig allerdings schon über die Kinder seiner Zeit… vor dreißig Jahren! (im Vorwort zu Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, München 1975, S. 32)
[11] EVA S. 20
[12] ebd.
[13] EVA S. 28
[14] GS S. 26
[15] GS S. 79
[16] EVA S. 54
[17] GS S. 9
[18] GS S. 25
[19]GS S. 41
[20]GS S. 25
[21]EVA S. 58
[22] EVA S. 31
[23] EVA S. 39
[24]GS S. 12
[25]GS S. 11
[26] ebd.
[27]GS S. 37
[28] GS S. 47 u.a. – Welch großen Wert K. auf Redundanz legt, sieht man in seinen Büchern auf jeder Seite.
[29] GS 12
[30]EVA S. 10
[31] s. Anm. 29!
[32] GS S. 46
[33] ebd.
[34] Wolf Singer, Ein neues Menschenbild?, Frankfurt a.M. 2003; S. 67-86
[35] Ernst Pöppel, Lust und Schmerz, München 1995, S. 187-193
[36]s. hierzu J. Ebmeier, Von der PISA-Studie und der Neurobiologie des Lernens, s. o.
[37] auf ihre Stärken achten statt auf ihre “Defizite”
[38] NRW ist die Hochburg der Klippert-Schule.
[39] EVA empfahl sich noch als “Ideensammlung”, “Methodenpool”, “Steinbruch” und “Börse” (S. 65, 73). An der Grundschule angekommen, ist jetzt ein Kanon draus geworden.
[40] EVA S. 67
[41] Joh. Fr. Herbart, Allgemeine Pädagogik, Bochum 1965, S.
[42] vgl. James Burnham, Managerial Revolution (1941) und die folgenden Debatten über Totalitarismus und die ‚Konvergenz der Systeme’
[43] Seither hat sich die Zahl der Beamten in Deutschland verdreifacht.
[44] vgl. A. Schopenhauer auf diesen Seiten…
[45] s. hierzu J. Ebmeier, Die Grenzen der pädagogischen Vernunft in: PÄD Forum 3/03, S. 177
[46] Wenn wir an PISA denken: Da liegt auch die Wurzel der Klassen-Benachteiligung; nicht bei der Informations-Menge.
[47] Kants Kritik der Urteilskraft hieß im Entwurf “Kritik des Geschmacks”; s. hierzu J. Ebmeier, Herbarts Einsicht; in PÄD Forum 5/03
[48] mhd. der wer : der Mann, Mensch; vgl. mhd. diu werelt (engl. the world): Gegend, wo die Menschen leben; was: lat. quale; die Washeit: lat. qualitas

PISA testet nicht das Schulwissen der jungen Leute, sondern ihre “Fähigkeit zur Welterschließung”. Die wird – das ahnen schon Vorschulkinder – nicht bloß von der Schule geprägt; und nicht einmal vor allem. Ausschlaggebend ist das kulturelle Milieu, in das die jungen Menschen hinein wachsen. Natürlich kann die Schule weder “Migrationshintergrund” noch deutsche Arbeitnehmermentalität “kompensieren”. Dass man das heut von ihr erwartet, verdankt sie nur ihrer ewigen Wichtigtuerei.
Wieso sind aber die Gefälle bei uns so viel krasser als in andern Ländern? Die Immigranten in England und Frankreich kommen aus Ländern, die ihrer Gastnation seit Jahrhunderten kulturell verbunden sind. Dort gehört es bis heute zum guten Ton unter den Gebildeten, in der Kultur der früheren Kolonialmacht zu Hause zu sein. Was dagegen hatten die Türken mit Deutschland gemein, bevor sie hier her kamen?! Kaum ein Algerier kam in die Pariser Banlieue, kaum ein Inder nach Ostlondon, der nicht schon einige Sätze der Landessprache sprach. Aber so kamen und kommen Türken nach Kreuzberg.
Und in keinem andern Land Europas – ich denke: der Welt – hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unter der ‘werktätigen Bevölkerung’ eine solche Geistverachtung, eine solche Intelligenzfeindschaft breit machen können wie im Wirtschaftwunderland BuRep. Solln sie sich mal alle fragen – von den Sozis bis zur GEW -, wer damals alles mit in dieses Horn getutet hat; und wer wirft dann den ersten Stein?
Im Osten gab’s sowas nicht. Und überall dort, wo sie nach und nach die DDR hinter sich lassen, holen sie mittlerweile auf. Nicht in Stolpes “kleiner DDR” Brandenburg, nicht in Berlin, wo selbst der Westen in Gestalt seines Öffentliches Dienstes seine ‘innere DDR’ gehabt hat – und bis heute hat. „Es war nicht alles schlecht“, und so soll es bleiben…
Nicht auf die ‘Strukturen’, ‘Methoden’und ‘Systeme’ kommt es bei der Bildung an. Sondern auf die kulturelle Gesamtsituation. Die wird von PISA beleuchtet. Nix Neues unter der Sonne…

Vorgänger: Johann Friedrich Herbart
Für pädagogischen Takt und gegen die Schule
Mit seiner Allgemeinen Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet
hat es Johann Friedrich Herbart 1806 als erster unternommen, die
Pädagogik zu einer systematischen Wissenschaft auszuarbeiten, indem er
ihren logischen Grund bestimmte und ihre Grenzen beschrieb. Heut ist er
fast vergessen. Zum einen, weil die Dilthey-Schule, die in der Pädagogik
der Bundesrepublik bis in die 1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den
Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das
gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)
Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil
verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in
Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er
heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!
1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den
Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das
gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)
Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil
verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in
Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er
heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!
 1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den
Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das
gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)
Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil
verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in
Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er
heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!
1960er Jahre den Ton angab, seinen Gegenspieler Schleiermacher in den
Vordergrund schob, den wir im vorigen Beitrag vorgestellt haben. Das
gelang ihr umso leichter, als zum andern die sogenannten Herbartianer(1)
Herbarts Lehren in wesentlichen Punkten in ihr gerades Gegenteil
verkehrt, und damit die Entwicklung v. a. des Elementarunterrichts in
Deutschland nachhaltig beeinflußt hatten. Ihnen verdankt Herbart, daß er
heute als der Begründer der Lernschule verschrien ist – während er selber doch bis ans Lebensende ein Gegner der Schule war!
1776
geboren, hatte er in Jena bei Fichte studiert, hatte bald mit der
Kritischen Philosophie gebrochen und war seit 1802 Professor in
Göttingen, seit 1809 in Königsberg auf dem Lehrstuhl Kants, wo er von
amtswegen mit der Reform des ostpreußischen Bildungswesens befaßt war,
und kehrte 1833 wieder nach Göttingen zurück, wo er 1841 starb. Sein
pädagogisches Ideal war der Hauslehrer, der diesen Beruf nur als junger
Mensch, vorübergehend und mit Begeisterung ausübt. Von einem besondern
Stand routinierter Berufspädagogen erwartete er nichts Gutes. Erziehung
war für ihn ein individuelles, persönliches Geschehen, das sich nicht
institutionalisieren und schon gar nicht politisieren läßt. Das Kind ist
Maß, nicht der Lehrplan.
Mit der Massenanstalt Schule hat er sich, auf beßre Zeiten hoffend, nur widerwillig abgegeben – als Notbehelf. Er mochte sie nicht, weil erstens zuviel Staat drinsteckt, weil sie zweitens als Institution zu viele verfälschende Eigeninteressen entwickelt, und weil er drittens von der künstlichen Zusammenballung von Kindermassen in einer Zwangsanstalt die Potenzierung nicht der guten, sondern nur jener unguten Eigenschaften erwartete, die Kinder schließlich auch noch haben.Obwohl politisch stockkonservativ, konnte er nicht leugnen, daß eine allgemeine Volksbildung ohne Schulpflicht nicht auskäme, aber irgendwie wollte er sie doch mit der Hauslehrerei kombinieren.
Es geht es nicht darum, Herbarts Lehre “wiederzuentdecken”. Zum einen blieb sie von sozialökonomischen Erwägungen ganz unberührt. Zum andern gründet sie in einer Metaphysik, die schon zu seiner Zeit ein Anachronismus war, und in einer nicht minder spekulativen Psychologie.2 Doch manches klingt hochaktuell. Denn zum Glück sind seine pädagogischen Darlegungen längst nicht so “systematisch”, wie er selber dachte. Neben mancher gewaltsamen Konstruktion steht dort eine Fülle von hellsichtigen Beobachtungen, die aus lebendiger Anschauung stammen und nicht aus doktrinärem Räsonnement. Sie sind leidenschaftlich geprägt von seiner eignen Hauslehrerzeit in Bern, wo er 1797-1800 die Söhne eines Patriziers zu erziehen hatte – und dabei erfahren konnte, wie schnell der Pädagoge auf Holzwege kommt, wenn er sich überschätzt..
Und schließlich spürt man unter seinem trocknen Witz überall, daß er – ja wie soll ich sagen? – “ein Herz für Kinder” hatte, worin ihm eine eigne Kindlichkeit erhalten blieb.
.
Wollten wir nur sämtlich bedenken: daß nur jeder erfährt, was er versucht! Ein neunzigjähriger Dorfschulmeister hat die Erfahrung seines neunzigjährigen Schlendrians; er hat das Gefühl seiner langen Mühe; aber hat er auch die Kritik seiner Leistungen und seiner Methoden? (X,8)
.
Der logische Grund der Pädagogik ist ihr Zweck. Desto
notwendiger ist das, wovon ich ausging, zu wissen nämlich, was man
will, indem man die Erziehung anfängt! Man sieht, was man sucht:
psychologischen Blick hat jeder gute Kopf – insofern, als ihm daran
gelegen ist, menschliche Gemüter zu durchschauen. Doch
mit welcher Absicht der Erzieher sein Werk angreifen soll: diese
praktische Überlegung [...] ist mir die erste Hälfte der Pädagogik.
Gegenüber sollte eine zweite stehen, in welcher die Möglichkeit der
Erziehung theoretisch erklärt und nach der Wandelbarkeit der Umstände
dargestellt würde.3 (X,7) Man
könnte – und dürfte auch – so viele Aufgaben der Erziehung annehmen,
als es erlaubte Zwecke des Menschen gibt. Dann aber gäbe es so viele
pädagogische Untersuchungen, als Aufgaben; dann würden diese
Untersuchungen außer ihrem gegenseitigen Verhältnis angestellt; man sähe
weder, wie sich die einzelnen Maßregeln des Erziehers beschränken
müßten, noch wie sie sich befördern könnten. Soll es möglich sein, das
Geschäft der Pädagogik als ein einziges Ganzes durchgreifend richtig zu
durchdenken und planmäßig auszuführen, so muß es vorher möglich sein,
die Aufgabe der Erziehung als eine einzige aufzufassen. Man kann die
eine und ganze Aufgabe der Erziehung in den Begriff Moralität fassen. –
Aber Moralität als ganzen Zweck des Menschen und der Erziehung
aufzustellen, dazu bedarf es einer Erweiterung des Begriffs derselben. (XI,113f.)
.
Als
Philosoph unterschied H. zwei Betrachtungsweisen der Welt. Der
Metaphysik begegnen Dinge, die sich ableiten und analysieren lassen. Der
Ästhetik begegnet nur Einzelnes, das als solches nicht ohne ein
notwendiges Gefühl des Beifalls oder der Ablehnung wahrgenommen werden
kann. Moralität ist die Anwendung ästhetischer Urteile auf Willensakte;
der erweiterte Begriff der Moralität ist, umgekehrt, Ästhetik.
Was ohne Erziehung aus einem Menschen werden mochte, das hing an dem psychologischen Zufall: ob er sich eher vertiefe in die Berechnungen des Egoismus, oder in die ästhetische Auffassung der ihn umgebenden Welt. Dieser Zufall soll nicht Zufall bleiben. Der Erzieher soll den Mut haben, vorauszusetzen: er könne, wenn er es recht anfange, jene Auffassung durch ästhetische Darstellung der Welt früh und stark genug determinieren! Eine solche Darstellung der Welt, der ganzen bekannten Welt, und aller bekannten Zeiten – diese möchte wohl mit Recht das Hauptgeschäft der Erziehung heißen. (XI,225)
Stellt
Kindern das Schlechte dar, deutlich, nur nicht als Gegenstand der
Begierde: sie werden finden, daß es schlecht ist. Unterbrecht die
Erzählung durch moralisches Räsonnement: sie werden finden, daß ihr
langweilig erzählt. Stellt lauter Gutes dar: sie werden fühlen, daß es
einförmig ist, und der bloße Reiz der Abwechslung wird ihnen das
Schlechte willkommen machen. [...] Aber gebt ihnen eine interessante
Erzählung, reich an Begebenheiten, Verhältnissen, Charakteren [...]: Ihr
werdet sehen, wie die kindliche Aufmerksamkeit darin wurzelt, wie sie
noch tiefer hinter die Wahrheit zu kommen und alle Seiten der Sache hervorzuwenden sucht: wie der mannigfal-tige Stoff ein mannigfaltiges Urteil anregt, wie der Reiz der Abwechslung in das Vorziehen des Besseren endigt (X, 40)
Denn der Knabe unterscheidet, so gut wie wir, das Gemeine und Flache
von dem Würdevollen; ja dieser Unterschied liegt ihm mehr als uns am
Herzen, denn er fühlt sich ungern klein, er möchte ein Mann sein! [...]
Solche Männer nun, deren der Knabe einer sein möchte, stellt ihm dar.
Die findet ihr gewiß nicht in der Nähe, denn dem Männerideal des Knaben
entspricht nichts, was unter dem Einfluß der heutigen Kultur erwachsen
ist. (X,14f.)
Darf eine Allgemeine Pädagogik so hochgemut sein, muss sie nicht vielmehr von “Defiziten” ausgehen?
Aber nichts verwehrt mir die Hoffnung, die gute Natur gesunder Knaben sei gar nicht als eine Seltenheit zu betrachten, sondern werde den meisten Erziehern wie mir zustatten kommen. (X,16)
Ist Erziehung Wissenschaft oder Kunst?
Unterscheiden Sie zuvörderst die Pädagogik als Wissenschaft von der Kunst der Erziehung. Was ist der Inhalt einer Wissenschaft? Eine Zusammenfassung von Lehrsätzen, die ein Gedankenganzes ausmachen, die womöglich aus einander, als Folgen von Grundsätzen, und als Grundsätze aus Prinzipien hervorgehen. Was ist eine Kunst? Eine Summe von Fertigkeiten, die sich vereinigen müssen, um einen gewissen Zweck hervorzubringen. Die Wissenschaft also erfordert Ableitung von Lehrsätzen aus ihren Gründen, philosophisches Denken; die Kunst erfordert stetes Handeln[...], sie darf während ihrer Ausübung sich in keine Spekulation verlieren; der Augenblick ruft ihre Hilfe, tausend widrige Begebnisse fordern ihren Widerstand herbei.(XI,66)
 In
der Schule der Wissenschaft wird für die Praxis immer zugleich zu viel
und zu wenig gelernt, und eben daher pflegen alle Praktiker in ihren
Künsten sich sehr ungern auf eigentliche, gründlich untersuchte Theorie
einzulassen. Sie
lieben es weit mehr, das Gewicht ihrer Erfahrungen und Beobachtungen
gegen jene geltend zu machen. Dagegen ist dann aber auch schon bis zur
Ermüdung oft und weitläufig bewiesen, auseinandergesetzt und wiederholt worden,
daß bloße Praxis eigentlich nur Schlendrian und eine höchst
beschränkte, nichts entscheidende Erfahrung gebe; daß erst die Theorie
lehren müsse, wie man durch Versuch und Beobachtung sich bei der Natur
zu erkundigen habe, wenn man ihr bestimmte Antworten entlocken wolle.
Das gilt denn auch im vollsten Maße von der pädagogischen Praxis. (XI, 67)
In
der Schule der Wissenschaft wird für die Praxis immer zugleich zu viel
und zu wenig gelernt, und eben daher pflegen alle Praktiker in ihren
Künsten sich sehr ungern auf eigentliche, gründlich untersuchte Theorie
einzulassen. Sie
lieben es weit mehr, das Gewicht ihrer Erfahrungen und Beobachtungen
gegen jene geltend zu machen. Dagegen ist dann aber auch schon bis zur
Ermüdung oft und weitläufig bewiesen, auseinandergesetzt und wiederholt worden,
daß bloße Praxis eigentlich nur Schlendrian und eine höchst
beschränkte, nichts entscheidende Erfahrung gebe; daß erst die Theorie
lehren müsse, wie man durch Versuch und Beobachtung sich bei der Natur
zu erkundigen habe, wenn man ihr bestimmte Antworten entlocken wolle.
Das gilt denn auch im vollsten Maße von der pädagogischen Praxis. (XI, 67) Daher, wer ohne Philosophie an die Erziehung geht, sich so leicht einbildet, weitgehende Reformen gemacht zu haben, indem er ein wenig an der Manier verbesserte! Nirgends ist philosophische Umsicht durch allgemeine Ideen so nötig als hier, wo das tägliche Treiben und die sich so vielfach einprägende individuelle Erfahrung so mächtig den Gesichtskreis in die Enge zieht. Nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoretiker, wenn er seine Theorie ausübt, zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein, ein gewisser
 Takt
nämlich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht, wie der
Schlendrian, ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht sich rühmen
darf, bei strenger Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel,
zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gerade
zu treffen.
Takt
nämlich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht, wie der
Schlendrian, ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht sich rühmen
darf, bei strenger Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel,
zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gerade
zu treffen. Eben weil zu solcher Besonnenheit [...] ein übermenschliches Wesen erfordert würde, entsteht unvermeidlich in dem Menschen, wie er ist, aus jeder fortgesetzten Übung eine Handlungsweise, welche zunächst von seinem Gefühl abhängt, worin er mehr der inneren Bewegung Luft macht, mehr ausdrückt, wie von außen auf ihn gewirkt sei, mehr seinem Gemütszustand als das Resultat seines Denkens zu Tage legt. Es ist nötig,daß der Takt in die Stelle eintrete, welche die Theorie leer ließ, und so der unmittelbare Regent der Praxis werde.[...] Die große Frage nun, an der es hängt, ob jemand eine guter oder schlechter Erzieher sein werde, ist einzig diese: wie sich jener Takt bei ihm ausbilde? (XI,68f.)
Er
bildet sich erst während der Praxis. Er bildet sich durch die
Einwirkung dessen, was wir in dieser Praxis erfahren, auf unser Gefühl.
[...] Auf diese unsere Stimmung sollen und können wir wiederum
durch Überlegung wirken. [...] Durch Überlegung, durch Nachdenken,
Nachforschung, durch Wissenschaft soll der Erzieher vorbereiten – nicht
sowohl seine künftigen Handlungen in einzelnen Fällen, als vielmehr sich
selbst, sein Gemüt, seinen Kopf und sein Herz zum richtigen Aufnehmen,
Auffassen, Empfinden und Beurteilen der Erscheinungen, die seiner
warten, und der Lage, in die er geraten wird. [...]
Es
gibt eine Vorbereitung auf die Kunst durch die Wissenschaft. Im Handeln
nur erlernt man die Kunst, erlangt man Takt, Fertigkeit, Gewandtheit,
Geschicklichkeit. Aber selbst im Handeln lernt die Kunst nur der,
welcher vorher die Wissenschaft gelernt [...] und die künftigen
Eindrücke, welche die Erfahrung auf ihn machen sollte, vorbestimmt
hatte. (XI,69f; XI,66-70)
Wer soll erziehen, und warum soll er es wollen?
Ein junger Mann, der empfindlich ist gegen den Reiz der Ideen, und der die Idee der Erziehung in ihrer Schönheit, in ihrer Größe vor Augen hat; der endlich dem mannigfaltigsten Wechsel von Hoffnung und Zweifel, Verdruß und Freude sich eine Zeitlang preiszugeben nicht scheut – dieser kann es unternehmen, einen Knaben zu einem besseren Dasein emporzuheben, wenn er diese Wirklichkeit als Fragment des großen Ganzen nach menschlicher Weise anzuschauen und darzustellen Denkkraft und Wissenschaft besitzt. Er wird sich dann von selbst sagen, daß nicht er, sondern die ganze Macht all dessen, was Menschen je empfanden, erfuhren und dachten, der wahre und rechte Erzieher ist, der seinem Knaben gebührt, und welchem er zur verständigen Deutung und zur anständigen Begleitung nur beigegeben wurde. Das ist das Höchste, was die Menschheit in jedem Moment ihrer Fortdauer tun kann, daß sie den ganzen Gewinn ihrer bisherigen Versuche dem jungen Anwuchs konzentriert darbiete, sei es als Lehre, sei es als Warnung. (X,7)
 Aber er wird die Stimmung und Aufmerksamkeit eines jugendlichen Gemüts
nicht lenken, ohne die Freiheit seiner eigenen Stimmung größtenteils zu
opfern! Mit stetem, kalten Gleichmut – wie sollte er doch in den
Knaben, der für sich selbst im Mittagslichte der Sorglosigkeit und
wachsender Körperkräfte wandelt, die feinen Schattierungen geistiger
Bewegungen bringen, ohne welche es keine rege Teilnahme, keinen lauteren
Geschmack, ja selbst
keinen wahren Scharfsinn noch Beobachtungsgeist geben kann? Und die
wenigsten Naturen gehen von selbst aus der Flachheit heraus, welche das
ausmacht, was wir gemein nennen; die
wenig-sten können den Geist der Unterscheidung, welchem es zukommt, zu
bilden nach innen und nach außen – anders als mitgeteilt empfangen. Der
Erzieher muß daher den Knaben aufstören, indem er in ihm unterscheidet;
er muß ihm sein Bild zurückwerfen, begabt mit der dehnenden und der
hemmenden Kraft, welche den in eigener Bildung begriffenen Menschen
treibt und drängt. Diese Kraft, woher näme er sie, als aus seiner
eigenen, bewegten Seele?
Aber er wird die Stimmung und Aufmerksamkeit eines jugendlichen Gemüts
nicht lenken, ohne die Freiheit seiner eigenen Stimmung größtenteils zu
opfern! Mit stetem, kalten Gleichmut – wie sollte er doch in den
Knaben, der für sich selbst im Mittagslichte der Sorglosigkeit und
wachsender Körperkräfte wandelt, die feinen Schattierungen geistiger
Bewegungen bringen, ohne welche es keine rege Teilnahme, keinen lauteren
Geschmack, ja selbst
keinen wahren Scharfsinn noch Beobachtungsgeist geben kann? Und die
wenigsten Naturen gehen von selbst aus der Flachheit heraus, welche das
ausmacht, was wir gemein nennen; die
wenig-sten können den Geist der Unterscheidung, welchem es zukommt, zu
bilden nach innen und nach außen – anders als mitgeteilt empfangen. Der
Erzieher muß daher den Knaben aufstören, indem er in ihm unterscheidet;
er muß ihm sein Bild zurückwerfen, begabt mit der dehnenden und der
hemmenden Kraft, welche den in eigener Bildung begriffenen Menschen
treibt und drängt. Diese Kraft, woher näme er sie, als aus seiner
eigenen, bewegten Seele? Wie dem Erzieher wird, indem solche und andere Gesinnungen sich im Knaben hervortun: diese ihm nachzuempfinden ist das erste Ausgehen von der Rohheit und die unmittelbarste Wohltat der Erziehung. Aber es vorzuempfinden erfordert einen schmerzhaften Wechsel der eigenen Gefühle, der dem reifen Manne nicht mehr ziemt und nur demjenigen angemessen und natürlich ist, welcher sich selbst noch in der Periode des Ringens um Bildung befindet. Daher ist das Erziehen die Sache junger Männer in den Jahren, wo die Reizbarkeit gegen die eigene Kritik am höchsten und wo es in der Tat eine treffliche Hilfe ist, in dem Blick auf ein früheres Alter die unversehrte Fülle menschlicher Möglichkeiten vor sich zu haben, mit der ganzen Aufgabe, das Mögliche wirklich zu machen und mit dem Knaben sich selbst zu erziehen. (X,29f.)
Seine eigentliche Schule macht der Erzieher als Hauslehrer für einen oder zwei Zöglinge von beinahe gleichem Alter. Wer pädagogischen Künstlerberuf hat, dem muß in dem kleinen, dunklen Raum, in welchem er vielleicht anfangs sich eingeschlossen fühlt, bald so hell und so weit werden, daß er darin die ganze Pädagogik findet, mit all ihren Rücksichten und Bedingungen, welchen Genüge zu leisten eine wahrhaft unermeßliche Arbeit ist. So beginnt die Bildung des echten Erziehers. (XI,374)
Erziehung ist eine private Wechselwirkung zwischen Zweien. Doch wurde die Pädagogik immer wieder für äußere Zwecke in Dienst genommen, namentlich – von Plato bis Rousseau – für politische Absichten. Wenn wir aber die Pädagogik auf ihre eignen Füße stellen; wenn wir sie ansehn als die Wohltäterin der Einzelnen, deren jeder ihrer Hilfe bedarf, um das zu werden, was er einmal wünschen wird, geworden zu sein: alsdann verschwinden uns sogleich die Schulen; es
 verschwindet
die frühzeitige Zusammenhäufung der Kinder; denn jedes Individuum
bedarf der Erziehung für sich, und darum kann die Erziehung nicht wie in
einer Fabrik arbeiten; sie muß jeden Einzelnen vornehmen. Die Schule
erweitert nicht, sie verengt vielmehr die pädagogische Tätigkeit; sie
versagt die Anschließung an Individuen; denn die Schüler erscheinen
massenweise in der Schule; sie versagt den Gebrauch mannigfaltiger
Kenntnisse, denn der Lektionsplan schreibt dem einzelnen Lehrer ein paar
Fächer vor, worin er zu unterrichten hat; sie macht die feinere Führung
unmöglich, denn sie erfordert Wachsamkeit und Strenge gegen so viele,
die auf allen Fall in Ordnung gehalten werden müssen.
verschwindet
die frühzeitige Zusammenhäufung der Kinder; denn jedes Individuum
bedarf der Erziehung für sich, und darum kann die Erziehung nicht wie in
einer Fabrik arbeiten; sie muß jeden Einzelnen vornehmen. Die Schule
erweitert nicht, sie verengt vielmehr die pädagogische Tätigkeit; sie
versagt die Anschließung an Individuen; denn die Schüler erscheinen
massenweise in der Schule; sie versagt den Gebrauch mannigfaltiger
Kenntnisse, denn der Lektionsplan schreibt dem einzelnen Lehrer ein paar
Fächer vor, worin er zu unterrichten hat; sie macht die feinere Führung
unmöglich, denn sie erfordert Wachsamkeit und Strenge gegen so viele,
die auf allen Fall in Ordnung gehalten werden müssen. Wenn gleichwohl die Schulen bleiben, so bleiben sie als das, was sie sind, nämlich als Nothilfen, weil es so viele Zöglinge gibt und so wenige Erzieher. Bleibt nun aber auch das Übel, daß nicht einmal diese wenigen Erzieher zugleich Schullehrer sind, daß vielmehr die Schullehrer bloß nach Kenntnissen und nach derjenigen Art von Lehrgeschicklichkeit geschätzt und ausgewählt werden, die das Einzelne mitteilt, ohne sich um seine pädagogische Zusammenwirkung mit den Übrigen zu bekümmern – alsdann freilich sind die Schulen nicht einmal Nothilfen, sondern sie treten in völligen Gegensatz gegen die Erziehung, und sinken eben dadurch zur alltäglichen Gemeinheit herab. (XI,370;375;370)
1) v. a. Tuiscon Ziller (1817-1882) und Wilhelm Rein (1847-1929)
2) vgl. J. Ebmeier, “Herbarts Einsicht” auf diesen Seiten
3) Dies sei Sache der Psychologie – worunter er Denkpsychologie i. e. S. verstand.
______________________________________________________________________
Quelle: Johann Friedrich Herbart, Sämmtliche Werke, hg. v. G. Hartenstein, Hamburg u. Leipzig 2/1883ff.,Bde X u. XI (= Schriften zur Pädagogik)
Auswahl und Redaktion: J. Ebmeier
Die Schule war schon immer eine Emaskulieranstalt.

Gemälde von Claus Meyer, 1898
Jenes Institut, das sich heute unter dem Namen 'die Schule' über die ganze Welt verbreitet hat, ist in seinen Grundzügen in der Klöstern des mittelalterlichen Europa entstanden; als ein Ort, wo die von kriegerischen Rittern beherrschte Feudalgesellschaft mit der nötigen Dosis buchgelehrter Kleriker versehen wurde, die ein wenig Frieden bringen konnten - in die Herzen und, so Gott wollte, auch ein wenig in die Städte und Fluren. Sie waren mental gewissermaßen der 'weibliche' Teil in einer von männlichen Tugenden geprägten Adels- gesellschaft. Nicht, was vom heranwachsenden Ritter an männlichen Tugenden zu erwarten war, wurde dort gepflegt, sondern deren friedfertig ordnungsliebender Widerpart - Fleiß und Ausdauer. Die Mittel: stunden- langes Stillsitzen, Mundhalten, Nachsprechen und Repetieren. Während an den erstgeborenen Söhnen der herrschenden Kriegerkaste Kraft, Mut und Abenteuergeist gefördert wurden, mussten sich ihre nachgeborenen Brüder in Sanftmut, Frömmigkeit und - nun ja, Verschlagenheit üben. Die Schule war nicht - schon damals nicht - der Ort, wo Jungen Männer werden durften.
In dem Maße, wie die Gesellschaft bürgerlicher wurden, kamen neben den Jungenschulen auch Institute für Mädchen auf, und als die industrielle Revolution der neunzehnten Jahrhunderts die bäuerliche Bevölkerung zu Industriearbeitern proletarisierte, wurde die Elementarschule zur Pflicht und das pfäffische Ideal des arbeitsa- men Duckmäusers zur Norm. Für die Mädchen nun auch wie für die Jungen. Und beim Lehrpersonal der Volksschulen waren die Frauen bald typischer als die Männer.
Natürlich hat sich im zwanzigsten Jahrhundert allerhand getan, der industrielle Tagelöhner ist auch schon längst nicht mehr der Standardfall des Arbeitslebens. Der höherqualifizierte Angestellte, dem man auch schonmal eigene Entscheidungen zumuten konnte - idealiter: der Staatsbeamte - wurde zum Produktionsziel der allgemeinbildenden Schulen, und dazu taugen Mädchen mindestens ebeno wie Jungen; wenn nicht mehr!
Fragen Sie sich jetzt immer noch, wie es kam, dass unsere Schulen zur Vorbereitung weiblicher Karrieren in der postindustriellen Berufswelt besser geeignet sind als zur Entwicklung männlicher Talente? Die Schule war noch nie was für Jungen. Sie war immer was gegen Jungen.

Parteienkampf und Paradigmenwechsel
in: PÄDForum 4/2002
Ausfluchten
Wahlen sind der Elementarakt der Volkssouveränität. Daß im Wahlkampf die Schicksalfragen der Nation zur Sprache kommen, darf der Souverän erwarten. Nur Pharisäer konnten bedauern, daß die Veröffentlichung der PISA-E-Ergebnisse mitten ins Wahljahr fielen. Oder sollten angestammte Jagdgründe gegen äußere Einmischung geschützt werden? Etwas Besseres konnte der Pädagogik doch gar nicht passieren, als durch PISA zum Gegenstand öffentlichen Meinungskampfs zu werden.
Daß nicht immer alles rein sachlich zugehen würde, ließen zwar erste Indiskretionen befürchten. Doch als PISA-E dann offiziell war, fielen die Ergebnisse so unverhofft eindeutig aus, daß eine der beiden Parteien vorzog, rasch von ganz was anderm zu reden. Von Bayern lernen? Die wären ja im internationalen Vergleich auch nur gehobener Durchschnitt: „Ganz Deutschland schwimmt international unter Wasser, aber wir streiten darum, wer ertrinkt in ein Meter, zwei oder drei Meter Tiefe. Sind die süddeutschen Länder wirklich froh über die ersten Plätze in der 2. Liga?“ schrieb der niedersächsische Ministerpräsident (SPD).[1] Also, wenn wir uns schon geschlagen geben und an andern ein Vorbild nehmen müssen, dann doch nicht am Nachbarn von nebenan, sondern gleich an der internationalen Spitze!
Den Vogel schoß die sozialdemokratische Landtagsfraktion in Brandenburg ab. Finnland ist auf Platz eins? In Finnland dauert die Grundschule neun Jahre? Na, da führen wir in Brandenburg die neunjährige Grundschule einf, dann sind wir auch bald auf dem ersten Platz![2] – Ach, ganz so naiv war das nicht. Da sich die finnische Bildungspolitik in den 80er Jahren ihre Anregungen aus der DDR geholt hatte, kommt den Brandenburger Abgeordneten in Finnland nun manches vertraut vor: „Es war nicht alles schlecht!“[3] – Zwar hat PISA unter anderm erwiesen, wie falsch es war, die Bildung dreißig Jahre lang den Experten zu überlassen; ganz ohne Sachverstand geht’s aber auch nicht.
Gadgets
 Bildungspolitiker
sind ein Verschnitt. Ein bißchen Experten, ein bißchen Politiker, aber
keins davon wirklich. Die Blöße verdecken sie mit gadgets;
Feldzeichen, die viel zu sagen scheinen und noch mehr offen lassen, an
denen man aber die Lagerzugehörigkeit erkennt. Zu deutsch etwa: Trick
17; sieht schnucklig aus und wirkt Wunder.
Nach PISA sind’s dieselben wie davor, höchstens in geänderter
Reihenfolge. Zum ersten: das Zentralabitur. So würden die Noten
vergbleichbar von Garmisch bis Flensburg. Das wär ein Gewinn. Fragt sich
aber, was er wert ist. Das französische baccalauréat ist
vergleichbar von Draguignan bis Calais. Sprichwörtlich ist aber, daß
sich dort das letzte Schuljahr in hirnlosem Auswendiglernen erschöpft.
Da Alles drankommen kann, muß Alles gespeichert werden, da kann Denken
nur stören. Vergleichbar sind die Resultate schon; aber was wird
verglichen? Sicher nicht das, was PISA unter Grundbildung versteht.
(Darum steht am Eingang zu jeder weiteren Karriere dort ein concours, ein Ausscheidungswettbewerb!)
Bildungspolitiker
sind ein Verschnitt. Ein bißchen Experten, ein bißchen Politiker, aber
keins davon wirklich. Die Blöße verdecken sie mit gadgets;
Feldzeichen, die viel zu sagen scheinen und noch mehr offen lassen, an
denen man aber die Lagerzugehörigkeit erkennt. Zu deutsch etwa: Trick
17; sieht schnucklig aus und wirkt Wunder.
Nach PISA sind’s dieselben wie davor, höchstens in geänderter
Reihenfolge. Zum ersten: das Zentralabitur. So würden die Noten
vergbleichbar von Garmisch bis Flensburg. Das wär ein Gewinn. Fragt sich
aber, was er wert ist. Das französische baccalauréat ist
vergleichbar von Draguignan bis Calais. Sprichwörtlich ist aber, daß
sich dort das letzte Schuljahr in hirnlosem Auswendiglernen erschöpft.
Da Alles drankommen kann, muß Alles gespeichert werden, da kann Denken
nur stören. Vergleichbar sind die Resultate schon; aber was wird
verglichen? Sicher nicht das, was PISA unter Grundbildung versteht.
(Darum steht am Eingang zu jeder weiteren Karriere dort ein concours, ein Ausscheidungswettbewerb!)Das Gadget verhüllt mehr als es zeigt. Es geht nicht um Bildung, sondern um die dann nötig werdende Zentralbehörde.[4] Und um eine neue Machtbasis für die Experten! Der Föderalismus trägt dem Umstand Rechnung, daß wir Deutschen auch kulturell viel weniger als unsre Nachbarn eine Nation sind. Glauben die Experten denn, mit technischen Maßregeln unsre Geschichte unterlaufen zu können?
Zum Zweiten die Ganztagsschule. Da wird so getan, als sei unsre Vormittagsschule ein Zeugnis teutonischer Hinterwäldlerei. Dabei war sie weiland der erste Durchbruch des gesunden Menschenverstands in die preußischen Pädagogik. Denn auch dort herrschte zuerst die Ganztagsschule: „In Berlin wurden infolge der großen Hitze letzten Sommer in mehreren höheren Schulen der Nachmittagsunterricht ganz aufgehoben und die Morgenschulstunden um eine verlängert. Die Folgen waren ganz unerwartet, die Jungen kamen enorm rasch voran, und die Sache soll jetzt auf größerem Maßstab versucht werden“, schreibt Fr. Engels an K. Marx am 14. 10. 1868.[5]
Unser schulfreier Nachmittag war die erste Errungenschaft deutscher Reformpädagogik. Daß Kinder „mehr lernen“, wenn sie täglich statt fünf bis sechs Stunden derer sieben bis acht „beschult“ werden, ist ein Ammenmärchen. Keine empirische Untersuchung belegt es. Was also spricht dafür? Der statistische Schein: Alle Länder, die bei PISA besser abschneiden als wir, haben Ganztagsschulen! Aha. Und was haben die Länder, die noch schlechter abgeschnitten haben? Ganztagsschulen. So so.
Das beliebteste Argument für die Ganztagsschule ist immer noch das sozialpädagogische: Die Familien erfüllten ihren Erziehungsauftrag nicht mehr, da müsse die Schule einspringen. Es ist nicht neu, daß erwerbsmäßige Pädagogen Eltern die Kompetenz bestreiten. Mal angenommen, sie hätten recht. Dann stünden grundsätzlich zwei Optionen zur Wahl: entweder die Familien durch staatliche Institutionen von ihrer Verantwortung entbinden; oder ihnen Ressourcen zugänglich machen, die sie instand setzen, ihre Verantwortung selber wahrzu- nehmen. Vielleicht läßt sich das im Detail nicht säuberlich trennen, aber es handelt sich um eine Richtungsentscheidung. Dabei geht es nicht darum, wie ausgiebig Kinder beschult werden, sondern darum, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und das sollte nicht nur im Wahljahr Gegenstand des Parteienkampfs sein.
Statistische Fallen
An der Bagatellisierung beteiligte sich auch der Bundespräsident: „Ich warne davor, die Studie überzubewerten.“[6] Aber er warnt auch, „jetzt allein aus statistischen Sachverhalten heraus falsche Schlüsse zu ziehen“, und da hat er Recht. Das Sprichwort, man solle keiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefälscht hat, gilt nur für Fachleute. Wir Laien sollten uns vor ihnen überhaupt in Acht nehmen. Sie sind voller Fallen. Beweist Finnlands erster Platz wirklich die Überlegenheit der finnischen Schulen? Kann sein, kann nicht sein. Daß aber die langen dunklen Polarnächte bei den besonderen Lesegewohnheiten der Finnen auch eine Rolle spielen, wird allen Ernstes diskutiert, und amerikanische Krimis werden im Fernsehen nicht synchronisiert, sondern untertitelt.[7]
 Über
Kausalbeziehungen ist in der Tabelle nichts zu finden. Aber sie
verleitet dazu, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das deutsche
Schulsystem ist nachweislich weniger fähig, Ausländerkinder zu
integrieren, als die Schulen in Ländern mit ähnlicher Problematik? Die
Falle ist hier das statistische
Konstrukt ‚Familien mit Migrationshintergrund’. Inder in England,
Algerier in Frankreich haben ein historisch begründetes und – im Guten
wie im Bösen – die eigne Nationalidentität prägendes Verhältnis zur
Kultur (und natürlich zur Sprache) ihres Gastlandes: als zu einem
erstrebenswerten Gut. Türken in Deutschland haben das nicht. Sie sind
uns fremd und können es bleiben wollen. Daß die Deutschen seit
Jahrhunderten mit ihrer Identität selber hadern, und seit Auschwitz zu
Recht, macht die Sache nicht leichter.
Über
Kausalbeziehungen ist in der Tabelle nichts zu finden. Aber sie
verleitet dazu, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das deutsche
Schulsystem ist nachweislich weniger fähig, Ausländerkinder zu
integrieren, als die Schulen in Ländern mit ähnlicher Problematik? Die
Falle ist hier das statistische
Konstrukt ‚Familien mit Migrationshintergrund’. Inder in England,
Algerier in Frankreich haben ein historisch begründetes und – im Guten
wie im Bösen – die eigne Nationalidentität prägendes Verhältnis zur
Kultur (und natürlich zur Sprache) ihres Gastlandes: als zu einem
erstrebenswerten Gut. Türken in Deutschland haben das nicht. Sie sind
uns fremd und können es bleiben wollen. Daß die Deutschen seit
Jahrhunderten mit ihrer Identität selber hadern, und seit Auschwitz zu
Recht, macht die Sache nicht leichter.Aber was kann die Schule dabei tun? Soll sie ein paarhundert Jahre Kulturgeschichte hinzu erfinden? Mit andern Worten, sie ist nur ein Moment in einer komplexen kulturellen Gemengelage, und wohl kaum das entscheidende.
 Ein Blick auf Belgien! [8] Flandern zählt zur Spitzengruppe, Wallonien zu den Schlußlichtern. Aber
die Schule hat sich in beiden Landesteilen seit der Regionalisierung
hinsichtlich ihrer Organisationsformen nicht geändert. Sie kann nicht
schuld sein.
Ein Blick auf Belgien! [8] Flandern zählt zur Spitzengruppe, Wallonien zu den Schlußlichtern. Aber
die Schule hat sich in beiden Landesteilen seit der Regionalisierung
hinsichtlich ihrer Organisationsformen nicht geändert. Sie kann nicht
schuld sein.Der wahre Grund liegt auf der Hand. Wallonien war jahrundertelang der wirtschaftlich, politisch und kulturell entwickeltere Landesteil und der Born belgischer Identität. Es wurde geprägt von einer liberalen Großbourgeoisie und einer sozialistischen Arbeiterbewegung.
Wallonien hieß Industrie und Fortschritt. Flandern war sein ländlich-klerikal-bornierter Hinterof. Das hat sich seit der Stahlkrise der Siebziger radikal umgekehrt. Wallonien steht für Niedergang, Arbeitslosigkeit und Vorgestern. Das jungfräuliche Flandern hat die Zukunft für sich entdeckt und glaubt an die Neuen Technologien. In keinem Berufsstand spricht sich aber der Zeitgeist so unverhohlen aus wie in der Lehrerschaft. Und in keiner Altersgruppe so lautstark wie bei den Fünfzehnjährigen. Die hat PISA geprüft.
Befunde?
„Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben dieselben Begabungen wie Kinder in Bayern oder Baden-Württemberg“,[9] schreibt die bayerische Bildungsministerin. Wenn aber in der nationalen PISA-Ergänzungsstudie die einen so viel besser, die andern so viel schlechter abschneiden, liegt das dann am Parteibuch ihres Kultusministers? Das dürfte statistisch schwer zu belegen sein. Die Beweiskraft der Tabellen ist nicht positiv, sondern allenfalls negativ: Nein, die bewußte Förderung von Hochbegabungen (wie in Bayern) geht nicht auf Kosten der Schwächeren. In keinem Bundesland ist der Abstand zwischen der oberen und der unteren Leistungsgruppe so gering wie in Bayern: Dort „gelingt die Förderung der Schwächsten einfach am besten“, meint Jürgen Baumert, Leiter des deutschen PISA-Konsortiums.[10]
Und umgekehrt: „Die SPD hat ihr wichtigstes Ziel nicht erreicht: Chancengleichheit“, schreibt Annette Schavan.[11] Unterdurchschnittliche soziale Disparitäten bei überdurchschnittlicher Lesekompetenz werden in Sachsen, tendenziell auch in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen erreicht. Hohe soziale Disparitäten und ein durchschnittliches bis unterdurchschnittliches Leistungsniveau verbinden sich im Stadtstaat Bremen und den Flächenländern Hessen und Niedersachsen.“[12]
Beweist das aber, daß speziell die Gesamtschule, Lieblingsgadget sozialdemokratischer Schulpolitik, ungeeignet ist, soziale Benachteiligung zu überwinden? Oder beweist es nur, daß es sich überhaupt nicht um ein technisches Problem handelt, das mit organisatorischen Maßregeln zu bewältigen wäre?
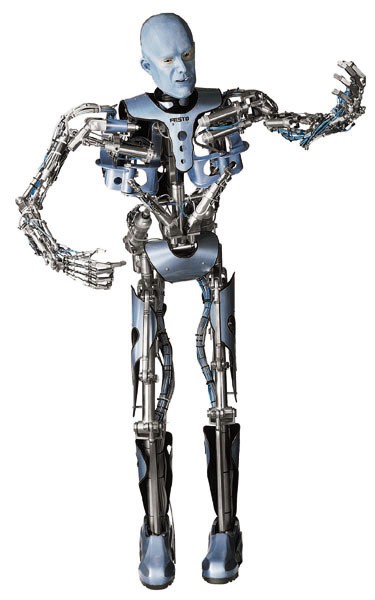 Auf dem Kongreß der Erziehungswissenschaftler beklagte Kulturstaatsminister Nida-Rümelin die
„technologische Verkürzung“ des pädagogischen Denkens.[13] Jürgen
Baumert persifliert es in diesen Worten: „Wir steuern das System von
außen, indem wir Standards setzen.“[14] Am kybernetischen Größenwahn der
Experten habe sich seit PISA nichts geändert, er fürchtet gar, es werde
noch schlimmer. Die Oberflächlichkeit, mit der PISA von „den
Verantwortlichen“ aufgenommen wird, scheint ihm Recht zu geben. [15]
Auf dem Kongreß der Erziehungswissenschaftler beklagte Kulturstaatsminister Nida-Rümelin die
„technologische Verkürzung“ des pädagogischen Denkens.[13] Jürgen
Baumert persifliert es in diesen Worten: „Wir steuern das System von
außen, indem wir Standards setzen.“[14] Am kybernetischen Größenwahn der
Experten habe sich seit PISA nichts geändert, er fürchtet gar, es werde
noch schlimmer. Die Oberflächlichkeit, mit der PISA von „den
Verantwortlichen“ aufgenommen wird, scheint ihm Recht zu geben. [15] PISA hat Fünfzehnjährige nicht nach ihrem Wissensstand, sondern nach ihrem persönlichen Vermögen der Welterschließung befragt. Das nennt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin platterdings eine „Schulleistungsstudie“[16], als habe sie PISA nie in der Hand gehalten. In Ländern mit allgemeiner Schulpflicht sind Fünfzehnjährige allerdings Schüler. Aber sind sie nichts als das? Sind persönliche Bildungsgeschichte und Schullaufbahn ein und dasselbe? [17] Zählen die Menschen nur, soweit sie institutionell erfaßbar sind? Ja richtig: sobald sie ins Visier der Verwaltung geraten, werden sie nur noch gezählt; standardisiert und zu Durchschnitten verrechnet. Daran krankt unser Bildungssystem vor allem: daß es in den Händen von Schreibtischtätern liegt, die in Tabellen qualitative Einsichten suchen.
PISA hatte die Fünfzehnjährigen an einem konstruktivistischen Lernbegriff gemessen. Der Befund ist: Das mechanistische Lernprogramm unserer deutschen Experten, das noch aus dem Industriezeitalter stammt, wird vor den Anforderungen der medialen Wissensgesellschaft nicht bestehen.[18] Und zwar in einigen Gegenden noch weniger als in andern.
Sigmar Gabriel beklagt, daß das hohe Niveau bayerischer Schüler durch eine ebenso hohe Selektivität und entspechend niedrige Abiturquote (unter 20%) erkauft werde, was dazu führt, daß Bayern jährlich tausende Studienabgänger aus Norddeutschland importieren muß.[19] Die bayerische Selektivität führt aber zu einem hohen Niveau nicht nur an den Gymnasien, sondern auch an Haupt- und Realschulen. Worum geht es denn – um Bildung oder um Berechtigungsscheine? Das muß man trennen.
 Dennoch
ist sein Einwand denkwürdig. Wenn man nämlich fragt, warum jährlich
4350 Hochschulabsolventen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach
Bayern gehen müssen, um Arbeit zu finden! Dann erinnern wir uns
nämlich, daß die formellen Bildungsinstitutionen nur
ein Moment einer kulturellen Gesamtlage sind – und nichtmal das
entscheiden- de. Ruhrpott und Waterkant sind unser Wallonien, Schwaben
und Oberbayern unser Flandern, nur nicht so eng gedrängt und längst
nicht so kraß. Und auch im deutschen Osten gibt es Gegenden, die mehr in
die Zukunft, und solche, die mehr aus der Vergangenheit leben (Manfred
Stolpe hat Brandenburg „unsere kleine DDR“ genannt.)
Dennoch
ist sein Einwand denkwürdig. Wenn man nämlich fragt, warum jährlich
4350 Hochschulabsolventen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach
Bayern gehen müssen, um Arbeit zu finden! Dann erinnern wir uns
nämlich, daß die formellen Bildungsinstitutionen nur
ein Moment einer kulturellen Gesamtlage sind – und nichtmal das
entscheiden- de. Ruhrpott und Waterkant sind unser Wallonien, Schwaben
und Oberbayern unser Flandern, nur nicht so eng gedrängt und längst
nicht so kraß. Und auch im deutschen Osten gibt es Gegenden, die mehr in
die Zukunft, und solche, die mehr aus der Vergangenheit leben (Manfred
Stolpe hat Brandenburg „unsere kleine DDR“ genannt.) Skepsis und Bedenken gegen das, was vor uns liegt, oder Hoffnung und Tatendrang – solche Stimmungen sind regional unterschiedlich verteilt und drücken sich im Wahlverhalten aus.
Parteien können sie verstärken (wobei die Bedeutung von ‚links’ und ‚rechts’ merkwürdig verkehrt scheint), aber machen können sie sie nicht. Stimmungen mögen der Wirklichkeit mehr oder weniger angemessen sein. Doch für die Pädagogik gilt immer dies: Wehmut und Sorge sind wenig geeignet, den Wagemut und das Selbstvertrauen der Jungen zu wecken, ohne die es keine Bildung gibt. Einer No-future-Lehrerschaft wird immer nur eine Null-Bock-Schülerschaft begegnen. Und selbst wenn die Jungen besser wären als die Alten – sie bleiben’s nicht.
Es folgen Routine, Formalismus und Pedanterie. Lehrer werden schließlich gradmal „diejenigen, denen nichts Besseres einfällt“, meint Dieter Lenzen, FU Berlin.[20] Und fordert stattdessen, nur „die besten Abiturienten sollten sich für diesen Beruf entscheiden“! Aber das kann nur in einem Land geschehen, das an seine Zukunft glaubt.
Lernen
Kinder sind robuster als man denkt. Doch unkaputtbar sind sie nicht – nichtmal ihre Neugier. Auf die Frage, wovon seine eigne Schulzeit am stärksten geprägt war sei, antwortet Jürgen Baumert: „von Langeweile, Furcht und Vermeidungsstragien“; was er auf Nachfrage mit Schwänzen präzisiert.[21] Für seinen Kollegen Eckhard Klieme, im PISA-Konsortium federführend beim mathematischen Teil, ist die wichtigste Lehre aus der gemeinsamen Studie, daß es nicht um die Formen, sondern „um die Qualität“ des Unterrichts geht: ob er nämlich „zum Denken anregt oder nur Regeln einübt“.[22]
 Regeln
einüben, das ist noch heute der Schulweisheit letzter Schluß. Nein,
nicht im Seminar. Aber im Alltag! Lernen wird immer noch „ausschließlich
als Folge des Lehrens gestaltet“, schreibt Barbara Kochan, die am
Institut für Sprache und Kommunikation der TU Berlin jahrelang den
Schreibunterricht an deutschen Schulen erforscht hat.[23] Sprache werde
noch immer „beigebracht“, noch immer geht die „herkömmliche Didaktik
davon aus, daß Kinder rechtschreiben lernen, indem sie sich die korrekte
Schreibweise durch Nachschreiben
einprägen“, während in Wahrheit das Kind „die Prinzipien unserer
Orthographie hypothesenbildend erkundet, um theoriegeleitete
Entscheidungen über Schreibweisen treffen, ausprobieren und revidieren
zu können“. Weshalb sie Schreibfehler in der Regel nicht machen, „weil
ihr Gedächtnis sie im Stich läßt, sondern zuallererst deshalb, weil sie
sich etwas dabei denken, das durch ihre noch unvollkommenen
Spracherfahrung gestützt wird“. Im Schreibfehler steckt meistens eine
Denkleistung. Und ebendie wird ihnen dann durch verstärktes Memorieren
abgewöhnt!
Regeln
einüben, das ist noch heute der Schulweisheit letzter Schluß. Nein,
nicht im Seminar. Aber im Alltag! Lernen wird immer noch „ausschließlich
als Folge des Lehrens gestaltet“, schreibt Barbara Kochan, die am
Institut für Sprache und Kommunikation der TU Berlin jahrelang den
Schreibunterricht an deutschen Schulen erforscht hat.[23] Sprache werde
noch immer „beigebracht“, noch immer geht die „herkömmliche Didaktik
davon aus, daß Kinder rechtschreiben lernen, indem sie sich die korrekte
Schreibweise durch Nachschreiben
einprägen“, während in Wahrheit das Kind „die Prinzipien unserer
Orthographie hypothesenbildend erkundet, um theoriegeleitete
Entscheidungen über Schreibweisen treffen, ausprobieren und revidieren
zu können“. Weshalb sie Schreibfehler in der Regel nicht machen, „weil
ihr Gedächtnis sie im Stich läßt, sondern zuallererst deshalb, weil sie
sich etwas dabei denken, das durch ihre noch unvollkommenen
Spracherfahrung gestützt wird“. Im Schreibfehler steckt meistens eine
Denkleistung. Und ebendie wird ihnen dann durch verstärktes Memorieren
abgewöhnt! Die mechanistische Didaktik entstammt dem mechanischen Weltbild des 18. Jahrhunderts: So wie dessen Welt aus ‚Atomen’ bestand, die von ‚Naturgesetzen’ zusammengehalten werden, würden beim Lernen ‚Stoff’-Partikel nach ‚Regeln’ zusammengesetzt. Das von PISA dagegengesetzte konstruktivistische Lernverständnis wird insbesondere am Begriff des „mentalen Modells“ bzw. „Situationsmodell“ deutlich.[24] Er meint, „daß Wissen nicht nur symbolisch, in Form von mehr oder minder komplexen Informationseinheiten repräsentiert ist, sondern daß zusätzlich ein internes Modell des Sachverhalts gebildet wird, und zwar im Sinne einer analogen, inhaltsspezifischen, anschaulichen Repräsentation, die von sprachlichen Strukturen losgelöst ist“. Analog, inhaltsspezifisch, anschaulich: das sind Eigenschaften von Bildern.
 Noch
expliziter wird PISA im mathematischen Teil. Der zielt „dezidiert nicht
auf die Beherrschung von mathematischen Verfahren und auf
Faktenwissen“,[25] sondern auf den „Prozeß des Modellierens“, nämlich
die Umsetzung von ‚Welt’ und ‚Situ-ationen’ in mathematische Modelle.
Mathematik ist nicht eine ‚Eigenschaft’ der Welt, sondern „unsere
mathematischen Begriffe, Strukturen und Vorstellungen sind erfunden
worden als Werkzeuge, um die Phänomene der natürlichen, sozialen und
geistigen Welt zu ordnen.“ Mathematik ist „Wissenschaft von den
möglichen Modellen“. Und was so ein Modell jeweils taugt, hängt davon
ab, worauf es einem ankommt.
Noch
expliziter wird PISA im mathematischen Teil. Der zielt „dezidiert nicht
auf die Beherrschung von mathematischen Verfahren und auf
Faktenwissen“,[25] sondern auf den „Prozeß des Modellierens“, nämlich
die Umsetzung von ‚Welt’ und ‚Situ-ationen’ in mathematische Modelle.
Mathematik ist nicht eine ‚Eigenschaft’ der Welt, sondern „unsere
mathematischen Begriffe, Strukturen und Vorstellungen sind erfunden
worden als Werkzeuge, um die Phänomene der natürlichen, sozialen und
geistigen Welt zu ordnen.“ Mathematik ist „Wissenschaft von den
möglichen Modellen“. Und was so ein Modell jeweils taugt, hängt davon
ab, worauf es einem ankommt.Wissen
Wie man sich das Lernen vorstellt, hängt offenbar davon ab, was man unter Wissen versteht. Anderthalb Jahrhunderte lang waren die reellen Wissenschaften von der positivistischen Prämisse geprägt, wonach durch gründliche Analyse der Erfahrung die elementaren Gegebenheiten freizulegen wären, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Deren Nagelprobe war die Technik. Die Triumphe der Industrie dementierten alle Zweifel. Heute, am Ende der industriellen Zivilisation, findet unterm Titel ‚Konstruktivismus’ endlich die Grundeinsicht der Kant’schen Kritik Eingang ins wissenschaftliche Standardbewußtsein: ‚Wissen’ ist nicht das Abbild einer gegebenen Wirklichkeit, sondern ein versuchter Entwurf, der unsre Wahrnehmungen zu sinnhaften Gestalten fügt und in der produktiven Einbildungskraft des Subjekts seinen Ursprung hat.
Unser Gehirn „bildet ständig Hypothesen darüber, wie die Welt sein sollte, und vergleicht die Signale von den Sinnesorganen mit diesen Hypothesen.“[26] Konstruktiv klingt aber nach Kalkül: nach richtiger Methode und genauem Maß. Die Triebkräfte des Wissens sind jedoch Neugier und Spiel: „dadurch entstehen Modelle der Welt!“[27] Und ein Modell ist ein Sinnbild und kein Abbild.
Denn wie eine Welt ‚an sich’ beschaffen wäre, können wir nicht nur nicht wissen. Wir können nichtmal sinnvoll danach fragen. Die Welt ist kein mit Informationen vollgeschriebenes Buch, die ich ihr entnehmen und entziffern kann. Sie ist nur ein Chaos von physiologischen Reizen, solange sie nicht durch einen Sinn geordnet wird. Der liegt nicht in ihr, sondern den muß ich ihr anerfinden. Das Einbilden kommt gewissermaßen ‚vor’ dem Wahrnehmen.
 Dem
trägt die laufende wissenschaftstheoretische Diskussion über
„Wissenschaft als Kunst“ Rechnung,[28] zugespitzt im programmatischen Schlagwort iconic turn,[29] „bildhafte Wende“: Bilder spielen in der Forschung eine immer größere Rolle; Paradebeispiel ist das als Doppelhelix
bekannte graphische Modell der DNS von F. Crick und J. Watson, das den
empirischen Befunden weit vorausgeeilt war: „Der Erkenntnisprozeß der
Wissenschaft fängt mit dem Generieren von Hypothesen an, die zunächst
intuitiv erfaßt werden, wobei sehr oft ästhetische Konsistenzkriterien
zugrundegelegt werden, die oft gar nicht rationalisierbar sind. Sehr
vieles in der Wissenschaft wird von der Ästhetik dominiert.“[30]
Dem
trägt die laufende wissenschaftstheoretische Diskussion über
„Wissenschaft als Kunst“ Rechnung,[28] zugespitzt im programmatischen Schlagwort iconic turn,[29] „bildhafte Wende“: Bilder spielen in der Forschung eine immer größere Rolle; Paradebeispiel ist das als Doppelhelix
bekannte graphische Modell der DNS von F. Crick und J. Watson, das den
empirischen Befunden weit vorausgeeilt war: „Der Erkenntnisprozeß der
Wissenschaft fängt mit dem Generieren von Hypothesen an, die zunächst
intuitiv erfaßt werden, wobei sehr oft ästhetische Konsistenzkriterien
zugrundegelegt werden, die oft gar nicht rationalisierbar sind. Sehr
vieles in der Wissenschaft wird von der Ästhetik dominiert.“[30] Doch Befürchtungen wg. Irrationalismus sind gar nicht am Platz. Die Ansprüche des analytischen Verstandes bleiben unbestritten. Er ist die kritische Instanz, er hat das letzte Wort. Aber eben nicht das erste: Die intuitive Vernunft liefert ihm sein Material.
Wechseln!
Auf der Jahresversammlung 2000 der Max-Planck-Gesellschaft beklagte deren Präsident Hubert Markl als Grund für den Mangel an naturwissenschaftlichem Nachwuchs, daß die Schüler Physik „abwählen“ dürfen, wenn’s ihnen zu schwer wird.[31] Das Problem ist aber nicht, daß sie dürfen, sondern daß sie mögen.
„Die Erforschung des Weltalls ist wohl allein deshalb eine der schönsten Aufgaben der Wissenschaft, weil es erstens unbegrenzt ist und sich zweitens noch immer ausdehnt.“ [32] Das seien zwei „eigentlich unvorstellbare Vorstellungen“! Es gehört zu den Rätseln des Geistes, daß wir Sachen zu denken vermögen, die wir uns doch nicht vorstellen können; aber auch nicht in Begriffe fassen, weil sie außerhalb diskursiver Exposition liegen. Angesichts solcher Paradoxa behelfen wir uns dann mit „unanschaulichen Bildern“. Der gekrümmte Raum ist so ein Bild, und auch der Urknall mit seinen Varianten, dem inflationären Weltraum und dem swinging universe.[33]
Und war es das, womit die fünfzehnjährigen PISA-Probanden in ihrer Schullaufbahn konfrontiert waren, bis es ihnen „zu schwer“ wurde? Wohl kaum. Was sie geboten bekamen, war nicht nur vorstellbar, sondern war ihnen von fremden Leuten schon fix und fertig vor=gestellt worden – damit sie’s „behalten“ sollten. Das ist weniger schwer als langweilig.
 Es
ist nämlich nicht wahr, daß man zuerst „Daten“ sammelt und sich
hinterher ein „Bild“ daraus zusammensetzt, sondern umgekehrt. Zuerst wird
ein Bild versucht, dann werden die Daten eingepaßt und zu
„Gegenständen“ geformt: wie in der Geschichte der Wissenschaft, so in
der Bildungs- geschichte der Personen! Mit andern Worten, die Kinder
wollen zuerst die Abenteuer des Denkens kennen lernen und den thrill des
Noch-Unbestimmten, ehe sie „memorieren“ – weil man nämlich die Daten zu
gern vergißt, solange sie noch nichts bedeuten.
Es
ist nämlich nicht wahr, daß man zuerst „Daten“ sammelt und sich
hinterher ein „Bild“ daraus zusammensetzt, sondern umgekehrt. Zuerst wird
ein Bild versucht, dann werden die Daten eingepaßt und zu
„Gegenständen“ geformt: wie in der Geschichte der Wissenschaft, so in
der Bildungs- geschichte der Personen! Mit andern Worten, die Kinder
wollen zuerst die Abenteuer des Denkens kennen lernen und den thrill des
Noch-Unbestimmten, ehe sie „memorieren“ – weil man nämlich die Daten zu
gern vergißt, solange sie noch nichts bedeuten.
Das
Staunen ist der Anfang der Philosophie, nicht das Speichern molekularer
Informationen. Wie in der Wissenschaft ist in der Pädagogik ein
Paradigmenwechsel fällig. Es muß ein Ende haben mit dem Expertendogma,
daß es sich um ein technologisches Problem handelt; nämlich erstens, um
eins der richtigen theoretischen Einsicht und zweitens, um eins der
adäquaten praktischen Anwendung. Das ist Pädagogik ganz entschieden
nicht. Es gibt schlechterdings keine Theorie, die dem Pädagogen sagt,
wie er es anstellt, seinen Zögling aus einem unerwünschten Zustand A in
einen erwünschten Zustand B zu versetzen: keine die ihm sagt, welcher
Zustand erwünscht ist, und keine die ihm sagt, wie man den andern
„versetzt“.
Pädagogik ist eine Kunst. Die Kunst, eine Situation so zu arrangieren, daß sie einen, der noch neu ist in der Welt, dazu verlockt, sich aus ihr „heraus-zu-finden“. Verlockt, sie anzuschauen und sich von ihr ein Bild zu machen – in dem er sich schließlich selbst entdeckt. Das versteht man unter persönlicher Bildung. Kein Vorgang der Einverleibung, sondern des Aus-sich-heraus-gehens. Nicht rein-ziehen, sondern entwerfen.[34]
Wollte man den fälligen Paradigmenwechsel in der Pädagogik aber seinerseits in ein Bild fassen, so wär es dies: Kinder sind (nach Rabelais) „keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht sein wollen“.

[1] Sigmar Gabriel, „Die Lehrerverbände verhindern Innovation“ in: Der Tagesspiegel, 1.7.02
[2] Berliner Morgenpost, 10. 5. 02
[3] Märkische Oder-Zeitung, 12. 6. 02
[4] vgl. Eva-Maria Stange (GEW-Bundesvors.), „Lob des Zentralismus“ in: Der Tagesspiegel, 11. 7. 02
[5] Marx-Engels-Werke, Bd. 32, S. 183f.
[6] „Erziehung nicht allein den Schulen überlassen“, Interview mit J. Rau in: Bild am Sonntag, 30. 6. 02
[7] vgl. auch W. Meyer, „Pisa verdrängen?“ in: PÄD Forum 3/02, S. 175f. [8] vgl. PÄD Forum 3/02, S. 194
[9] Monika Hohlmeier, „Mit Laptop, ohne Lederhose“ in: Der Tagesspiegel, 9. 7. 02
[10] auf Radio3, 30. 6. 02. Eine fast ebenso geringe Spanne zwischen oberster und unterster Leistungsgruppe weist Brandenburg auf; allerdings nicht auf höchstem, sondern auf niedrigstem Niveau, vgl. „PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich“, S. 18; in: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa
[11] Annette Schavan, „Topographie der deutschen Bildung“ in: Der Tagesspiegel, 3. 7. 02
[12] „PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich“, S. 56; aaO
[13] „Alles wandelt sich, der Humanismus bleibt“ in Die Welt, 27. 3. 02
[14] aaO.
[15] Er hat natürlich recht behalten. [Nachtrag 2006]
[16] Doris Ahnen, „Schule im Zentrum“ in: Der Tagesspiegel, 2.7. 02
[17] vgl. hierzu die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats zu Familienfragen beim BMFSFJ (in PÄDForum4/2002)
[18] Das Abschneiden der heute 15jährigen sagt nichts über die wirt-schaftliche Leistungskraft ihres Landes im Augenblick; vgl. den Beitrag von R. Arnold in PÄD Forum 3/02 (S. 179); sondern über seine Leistungskraft in rund 20 Jahren.
[19] aaO.
[20] Interview in Berliner Morgenpost, 15. 4. 02
[21] auf Radio3, 17. 2. 02
[22] auf Deutschlandfunk, 30. 6. 02
[23] Kochan, B. und Elke Schröter, „Begleitetes Schreiben“ in:www.tu-berlin.de(/fb2/lbd/clw/forsch/literatu/text33/text33/).html; es handelt sich um die Präsentation eines computergestützten interaktiven Schreiblern-programms (LolliPop Multimedia)
[24] PISA 2000, Opladen 2001, S. 72; vgl. PÄD Forum 3/02, S. 184
[25] ebd., S. 149ff
[26] Wolf Singer, „Vom Gehirn zum Bewusstsein“, in: Elsner, N., u. Gerd Lüer (Hg.), Das Gehirn und sein Geist, Göttingen 2000
[27] ders., „Wahrnehmen ist das Verifizieren von vorausgeträumten Hypothesen“ in: Kunstforum international, Bd. 124, Nov./Dez. 1993
[28] „Kunst als Wissenschaft – Wissenschaft als Kunst“: Titel eines Symposiums in der Gemäldegalerie Berlin vom 12.-16. 9. 2002; www.kunst-als-Wissenschaft.de
[29] Im ersten Halbjahr 2002 fand unter diesem Titel an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität eine Reihe von Vorlesungen statt, die u. a. die Prof. Bazon Brock, M. von Brock, Reinhard Brandt und Wolf Singer hielten. siehe www.iconic-turn.de
[30] s. Anm. 8
[31] Hubert Markl, „Die Grenzenlosigkeit der Wissenschaften und die Knappheit der Talente“ in: Max-Planck-Forschung, JV 2002, S. 59
[32]ebd.
[33] Letzteres ist viel älter als die dazugehörige wissenschaftliche Theorie; es findet sich nicht bloß bei Friedrich Engels, sondern schon bei der Zweiten Stoa.
[34] siehe hierzu vom Verf.: „Fürstlich Drehna- eine Schulgründung für den fälligen Paradigmenwechsel in der Pädagogik“ in: PÄD Forum





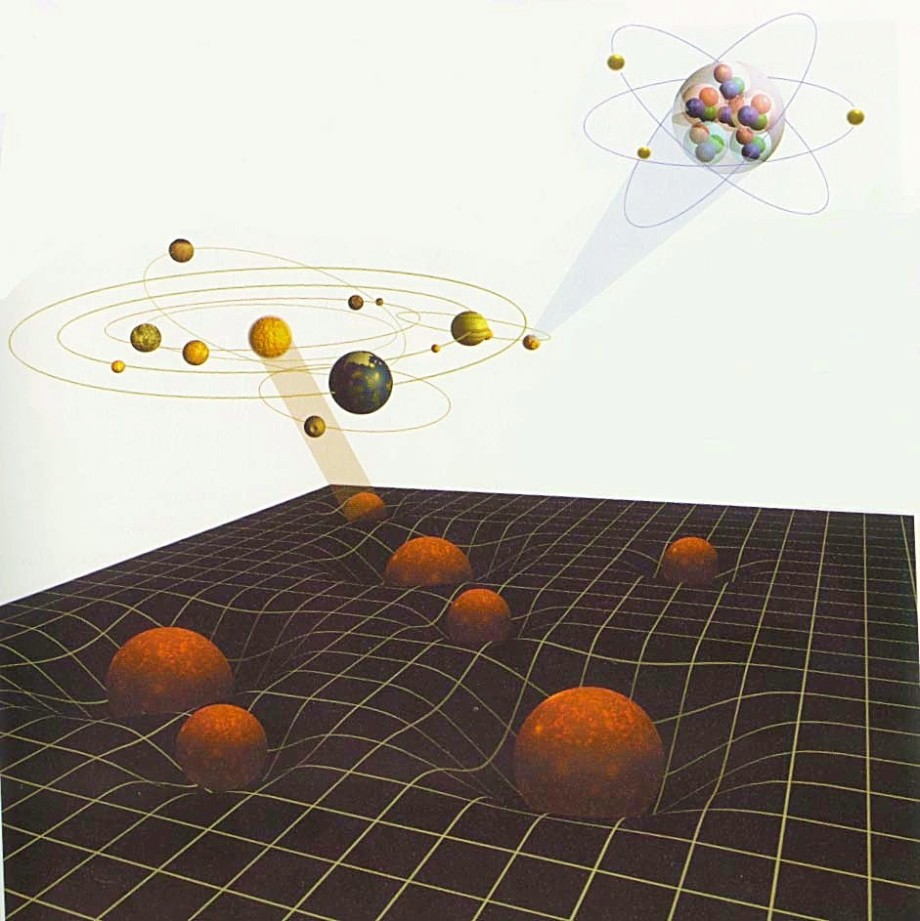
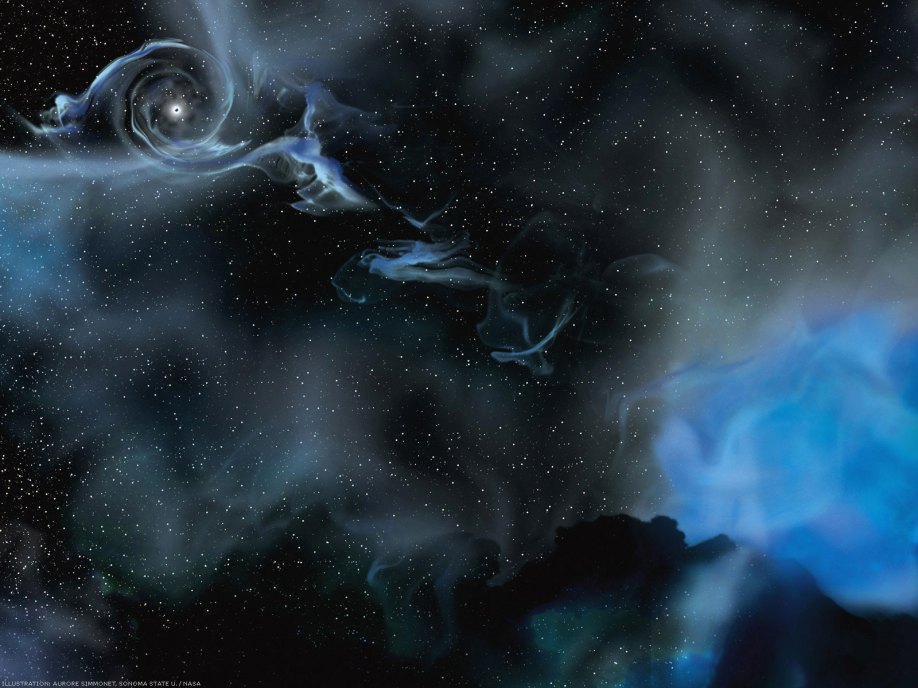

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen