
I.
Von Grund und Gegenstand der Erziehung.
Von Grund und Gegenstand der Erziehung.
Einleitung zur Kritik der pägagogischen Vernunft
II.
Die Grenzen der pädagogischen Vernunft,
oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?
III.
III.
Die Standesideologie der pädagogischen Zunft
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
I. Von Grund und Gegenstand der Erziehung
Einleitung zur Kritik der pädagogischen Vernunft
in: Leviathan, Heft 4/2001, S. 411-426
Abstract: Civil society essentially is public space. But public opinion, by its nature, is divided. Science is able to reduce that domain of dissent; it is public knowledge. Its apogee in modern times was the political event par excellence. Its coercive power resides in its systematic proceeding from assuring its logical foundation, to the conceptual seizure of its object. The rearing of the forthcoming generation is a task of most public concern. Though, pedagogy will never be founded in scientific theory, as at its ground there is no fact, but a problem, which cannot be proved, but just posed and postulated. And its object will never be seized, as it is Life itself, which cannot be analyzed, but just told in stories and shown in pictures. The ways of pedagogy are not logical, but esthetical. By virtue of its practices and by its place in society, it is Art and not Science.
I.
Eine Philosophie ist nicht eher vollendet, bis sie pädagogisch wird.
J. G. Fichte
Es ist nun bald zweihundert Jahre her, daß sich der Philosoph, Psychologe und Lehrer Johann Friedrich Herbart daran machte, der Erziehungskunst in der Allgemeinen Pädagogik ein wissenschaftliches Fundament zu legen. Dies eine hatte er von seinem Lehrer Fichte immerhin mitgenommen – die Gewißheit, daß Wissenschaft systematisch verfahren muß, um ihren Namen zu verdienen. Als System bedarf sie eines Grundes, auf dem sie ruht, und der Bestimmung des Gegenstands, den sie erfaßt.
Doch offenbar ist Pädagogik keine theoretische Wissenschaft, die konstatiert, was ist, sondern eine praktische: eine, die „durch Freiheit möglich ist“ und postuliert, was werden soll. Der Grund der Pädagogik ist mithin kein Faktum, von dem sie ausgeht, sondern ein Zweck, auf den sie hinausläuft – und der zugleich ihren Gegenstand setzt. Herbarts Allgemeine Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet erschien 1806.[1] Sie wurde zur Gründungsakte einer besonderen akademischen Disziplin.
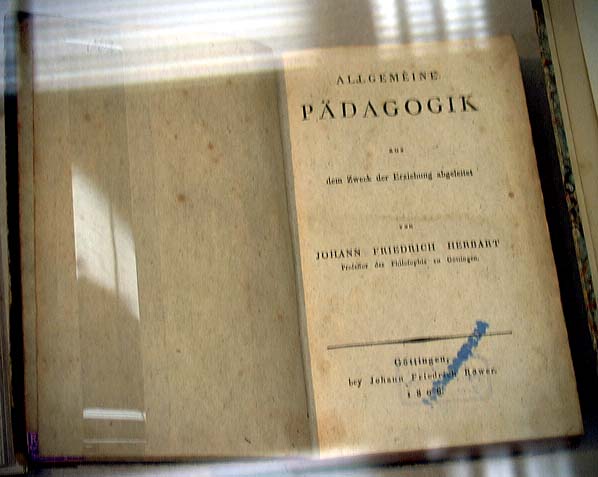
Daß der Zweck der Pädagogik nur Moralität sein könne, war Herbart selbstverständlich. Das ist es heute längst nicht mehr. Um so selbstverständlicher scheint inzwischen, daß Pädagogik Wissenschaft sei – oder werden müsse. Eine Wissenschaft beginnt freilich damit, daß sie ihre Voraussetzungen prüft. Und da ist gar nichts selbstverständlich. Ist Pädagogik, nach zweihundert Jahren, zur Wissenschaft geworden? Was ist ihr Grund, was ist ihr Gegenstand? Kann sie es je werden?
Sprachspiele
Die Menschen haben gesprochen lange bevor sie Wissenschaft getrieben haben. Dürfte eine Wissenschaft erst dann anfangen, wenn ihr Gegenstand (und ihr ‚Subjekt’: das Erkenntnisinteresse) in einem distinkten Begriff identifiziert ist, dann wäre reale Wissenschaft nie zustande gekommen. ‚Es gibt’ in der Vorstellungswelt eines jeden von uns Topoi, die er doch nicht definieren könnte, indem er sie im Verweisungsgeflecht der schon akkreditierten Begriffe verortet. Das Bekannte ist eben darum noch nicht erkannt, oder „die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen.“ [2]
Wie das individuelle, so beruht das öffentliche Bewußtsein auf einigen Urbildern, Grundannahmen über das Sosein der Welt, die dem Leben einen Sinn geben. Sie sind, wie alles sonst, historischen Veränderungen ausgesetzt. Aber so, wie sie einmal sind, geben sie den gemeinsamen Boden ab, auf dem man sich verständigt, aber über den man sich nicht verständigt. Denn nur, solange sie selbstverständlich bleiben, können sie die Unwägbarkeiten des täglichen Lebens tragen. Wissenschaft beginnt dann, wenn ein Bereich der vergesellschafteten menschlichen Tätigkeit aus seiner alltäglichen Selbstverständlichkeit herausgerissen und auf ihn reflektiert wird – weil er problematisch geworden ist.

Die bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich das Leben zu einem privaten und einem öffentlichen Alltag verdoppelt. Und was immer öffentlich wird, das ist die längste Zeit selbstverständlich gewesen. Denn die öffentliche Meinung ist, sozusagen von Hause aus, geteilt. Was öffentlich wird, wird problematisch: Herbart schreibt schon in einer Zeit, „wo die Spaltung der öffentlichen Meinung jeden anficht.“[3]Zwar ist der öffentliche Meinungskampf selber eine urwüchsige Form von Reflexion – aber doch nur, wenn er zu einem verbindlichen Schluss gebracht wird. Nämlich so, dass er seinerseits zu Schlüssen berechtigt, die nicht mehr strittig sind. So erst unterscheidet sich Wissenschaft von allen andern Arten der Gewissheit: dass sie allgemein gültig ist. Also geeignet, den Andern bei aller widerstreitenden Meinung zum Einverständnis zu zwingen!
Zu allererst also ist Wissenschaft eine gesellschaftliche Institution mit dem Auftrag, den Raum der öffentlichen Meinungskampfes einzugrenzen, indem sie auf immer weiteren Feldern Einverständnis erzwingt; nämlich aus gesicherten Voraussetzungen zu Ergebnissen kommt, die normative Geltung haben. Genau so bestimmte dann Friedrich Daniel Schleiermacher die Zuständigkeit „der“ Wissenschaft für „die“ Pädagogik – als eine Art Politik höherer Ordnung.[4] Die fortschreitende „Verwissenschaftlichung“ des Lebens ist die Kehrseite seiner Verrechtlichung. Jeder für sich darf sein Wissen dort herholen, wo er mag, wenn’s ihm nur reicht. Wissenschaft ist Sache eines öffentlichen Berufsstands von Spezialisten, die den Kampf der Meinungen stellvertretend für alle anderen zu einem (je einstweiligen) Schluss bringen. Und dabei ihre eigenen außerordentlichen Sprachspiele spielen.
Absehen von, absehen auf…
Spezialisierung allein begründet noch keine Wissenschaft. Denn damit die Ergebnisse der Reflexion zwingend werden, muss das Sichten der widerstreitenden Meinungen gründlich sein und systematisch. Es darf nichts auslassen und muss sich bei jedem Schritt seiner guten Gründe versichern. Darum lässt sich Wissenschaft nicht privat betreiben – weil sie des argwöhnischen Blicks der andern bedarf.
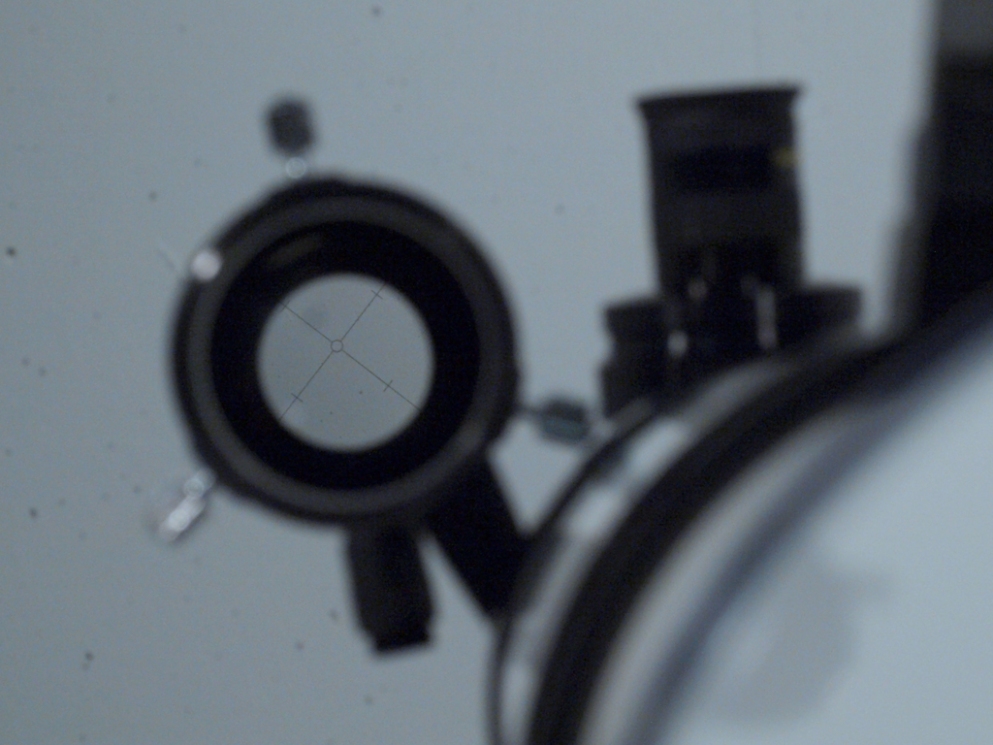
Reflexion ‚auf’ bedeutet immer: Abstraktion ‚von’ all dem andern. Und man reflektiert stets in einer Absicht auf…, so-bald nämlich ein Problem auftaucht. Die Reflexion ‚sieht ab’ – auf das eine und von allem andern. Sie wählt einen Ausgangs- und einen Fluchtpunkt; und eben damit tritt sie aus dem ‚Fluss’ des Lebens heraus. Sobald sie auf etwas abzielt, muss sie sich einen Grund sichern, von dem sie ausgehen kann. Und muss sich ihren Gegenstand vor Augen halten, ihn aus dem Wust der Erscheinungen isolieren, fixieren im Strom des Geschehens, um ihn nicht wieder zu verlieren: muss ihn auf den Begriff bringen. Die Geschichte der Wissenschaft ist in der Wirklichkeit natürlich ein ständiges ‚Schweben’ der Reflexion zwischen der Sicherung des ‚Grundes’ hie und der Begreifung des ‚Gegenstands’ da. Wobei es sich idealiter um einen Kreislauf handelt: Zu einem Problem, das sich stellt, werden die Gründe aufgesucht, um hernach zu prüfen, wie weit die Gründe tragen und was schon nicht mehr dazugehört. Wissenschaft bewährt sich, indem es ihr gelingt, diesen Kreis immer wieder neu zu schließen.
Konstituierung in der Schwebe
Wissenschaft beginnt als Aporetik. Zuerst werden die einzelnen Aufgaben des täglichen Lebens bewältigt – in schöner Selbstverständlichkeit und von allen. Dann aber treten Aufgaben auf, die verlangen größere Kenntnisse, höhere Fertigkeiten als die alltäglichen von dir und mir. Wer die Überschwemmungen der Flussniederungen aus dem Stand der Gestirne errechnen will, muss den Himmel studieren. Medizin und Astronomie sind aus dem alltäglichen Leben hervorgegangen. Die Theologie aus der Erfordernis, in das überhand nehmende Gewimmel am nahöstlichen Götterhimmel eine Ordnung zu bringen. Die Philosophie allein entstand anders. Sie ist der Urtyp der Wissenschaft, Reflexion schlechthin. Dass sie heute von den andern Wissenschaften nur noch belächelt wird, hat seine eigne, wundervolle Ironie.
Am Uhrwerk wird übrigens die Dialektik des ‚Schwebens’ besonders sinnfällig. Seine Entwicklung beruht nämlich nicht auf einer immanenten handwerklichen Dynamik stetiger Vervollkommnung. Es mußten zuerst präzise und verbindliche Zeitmessungen erforderlich werden, damit sich die Auffassung breitmachen konnte, daß Uhren auch… richtig gehen müssen! Nämlich exakt und an jedem Ort gleich. Es mußte eine bürgerliche Welt des Verkehrs, eine Welt von Genauigkeit, Regelbarkeit und Berechnung entstanden sein. Es mußte sich die ‚Bewußtseinsstellung’ (Gf. Yorck) verschoben haben.
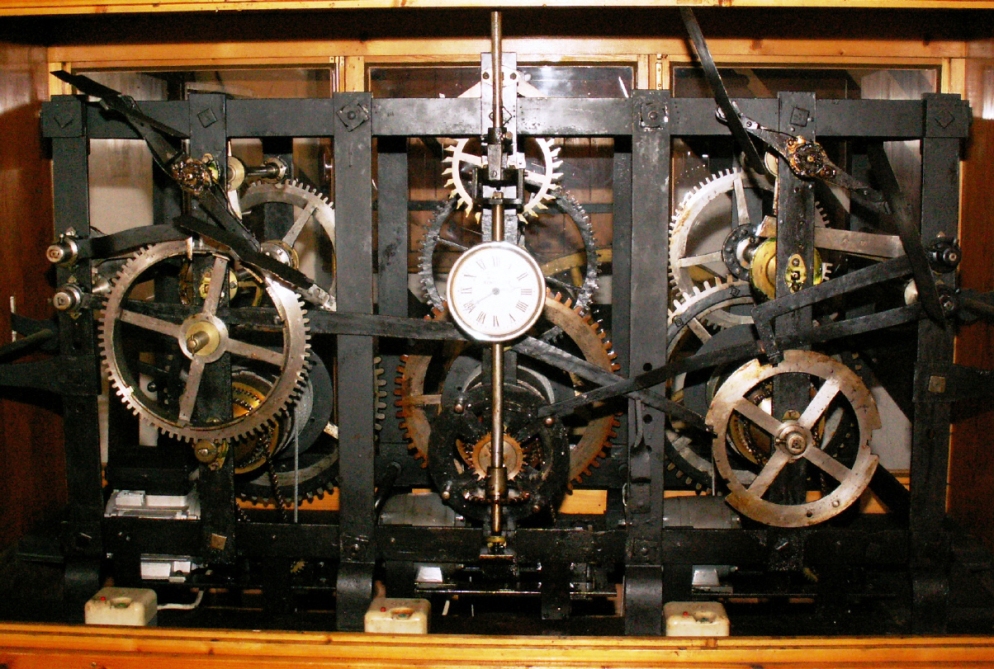
Fallierende Wissenschaft
Ein Wissensfach kann, so real die von ihm verhandelten Probleme immer sein mögen, auf seinem Weg von der Aporetik zur konstituierten Wissenschaft auch scheitern – wenn sich nämlich erweist, daß ihm der ‚Grund’ fehlt, auf dem es bauen könnte. Die Rede ist von der Politischen Ökonomie. Begonnen hatte sie, ähnlich wie die Physik, als aporetisches Anhängsel der Metaphysik, etwa in Aristoteles’ Spekulationen über die mysteriöse Natur des Goldes; oder als Spezialfall der Moraltheologie, wie in den mittelalterlichen Argumentationen um den ‚gerechten Preis’, iustum pretium (der übrigens in aller Regel als Wert der Arbeit = Mühsal bestimmt wurde). Anlaß, einen Begriff vom ‚Wirtschaften überhaupt’ zu bilden, gab es weder praktisch noch theoretisch.
Das änderte sich erst, als ein Ökomom herangewachsen war, der seinen eigenen Haushalt als ein Geschäft von allgemeinem, öffentlichen Interesse anschauen konnte – der absolute Fürst, der ‚seinen’ Staat als Betriebswirt betrachtet. Der Ausdruck ‚politische’ Ökonomie hatte keinen anderen Sinn, als er das erstemal verwendet wurde: die polis als oikos Ludwigs XIII., und das Buch, das diesen Namen trägt[5], enthält tatsächlich kaum etwas anderes als praktische Ratschläge für den Fürsten, wie er seinen Staat lukrativ bewirtschaften könne. Also von der Aporetik zur Wissenschaft konstituierte sich das ökonomische Wissen durch die Setzung eines interessierten Subjekts, das all die einzeln auftretenden Probleme dadurch zu einer ‚Einheit’ faßte, daß es sie zu den seinen machte. Den Schritt zur Definition des ‚Gegenstandes’ taten dann die Physiokraten: Politische Ökonomie untersuchte den ‚Kreislauf’ der Werte, und dessen ‚Grund’ war ausdrücklich mitgedacht – ‚die Natur’, wie der Name der Schule ja anzeigt.
Diese Wissenschaft schien in ihrem Aufbau abgeschlossen, als der ‘Gegenstand’ als System der Warenzirkulation, und dessen ‚Grund’ als das Wertgesetz identifiziert waren. Aber ach! Wie heikel es ist, die unausgesprochenen Prämissen eines ‚Sprachspiels’ beim Namen zu nennen, erwies sich, als Karl Marx daran ging, das „klassische System“ von Smith und Ricardo abzuschließen, indem er es darstellte. Die Darstellung geriet ihm zur Kritik – denn das ‚Wertgesetz’ war eine optische Täuschung, die der Darstellung nicht standhielt. Daß regelmäßig nur gleiche Wertgrößen sich gegen einander austauschen, setzt nämlich voraus, daß Arbeit regelmäßig nur noch als Lohnarbeit stattfindet. Diese beruht jedoch auf einem ungleichen Tausch. Die Geltung des Wertgesetzes beruht also darauf, daß es in seinem „Grunde“ nicht gilt. [6] – Der Versuch, diese Wissenschaft abzuschließen, machte sie einstürzen. Die streng durchgeführte Dialektik erwies sich, wie Kant sagt, als Kathartikon des Verstandes und zerstreute den falschen Schein. Nicht alles, was in der Welt vorkommt, taugt eben dazu, eine Wissenschaft zu begründen. Als theoretischer Gegenstand kommt manches nur historisch und kritisch in Betracht – und bleibt ansonsten eine Sache des Meinungskampfs.
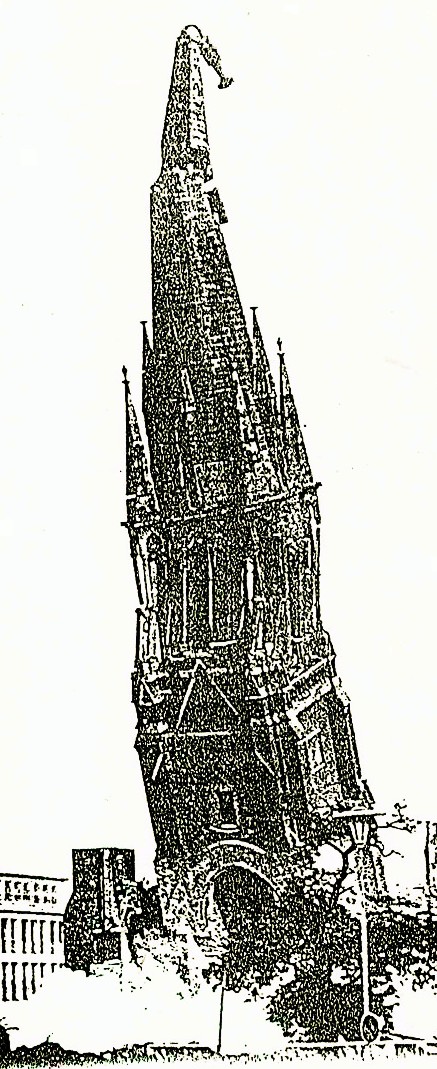
Folglich ist ‚Politische Ökonomie’ oder ‚Volkswirtschaftslehre’ wieder das, als was sie angefangen hat: Wirtschaftspolitologie, die nichts mehr zu erklären, die nur noch zu funktionieren braucht. Anderfalls nimmt man eine andere. Zu welchem Zweck? Das ist eben das Problem! Aber kein theoretisches, sondern ein praktisches.
Anschauung, Rechtfertigung, Kritik
Das theoretische Wissen beruht ursprünglich, wie der Name theoria = contemplatio sagt, auf der Anschauung dessen, was sich dem sinnlichen oder geistigen Auge darbietet. Den griechischen Philosophen galt es daher als das eigentliche, das auf mögliche Handlungszwecke bezogene Wissen dagegen als das mindere. Denn Wissen galt den aristokratischen Griechen überhaupt als Zweck, nicht als Mittel. Sie meinten, etwas ‚verstanden’ zu haben, sobald sie es als Bild darstellen konnten. Idea ist für Plato der Inbegriff des Wahren, Schönen, Guten. Werte zeigen sich der Anschauung. Das war offenbar eine ästhetische Auffassung von der Welt.
Seit Kants kopernikanischer Wende der Philosophie gilt umgekehrt das Wissen, das von den Werten handelt, als das praktische. Weil nämlich die Werte nun durch Freiheit möglich sind und gewählt werden wollen. Das theoretische Wissen erkennt das, was ist, aber es kann immer nur dienen. Das praktische Wissen ist sein Urheber – und sein Zweck. Alle Arten des Wissens beruhen auf Wert-Setzungen, ob sie nun bei klarem Bewusstsein gefällt wurden oder ‚nur so’. Und sie zielen auf sie ab. Geist = Absicht, sagt Friedrich Schlegel. Worauf aber abgesehen wurde, lässt sich erst im nachhinein aus den Resultaten erschließen. Die ‚Begründung’ einer Wis-senschaft ist also die – nachträgliche – Rechtfertigung, warum gerade auf diesen ‚Gegenstand’ abgesehen wurde; und darum ist die ‚Konstituierung des Gegenstandes’ einer Wissenschaft zwar historisch eine andere Sache als die Sicherung ihres ‚Grundes’, aber logisch sind sie nur die beiden Seiten derselben Medaille.
Nur einer Wissenschaft gelingt ihre Rechtfertigung ex ante, durch Evidenz. Das ist die Mathematik, die darum den anschaulichen Griechen als der Archetyp des Wissens galt – im Unterschied zu bloßem Meinen. [7] Doch auch Plato hat seine fünf vollkommenen Körper (Timaios 55e-56c) nicht rezeptiv aus dem Raum ‚heraus’, sondern poietisch in den Raum ‚hinein’ gesehen. Seine ‚An’schauung war eine Hinschauung. Hier, wenn irgendwo, gilt der Satz: Verum et factum convertuntur.[8] Die Gegenstände der Mathematik sind konstruiert, und darum ist ihre theoría selber praktisch. Denn zwar sind ihre Vollkommenheiten nicht ethisch, sondern ästhetisch. Doch auch sie müssen gewählt werden.

Den übrigen Wissenschaften aber gelingt ihre Rechtfertigung nur ex post, jedenfalls soweit sie theoretisch sind – nämlich im Rückgriff auf Gründe, die durch andere Wissenschaften schon gesichert waren; wenn etwa die theoretische Physik die Mathematik in Anspruch nimmt oder die Biologie die organische Chemie. Keine theoretische Wissenschaft kann ganz allein für sich bestehen, sie müssen alle einander wechselseitig rechtfertigen – und müssen einander mit ihren Fortschritten verifizieren oder falsifizieren. Veri- und Falsifizierbarkeit macht ihren Charakter als theoretische Wissenschaften geradezu aus. Und daß man nie ganz sicher ist, verschlägt ihm nichts – erst wenn wir glauben, statt zu wissen, „schwebt“ nichts mehr. Will sagen, es gibt keine Wissenschaft ohne deren Kritik.
Praktisches Wissen
„Praktische“ Wissenschaft dagegen handelt gar nicht von dem, was wirklich ist, sondern behauptet lediglich, was gelten soll – nämlich für einen, der handeln will. Ihre Sätze sind weder aus intuitiver Evidenz, noch aus einem theoretischen Wissen hergeleitet, sondern werden schlechtweg verkündet. Das heißt aber nicht, dass sie darum der Kritik entzogen wären. Denn wenn man ihre werthaften Grundannahmen auch nicht veri- oder falsifizieren kann, so kann man sie unter Umständen ad absurdum führen. Das heißt, man kann ein praktisches Postulat theoretisch glaubwürdig machen, indem man die entgegen-gesetzte Annahme mit Gründen zu Fall bringt. (Welcher aber der je bestimmte Gegen-Satz ist, ist seinerseits strittig.)
Der Satz ‚der Mensch ist frei’ – ein Dauerbrenner der abendländischen Geistesgeschichte, mit dem eine anständige Pädagogik steht und fällt – ist theoretisch schlechterdings nicht beweisbar und also nicht diskutabel. Er läßt sich nur in der Form ‚der Mensch soll frei werden’ oder ‚du sollst handeln, als ob du frei wärst’ moralisch postulieren. Dennoch ist er mehr als bloße Meinung. Denn sein Gegen-Satz ‚Der Mensch ist unfrei’ läßt sich ohne inneren Widerspruch nicht formulieren. Wer ihn ausspricht, hat ein Urteil gefällt. Er hat nicht nur vorausgesetzt, daß ‚es’ Gründe ‚gibt’ für sein Urteil (unabhängig von seiner Subjektität), sondern er hat sich selbst auch das Vermögen zugeschrieben, über deren Gültigkeit zu entscheiden. Das Vermögen, aus eigenem Rechtsgrund zu urteilen, ist, als liberum arbitrium, das Vermögen der Freiheit. Die kategoriale (Urteils-) Form des Satzes ‚der Mensch ist unfrei’ hebt den materialen Gehalt des Satzes wieder auf.
Aber das ist nur ein Beweis ad hominem. Er gilt immer nur für den, der ihn gerade ausspricht. Es gibt keinen logischen Grund, der ausschlösse, daß nicht eines Tages ein Redner auftritt, auf den die Bestimmung ‚Mensch’ nicht zuträfe. Aber der könnte den Satz ‚der Mensch ist unfrei’ aussprechen, ohne absurd zu werden. Ein solches ‚apagogisches’ Verfahren, das einen Satz nicht aus eigenem Rechtsgrund herleitet, sondern durch die Widerlegung seines Gegenteils lediglich plausibel macht, ist nicht wirklich ein Beweis. Denn es gibt keinen Weg, zu sichern, daß alle möglichen Gegen-Sätze erschöpft wurden. Es handelt sich lediglich um einen pragmatischen Erweis, der nicht theoretisch ‚wahr’, sondern bloß in einem je besondern Handlungsrahmen ‚richtig’ ist.
Ein letzter Grund!
Der Handlungs-Zweck, die „Absicht“, die der ganzen Sache ihren Sinn gibt, ist eben immer vorausgesetzt. Läßt er sich nicht theoretisch herleiten, muß er postuliert und aus seinen Werken gerechtfertigt werden. Woran aber können sich die Werke selber rechtfertigen? An neuen Postulaten? Stehen wir vor einem Regressus in infinitum? Und wenn auch noch das praktische Wissen der Urheber des theoretischen ist – wäre unser Wissen dann überhaupt ohne Grund?

Die Frage, ob wohl unser Wissen einen Grund hat, läßt sich theoretisch, also im Rückgriff auf einen höheren (oder ‚tieferen’) Urteilsgrund nicht entscheiden – sonst wäre der jeweils aufgefundene Grund seinerseits begründet, und wir müßten weiter suchen; siehe oben. Theoretisch stehen wir vor einem gordischen Knoten, der nicht gelöst, sondern nur zerschlagen werden kann: Unser Wissen muß einen Grund haben – weil anders all unsere Sätze ohne Sinn wären. Hier wie oben wäre die entgegengesetzte Annahme absurd: Keiner von uns könnte sie sinnvoll aussprechen, er müßte lallen oder den Mund halten. Wenn es im Leben einen Sinn geben soll, dann muß das Wissen einen Grund haben. Wer meint, das Leben bräuchte keinen Sinn, der kann nicht widerlegt werden. Er müßte sich allerdings aus der Erörterung sinnvoller Fragen heraushalten. Denn wer das Nichts behauptet, behauptet nichts, sagt Heidegger.
Die Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt, ist Unfug. Die Antwort darauf wäre, wie immer sie ausfiele, wahr oder un-wahr. So kann man nur fragen, weil man sich von der Wahrheit längst eine Idee gemacht – und also die Antwort „in Wahrheit“ schon vorausgesetzt hat.
Da ‚es’ Wahrheit also ‚geben’ soll, ‚muß’ sie einen Grund haben. Und der muß sich in unserm Wissen auch auffinden lassen. Nicht so zwar, als ob er darin als eines seiner Stücke selber vorkäme; sondern als das, was übrigbleibt, wenn von allen tatsächlichen Wissensgehalten abgesehen wird: die allgemeine Form des Wissens überhaupt. Formen sind in Zeitlosigkeit geronnene Handlungen, in der Geometrie wie in der Logik. Der Grund des Wissens muß ein ursprünglicher Akt sein, actus purus. Er kann nichts anderes sein als jene ‚Tathandlung’, durch die das wirkliche Erleben sich ‚anschaut’ als eine Anteilnahme des Einen am Andern – wie an einer Aufgabe. Die Ur-Teilung von Ich und Welt „gibt es“ nur als Problem. Es stellt sich dem, der es sich stellt. Es einem andern andemonstrieren kann er nicht. Aber er kann davon erzählen, als ob es ihm widerfahren wäre, wie einen Mythos: So muß es gewesen sein! Wissen, das darauf „gründet“, bleibt problematisch. Daß es einen Sinn gibt in der Welt, ist eine Behauptung, die sich immer erst noch erweisen muß.
.
II.
Was man für eine Philosophie wähle, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist.
J. G. Fichte
Wie
ist es mit der Pädagogik? Hat sie einen bestimmten Gegenstand? Steht
sie auf gesichertem Grund? – Auf jeden Fall ist sie ein besonderes Fach,
das viele hunderttausend Leute beschäftigt. Und dieses Fach steht in
öffentlicher Verantwortung. Daher
stammt ja die Forderung nach Wissenschaftlichkeit in der Pädagogik:
Ihre Zwecke und Methoden sollen objektivierbar sein, um sich vor dem
steuerzahlenden Publikum zu legitimieren. Doch seit sie sich zu einem besondern Fach ausgebildet hat, herrscht in der Pädagogik Streit. Über den Gegenstand, über den Grund, über die Zwecke und über die Methoden. Das scheint sogar ihren besondern fachlichen Stolz auszumachen! Sobald nicht mehr gestritten würde, sei sie tot, sagen ihre Apologeten, und schmiegen sich ganz eng ins Selbstverständnis des demokratischen Gemeinwesens ein. Wenn aber dieser Streit nur ein Schein wäre, der das Lachen von Auguren kaschiert? In allen pädagogischen Kontroversen herrscht ja über dies eine immerhin stillschweigende Übereinkunft: Das konstitutive Problem sei das Heranwachsen selbst. Das Vorhandensein eines Berufsstandes von Heranwachsingenieuren wäre nur die selbstverständliche Folge.

Es ist aber an der Zeit, die Perspektive umzukehren und es wieder für selbstverständlich zu halten, dass Menschen heranwachsen, und ein Problem vielmehr darin zu erkennen, dass sie dazu einer zunftmäßigen Pädagogenschaft bedürfen sollen. Denn erst, als sich ein besonderer gesellschaftlicher Stand gebildet und auf seine bestimmte Erwerbsweise spezialisiert hatte, konnte die Idee aufkommen, ‚erziehen’ sei ein so weit umgrenzter, definierter, identifizier- und womöglich monopolisierbarer Bereich menschlicher Verrichtungen, dass er sich zum Gegenstand einer eigenen Wissenschaft konstituieren lasse. Aus dem bloßen Vorhandensein dieses Standes wird treuherzig geschlossen, er müsse wohl auch was Spezifisches zu tun haben. Pädagogik ist, was Pädagogen tun.[9]
Bezeichnenderweise gibt es dieses Fach gleich zweimal. Als Pädagogie ist es „Arbeit am Kind“, als Pädagogik ist es die theoretische Reflexion auf jene – und wird heute, nur scheinbar bescheidener, meist Erziehungswissenschaft genannt. Das Wissenschaftliche daran soll die kritische Besinnung auf den Rechtsgrund der pädagogischen Tätigkeit sein.
Und die ist bitter nötig. Denn die Pädagogenschaft ist in der modernen Welt der ideologische Stand par excellence. In ihm spricht sich, wie sonst wohl nur in der Juristik, das Selbstverständnis einer Zeit unverhohlen aus. Doch während das Recht dem Zeitgeist als sein Schlusslicht immer hinterher hinkt, ist die Pädagogik sein Wetterfrosch, denn sie ist der Spiegel seines Spiegels. Anders als andere Berufsgruppen bedürfen die Pädagogen nämlich einer Rechtfertigung vor sich selbst – weil sie sich vor einer Gesellschaft rechtfertigen müssen, die sie aushält: indem sie eben ihre besondere Erwerbsart als eine allgemein-notwendige darstellen. Pädagogik ist die Legitimationslehre eines partikularen gesellschaftlichen Interesses. Aber bitte: Dass dieser Stand der Legitimation bedarf, heißt nicht schon, dass er illegitim ist. Doch es heißt immerhin, dass er nicht selber zum Richter darüber bestellt ist, ob ihm seine Rechtfertigung gelingt.
Das hat weit reichende Konsequenzen für den fachlichen Status der Pädagogik als Wissenschaft. Wäre sie wirklich nur immanente Reflexion einer Disziplin auf sich selbst und auf die Voraussetzungen ihrer ‚Praxis’, so wäre sie mit demselben Fug und Recht Wissenschaft wie etwa das Ingenieurswesen. Die Ingenieurswissenschaften rechtfertigen sich unmittelbar durch das Gelingen ihrer Werke und sind insofern „in sich selbst begründet“. Nicht so die Pädagogik. Sie muss auch ihre Werke immer selbst noch rechtfertigen – und nicht vor der hohen Fakultät, sondern vorm gesellschaftlichen Leben; denn wer anders kann entscheiden, was ihr gelungen ist und was nicht? Weder kann sie sich also durch sich selbst rechtfertigen, noch durch die Resultate einer ‚anderen’ Wissenschaft. Denn seit unser Fach sich Erziehungswissenschaft nennt, liegt es mit sich im Hader, ob es seine ‚Grundlagendisziplin’ in „der Psychologie“ oder „der Soziologie“ erkennen will. Und kann so aufs Interessanteste immer wieder von vorn anfangen! Das schafft Professorenstellen. Aber es rechtfertigt sie nicht gerade. Rechtfertigen kann sich dieses Fach nur durch den Alltagsverstand der öffentlichen Meinung. Frau Schulze und Herr Schmidt sind grundsätzlich ebenso befugt, über Pädagogik zu urteilen, wie der Erwerbserzieher oder sein akademischer Lehrer.
Alltagsfragen
Natürlich versteht im Detail der eine immer ein bisschen mehr von der Sache und der andere ein bisschen weniger. Aber das ist beim Kochen und beim Autofahren auch nicht anders. Nur, „worum es eigentlich geht“ in der Pädagogik, darüber hat der ungelehrte Alltagsmensch ebenso mitzureden wie der studierte Fachmann. Pädagogik ist eine Sache des täglichen Lebens, und also keine Wissenschaft. [10]

Das schließt gewiss nicht aus, dass man jederzeit auf diese Sache reflektieren und sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung machen kann. Alles kann Gegenstand der Wissenschaften werden, sonst verdienten sie nicht ihren Namen. Aber darum kann noch lange nicht alles eine Wissenschaft auch begründen. Denn was die Pädagogen durch Selbstreflexion allenfalls begründen könnten, wäre keine Pädagogik, sondern Pädagogologie. Ein eklektisches Genre ohne identifizierten Gegenstand und ohne eigene Logik, welches lediglich Resultate aus anderen Wissenschaften ansammelt und nach pragmatischen Interessen sortiert – den Berufserfordernissen der pädagogischen Erwerbsweise.[11]
Wer nun dieses Genre als Aporetik definiert, [12] um doch noch seinen wissenschaftlichen Rang zu retten, sagt nichts anderes, nur verschweigt er seine selbstherrliche Voraussetzung. Dass nämlich von Rechts wegen ein ‚Subjekt gesetzt’ sei, das da ‚Probleme’ hat! Joh. Fr. Herbart durfte, als er die Allgemeine Pädagogik erfand, noch arglos davon ausgehen, weil er über den Hauslehrer schrieb, der an der Seite der Eltern in der Familie wirkt. Schleiermacher durfte schon nicht mehr, denn er redete von der Schule. Da war diese Verschwiegenheit eine Subreption.[13] Sie ist nicht nur logisch, sondern auch sonst ungehörig, weil seither den Eltern, die Kinder großziehen, weisgemacht wird, sie hätten in diesem erschlichenen ‚Subjekt’ ihren natürlichen Meister.
Was zu tun ist
Die Pädagogik kann nicht selbst zur Wissenschaft werden, weil ihr die Begründung fehlt. Eine theoretische Begründung, die ihr von einer anderen, akkreditierten Wissenschaft verbürgt würde, hülfe ihr nicht. Denn auch wenn ein für allemal festgestellt wäre, was der Mensch ist, wüsste sie noch immer nicht, was sie zu tun hat. Was der Mensch ist, ist eine Sache. Was er aber sein soll, ist eine andere. Tun bezieht sich auf Sollen, und gerade mit dieser andern Sache ist der Erzieher daher befasst. Denn was der Mensch ‚ist’, wird er von alleine. Dafür braucht er keinen Erzieher. Begründen muss er seine Disziplin nicht auf einer Tatsache, sondern in einer Aufgabe. „Worum es geht“ ist eben: was er tun soll. Das ist eine praktische Frage, keine theoretische. Praktische Gründe werden nicht erwiesen, sondern postuliert.
Doch zum Postulieren muss man befugt sein, und das ist der Pädagoge nicht. Er muss sich ja erst selbst noch rechtfertigen, und zwar durch seine Aufgabe. Seine Existenz kann er nur rechtfertigen durch seine Praxis. Und wodurch begründet er seine Praxis? Durch seinen Auftrag? Aber den hat er sich selbst erteilt. Mit welchem Recht? Und so weiter. Die Katze beißt sich in den Schwanz, und darum muss sich jede Allgemeine Pädagogik, die als Wissenschaft auftreten will, in einem Zirkel drehen. Sie „schwebt“ zwischen Anmaßung und Erschleichung. Sie ist nicht Aporetik, sondern Aporie.
Eine Privatrechnung
Die Praxis des Pädagogenstandes lässt sich theoretisch nicht begründen. Wohlgemerkt führt auch die Berufung auf die Allgemeinheit nicht weiter. Denn deren Urteil ist nicht Wissenschaft, sondern Meinung, wiewohl öffentliche. Gewiss besser als gar nichts, wenn einem das Hemd näher sitzt als die Hose. Nur eben ist die öffentliche Meinung, seit es sie gibt, gespalten. Warum sonst hätte sich die bürgerliche Gesellschaft ihre ideologischen Stände wohl geleistet? Deren Sache ist es, die Meinungen stellvertretend für eine Allgemeinheit, die mit ihren Tagesgeschäften genügend zu tun hat, zu Markte zu tragen und auszutauschen, um per Zirkulation aus deren individuellen Gebrauchswerten ihren allgemeinen ‚Wert’ auszumitteln. Nur stellen die Meinungen, um die es ihnen geht, Interessen dar – auch ihre eigenen -, und die werden nicht reflektiert, sondern vertreten. Zwar reden auch sie mit spezialisierten Zungen, aber sie wollen kein Einverständnis erzwingen, sondern zur Geltung kommen.

Wollten sich also die Pädagogen auf die öffentliche Meinung berufen, dann würden sie in die eigene Tasche wirtschaften. Sie hätten sich bedient, aber nicht gerechtfertigt. Darum klingt der endemische Streit in der Pädagogik ja auch so oft wie das Lachen der Auguren. Dass sich derartige Stände gebildet haben, ist ein historisches Faktum, das als solches nicht zu ‚rechtfertigen’, sondern nur hinzunehmen ist. Aber ein Faktum kann seinerseits auch nichts und niemand rechtfertigen. Es ist, und damit gut. Wenn nun einer ohne Not diesem Stand beigetreten ist, muss er das wohl schon selbst verantworten. Die Rechtfertigung der pädagogischen Berufe wird zu einem persönlichen Problem derer, die sie ausüben. Empirisch erweist sich das in der ewigen Klage über fehlende objektive Erfolgskriterien in den erzieherischen Berufen – und in dem um sich greifenden burnout. Allgemeine Pädagogik entpuppt sich, nah besehen, als ein berufsethisches, nicht als ein pädagogisches Thema. Und das bedeutet in diesem Falle nicht, dass der einzelne sich vor seinem Stand zu verantworten hätte, wie das etwa bei den Ärzten der Fall sein mag. Sondern dass der Einzelne schon seine Zugehörigkeit zu diesem Stand rechtfertigen muss. Es reicht nicht, wenn er seine Sache gut macht. Er müsste schon zeigen, dass es eine gute Sache ist.
„Menschenbild “
Die Praxis muss gerechtfertigt werden, und zwar von jedem einzelnen. Nicht die richtige Technik, sondern, wie Herbart wusste, die richtigen Zwecke sind zuerst gefragt: seine „Erziehungsziele“. „Lehrpläne“ und „pädagogische Konzeptionen“ sollen den Erziehern ihre ethische Bürde abnehmen, und ver-tuschen das regelmäßig durch wissenschaftliche Diktion, so als ob da eine praktische Aufgabe theoretisch zu erledigen wäre – durch Unterschieben eines ‚objektiven’ Menschenbildes etwa. In Wahrheit geht es aber um das persönliche Menschenbild des einzelnen Erziehers. Natürlich – und gottlob – nicht um das Bild, nach dem er seinen Zögling formen will. Noch nie ist es jemandem gelungen, einen Menschen so zu machen, wie er ihn haben wollte. Was er allenfalls erreichen konnte war, den andern daran zu hindern, das zu werden, was er sonst vielleicht auch noch hätte werden können. Doch wohlverstanden, auch das Hindern gelingt nicht gezielt. Eher noch werden die Kinder zu den Leuten, vor denen ihre Eltern sie schon immer gewarnt haben. So wenig man jemand zu etwas erziehen kann, so wenig kann man es für etwas. Schon gar nicht für ‚diese Welt’, so dass er dort hineinpasst. Das liegt daran, dass die Welt gar nicht so oder anders beschaffen ist. Sondern sie ist die Aufgabe für einen jeden, sich seine Welt zurechtzulegen.
Ermuntern und ermüden
Diese Aufgabe mag man mit dem Ausdruck ‚lernen’ kennzeichnen. Das ist irreführend, schadet aber nicht, solange klar bleibt, dass mit lernen hier in keinem Fall gelehrtwerden gemeint sein kann. Zu lernen ist immer nur die Kunst, sich zurechtzufinden. Der Wunsch zu suchen kann dagegen nicht gelernt und noch weniger gelehrt, sondern allenfalls ermuntert oder ermüdet werden. Wo aber nichts ist, da wird nichts. Ermuntern oder ermüden, damit sind die Möglichkeiten der Erziehung allgemein umgrenzt: Staunen machen und die Zuversicht pflegen, dass alles gelingen kann.

Das ist aber keine bestimmte Tätigkeit, die sich von anderen unterscheiden, isolieren, operationalisieren, technisieren und ergo verwissenschaftlichen ließe. Zwar gibt es im Beruf des Lehrers einen operationalisierbaren Anteil – die Übertragung von Kenntnissen. Aber Didaktik ist, als Kunst der Mitteilung, noch keine Pädagogik, und mit Kindern hat sie nur zufällig zu tun, doch nicht dem Begriff nach. Vielmehr bedeutet erziehen eine durchaus unspezifische Haltung, die natürlicherweise ein anständiger Mensch einnimmt, sobald er nur irgend regelmäßig seine Zeit mit Kindern teilt: die Welt zeigen – was immer dann am besten gelingt, wenn der eine durch die Augen des andern schaut. [14]
Treibt man das von Berufs wegen, wird es nicht ausbleiben, dass man immer wieder auch mal darauf reflektiert. Aber ein Übermaß an Reflexion ist noch nie einer Alltagsverrichtung zuträglich gewesen. Bekannt ist der Fall des Tausendfüßlers, der nicht mehr von der Stelle kommt, seit er gefragt wurde, wie er es nur schafft, immer einen Fuß vor den andern zu setzen. Fällt es nicht auf, dass in keinem Fach die Trennung zwischen ‚Theoretikern’ und ‚Praktikern’ so radikal ist wie in diesem? Die einen denken über etwas nach, was sie nicht selber tun, die andern tun etwas, worüber sie nicht selber nachdenken - und verachten einander dafür. Denn Erziehen heißt ja nicht, dieses oder jenes „tun“, sondern es heißt die Umstände arrangieren, aus denen (‚sich’) der andere heraus-finden muss. Einer der Umstände im Leben des Zöglings ist die Haltung seines Erziehers. Wie sie zu den anderen Umständen passt und wie sie ihn zum Herausfinden verleitet und verlockt, das macht – hauptsächlich – den Unterschied zwischen guter und schlechter Erziehung aus. Und hat es wer auf diesen Unterschied abgesehen, dann mag daraus wohl eine Kunst werden. Doch das liegt ganz bei ihm.
Notlösung
Zum Amt des Erziehers qualifiziert sich keiner durch seine Fertigkeiten – die sind nur Randbedingung; sondern durch seine Haltung. Ob einer zum Erzieher taugt oder nicht, ist nicht eine Frage der Ausbildung, sondern des Charakters. Doch was für einen Charakter einer hat, das hängt – was immer tiefen- und verhaltenspsychologische Schulen anders lehren mögen – davon ab, was für ein Bild er sich von sich selber macht. Das allein ist der Punkt, an dem sich der Erzieher rechtfertigen kann: nicht das Menschenbild, an dem er den Andern, sondern das Menschenbild, an dem er sich selber mißt. Und was für eine Pädagogik er wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch er so geworden ist.
Allgemeine Pädagogik kann sonach nicht bestehen als „Wissenschaft vom Kind“, sondern allenfalls als Deontologie des pädagogischen Berufs. Das mag wenig befriedigend sein für den akademischen Teil der Zunft. Es ist eine pragmatische Lösung, ein Notbehelf. Aber es ist die einzig mögliche. Und wem sie nicht reicht, der mag sich trösten. Jeder andere Künstler hat dasselbe Problem. Rechtfertigen kann er sich nur individuell. Und immer erst, wenn ihm ein Werk gelungen ist, kann man das Werk überhaupt erkennen. Er muß es jedes Mal neu drauf ankommen lassen. Auf den Beifall des Publikums darf er dabei nicht warten.
III.
Nur der Sinn für das Ästhetische ist es, der uns in unserem Innern den ersten festen Standpunkt gibt.
J. G. Fichte
Und
doch ist er nicht nur auf seine Laune angewiesen und darauf, ob er „ein
gutes Gefühl“ dabei hat. Dass Pädagogik da, wo sie gelegentlich aus der
beiläufigen Alltagspraxis herausragt, eine Kunst ist und so real, so
objektiv und so gültig wie jene, ist mehr als eine Metapher. Denn wenn
beide zwar keine Wissenschaft sind, so „handeln“ sie ja irgendwie doch
„vom Leben selbst“. Es gibt ‚Gehalte’ des Erlebens, die – jedenfalls
innerhalb unserer Kultur – einem jeden bekannt sind und über die er
darum mit jedem andern reden kann, nämlich mit den bildhaften Wörtern
der Alltagssprachen. Aber im diskursiven System der wohldefinierten
Begriffe, wo wechselweis der eine den andern begründen muss, könnte er
sie nicht lokalisieren. Weil sie anscheinend gar nicht „darinnen“
liegen, sondern irgendwo an seiner Grenze – als das, was dem Drinnen
erst Bedeutung gibt. Das sind, mit einem altertümlichen Wort zu reden, Existenzialien,
die dem je individuellen Leben gewissermaßen als vorausgesetzt
begegnen. „Urphänomene“ sagte Goethe dazu – also etwa Liebe,
Leidenschaft, Freiheit, Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und
Anstand. (übrigens auch Komik und Wissen.) Ein jeder für sich ‚weiß, was
gemeint ist’. Sobald er es aber einem andern erklären soll, dann geht
es ihm wie Augustinus mit der Zeit – er kann es nicht sagen. Und je
kritischer der Geist, der im öffentlichen Diskurs waltet, umso mehr
neigen die ‚existenziellen’ Begriffe dazu, aus dem aktiven Wortschatz zu
verschwinden. Wenn sie dann nicht mehr in den Reden vorkommen, finden
sie doch noch ihren Ausdruck in den Haltungen der Menschen, und da kann
man sie sehen. 
Dass sie sich seit drei Jahrtausenden – seit das Definieren begonnen hat – der Definition widersetzen, zeigt an, dass sie zur Exposition in diskursiver Wissenschaft nicht taugen. Sie können allenfalls in Bildern gezeigt und in Mythen erzählt werden, denn sie sind uns nie positiv gegeben, sondern immer als Problem. Wir ‚haben’ sie nicht, sondern wir ‚meinen’ sie nur. Das ist auch eine Form von Wissen (oder ‚Gewärtigkeit’), aber eben nicht Wissenschaft, sondern Kunst. Die Kunst „erscheint, als hätte sie gelöst, was am Dasein Rätsel ist“, steht bei Th. Adorno. Sie ist nicht das Leben, und sie ‚dient’ ihm auch nicht wie die Wissenschaften. Sondern sie stellt es dar – als sein Anderes, an dem es ‚sich selbst erkennt’. Ob nämlich ihre Verheißung nur eine Täuschung ist, sei selber ein Rätsel, fügte Adorno hinzu. Das immerhin hat die Kunst mit der Wissenschaft gemein: dass sie das Andere des Lebens ist. „Wissenschaft ist Kunst, aber Kunst ist nicht Wissenschaft“, fand der ungarische Musiker Sándor Végh. Und wenn das Leben ‚bestimmt’ werden sollte (was es aber nicht nötig hat), so wäre es nur zu bestimmen als das Andere dieses Anderen.
Der Gegenstand der Pädagogik ist ‚das Leben selbst’, und dessen Grund ist ein Problem. Lösen lässt es sich besten Falls „als ob“, als schöner Schein. Auch dies – eine Notlösung, immer nur vorübergehend, aber die einzig mögliche. Pädagogik ist Kunst und nicht Wissenschaft. Einverständnis erzwingen kann sie nicht. Ihre Logik ist auch idealiter kein Kreislauf, sondern Schweben ohne Ende. Und als Herbart das Hauptgeschäft der Erziehung vor zweihundert Jahren als „die ästhetische Darstellung der Welt“ bestimmte[15], traf er genauer ins Schwarze, als er sich träumen ließ. Sie ist eine ästhetische Praxis und wo sie glückt, rechtfertigt sie sich aktual – hier und jetzt und anschaulich. Ihr Gegenstand ist ein Rätsel. Das Rätsel in ihren Bildern zu zeigen und in ihren Mythen zu erzählen ist ihre vornehmste Arbeit – solange Menschen in dem Alter sind, wo sie dafür Muße haben und das Rätsel noch lockt. Hinterher ist es zu spät.

[2] Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 129, in: Werke Bd. I, Frankfurt 1984
[3] aaO, S. 80
[4] ders., „Vorlesungen von 1826“, in: F. Schleiermacher, Texte zur Pädagogik,
Bd. II, Frankfurt 2000; S. 142 ff.
[5] Antoine de Montchrétien, Traité d’économie politique, 1615
[6] Der Umschlag von Darstellung in Kritik ist nachzulesen in: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, Berlin 1983; namentlich S. 381-423; also in dem (fälschlich so genannten) „Formen“-Kapitel, das in Wahrheit das Kapitel von der „sogenannten ursprünglichen Akkumulation“ ist.
[7] épistémé statt doxa: „Messen, zählen, wägen“ – so Plato in Politeia, 525ff, 602d; Protagoras, 356e/357a.
[8] G. B. Vico in Liber metaphysicus (1710); dt. München 1979
[9] Pädagogische Theorie handle überhaupt nur von der Tätigkeit der Professionellen, sagt Schleiermacher 1826 lapidar zur Einleitung in seine pädagogischen Vorlesun-gen; doch „was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen“: sie ist „Praxis“ – und eo ipso „schon begründet“! (aaO, S. 7ff.; S. 145 )
[10] Das ist das durchgängige Thema in Herbarts Pädagogik: Erziehung geschieht beiläufig und medial, nämlich beim ‚Zeigen der Welt’.
[11] schlimmes Beispiel: Hans-Jochen Gamm, Allgemeine Pädagogik, Reinbek 1979
[12] so Hermann Giesecke, Einführung in die Pädagogik, München 1973, S. 14
[13] Zwar widmet er der Frage „Wer soll erziehen?“ ein eignes Kapitel; doch endet es in dem Seufzer, er sehe keinen anderen Rat, „als die Untersuchung hier abzubrechen und zu sagen, wir müssen an die jetzt bestehende Form der Erziehung unsere Theorie anschließen“. AaO, S. 68
[14] Das übrigens verstand Herbart unter Erziehung „durch Unterricht“.
[15] SW Bd. XI, Langensalza 1892; S. 213-233
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. Die Grenzen der pädagogischen Vernunft
oder: Taugt Erziehung zur Wissenschaft?
zuerst in: PÄDForum 2/2003
Ich
kann von dem, was ich sollte, keinen Begriff haben, bevor ich es tue.
Einen Akt der Freiheit begreifen wollen, ist absolut widersprechend.
Eben wenn sie es begreifen könnten, wäre es nicht Freiheit.
J. G. Fichte
Erziehung,
was ist das? „Alles ist Erziehung!“ strahlt der Pädagoge. Wenn alles
Erziehung ist, dann ist nichts Erziehung. Ist Erziehung alles und
nichts? Das klingt weise!
 Der
Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt
ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm
nicht durch sein Erbmaterial, sondern
durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand
unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins
Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie
kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der
Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als
willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der
Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als
er dachte.
Der
Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, sagte Herder. Das heißt
ja wohl, alles, was ihn als Menschen vom Tier unterscheidet, wird ihm
nicht durch sein Erbmaterial, sondern
durch andere, künstliche Bedeutungsträger mitgeteilt. Herder verstand
unter Erziehung ungeniert Nachahmung: den „Übergang des Vorbilds ins
Nachbild“.1 Wenn aber Kultur immer nur Abklatsch ist – wie
kann sie sich da entwickeln? Woher kam dann das immer Neue in der
Geschichte der Menschen? Ein Verdacht regt sich: Es ist nur als
willkürliche Zutat der Erzieher denkbar. Die Pädagogik als Subjekt der
Gattungsgeschichte! Herder war vielleicht mehr Sohn der Aufklärung, als
er dachte.
Begriffliche
Schärfe lag nicht in seinem Temperament. Gelegentliche Aporien machten
ihm nichts aus (denn mit dem tendenziösen Mißverstehen eines
selbstsüchtigen Berufsstandes mußte er zu seiner Zeit noch nicht
rechnen). Erziehung, wie er sie arglos verstand, gehört zum Menschen,
seit er aufrecht geht, das heißt, seit Jahrmillionen; und zwar ganz
selbstverständlich, ohne dazu einer besondern Theorie, einer begründeten
Methode oder gar – eines besondern Berufsstands von
Erziehungstechnikern zu bedürfen. Ganz selbstverständlich ist dagegen
heute, daß Erziehung methodisch zu geschehen hat, daß sie als
Wissenschaft zu betreiben, und daß sie – das ist wohl das mindeste –
durch ausgebildete Professionelle zu verabfolgen ist, an denen sich
dilettierende Eltern bitteschön ein Vorbild nehmen sollen.2
Wie konnte es so weit kommen? Landläufig gilt Plato als Begründer pädagogischer Theoriebildung.3 Ein originäres Interesse an pädagogischer Erkenntnis hatte er aber nicht. Er fragte 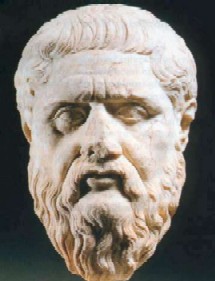 nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
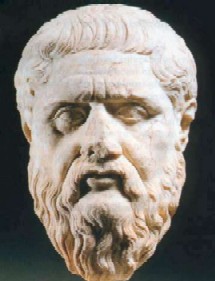 nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
nach
der besten Verfassung des Staates – und danach erst nach der geeigneten
Ausbildung für dessen Regierungspersonal, und es ist kein Zufall, dass
sein Idealstaat so sehr dem aristokratischen Sparta ähnelte und so wenig
dem demokratischen Athen. Sicher kann man, wenn man will, aus seinen
Ausführungen eine allgemeine pädagogische Theorie extrapolieren. Nur, in
welcher Absicht? Um Sparta zum Vorbild zu machen? Platos Erziehungsplan
stand im Dienst eines politischen Programms. Worauf er aber nicht
gekommen ist: die richtige Staatsverfassung durch richtige Erziehung
einführen zu wollen. Denn dazu hätte es einen geben müssen, der sowas
machen kann. Die Idee selbst setzt ein Subjekt voraus: die pädagogische
Zunft. Mit andern Worten, zu einer eignen Wissenschaft fehlte noch das
nötige Erkenntnisinteresse.
Was ist Wissenschaft?
Wissenschaft
gibt es nicht an sich, etwa im Unterschied zu andern möglichen Weisen
des Wissens. Schon gar nicht ist jede gut sortierte Anhäufung von
Wissensstoff gleich „Wissenschaft“. Die Himmelskunde der Babylonier, die
doch auf genauer, geduldiger und systematischer Beobachtung beruhte,
war so umfassend, daß sie vom Abendland zweitausend Jahre lang nicht zu
überbieten war. Aber sie diente bloß den Astrologen. Einen andern Sinn
kannte sie nicht.4
 Wissenschaft
ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist
wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er
unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt
oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen
wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen
auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern
zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –
und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.
Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6
Wissenschaft
ist auch nicht wahres Wissen im Unterschied zum Irrtum. „Ein Satz ist
wahr oder falsch – gleichgültig, ob er bewiesen ist oder nicht, ob er
unbeweisbar ist, eventuell sogar beweisbar unbeweisbar ist, ob er direkt
oder indirekt, so oder anders bewiesen wird.“5 Das Spezifische der Wissenschaft ist aber gerade, daß dort bewiesen
wird. Wissenschaft entsteht, wo ein Bedarf an bewiesenem Wissen
auftritt: einem Wissen, das so mitgeteilt werden kann, daß es den andern
zum Einverständnis nötigt. Ein solcher Bedarf entstand typischerweise –
und nur – in der modernen westlichen, der bürgerlichen Gesellchaft.
Wissenschaft hat einen Stichtag: Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica erschienen 1687 in London.6
Die
bürgerliche Gesellschaft ist wesentlich öffentlicher Raum. Aber die
öffentliche Meinung ist „von Natur“ gespalten. Wissenschaft vermag das
Feld des Meinungskampfs einzuengen, indem sie Einverständnis erzwingt;
sie ist öffentliches Wissen.7 Ihr Aufstieg im Zeitalter der
Moderne war das politische Ereignis par excellence. Je mehr Bereiche des
öffentlichen Lebens von Wissenschaft durchdrungen werden, umso weiter
reicht das Feld politischen Einverständnisses. Nichts anderes bezeichnet
Max Webers Wort von der „Rationalisierung der Welt“, deren äußeres
Merkmal ihre Verrechtlichung ist.8
Ihre
das Einverständnis erzwingende Macht verdankt Wissenschaft ihrem
systematischen Fortschreiten von der Sicherung ihres logischen Grundes
hier – zur begrifflichen Erfassung ihres Gegenstands da. Reale
wissenschaftliche Forschung bewährt sich als die alltäglich immer neu zu
leistende Vermittlung zwischen ihrem Grund und ihrem Gegenstand.9 So kann es scheinen, als sei die Methode selber die Wissenschaft. Das verdanken sie beide ihrem Stifter. René Descartes identifizierte zwei Substanzen in der Welt, res extensa – Körper, Materie, deren wesentliche Bestimmung ihre Räumlichkeit ist – und res cogitans, die immaterielle denkende Seele.
Dies
ist das Grundmuster des modernen Weltbilds: da das unendlich
ausgedehnte, von allgemeingültigen Gesetzen regierte Universum, und hier
das souveräne Subjekt. Erkenntnis ist möglich, weil sie von ihrem
gemeinsamen Schöpfer mit demselben Gesetz ausgestattet sind. Was findet
nämlich die denkende Seele, wenn sie, von allen (trügerischen)
sinnlichen Eindrücken absehend, sich selber auf den Grund geht? Die
klaren und eindeutigen Verfahren der Mathematik, als der reinen
Anschauung räumlicher Verhältnisse. Descartes machte Epoche, als er sich
„entschied, nichts für wahr anzunehmen, was mir nicht so klar und so
gewiß erschiene wie die Demonstrationen der Geometer“.10
Wissenschaft bedeutet seither: die Welt more geometrico
rekonstruieren, und Vernunft heißt, sich – nach mathematischem Muster –
logische Beziehungen wie räumliche Verhältnisse denken. Auf dieser
„Verräumlichung“ des modernen Bewußtseins11 beruht ein
Kausalitäts-Begriff, der dem Modell der klassischen mechanischen Physik
nachgebildet ist und das Alltagsbewußtsein bis heute prägt,12 und noch die Zeit erscheint als eine zu durchmessende Strecke.13
Das physikalische Modell…
Zum
Inbegriff der Wissenschaft wurde die Physik, indem sie im 17.
Jahrhundert ihren über Jahrtausende verstreut abgelegten Wissensbestand
durch methodisches Einordnen in das Spannungsfeld zwischen (zu
sicherndem) Grund und (zu bestimmenden) Gegenstand zu einem System
bildete. Nicht Forschung hatte physikalische Kenntnisse erworben,
sondern die praktischen Kühnheiten der Handwerker, Baumeister, Seefahrer
und Soldaten. Die waren nicht öffentlich, sondern sorgsam gehütet in
zünftigen Werkstätten, Dombauhütten,  Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
 Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
Kontoren und
Fürstenhöfen. Und hätte man sie veröffentlichen wollen – ja wie denn?
Erst mit dem Buchdruck wurde ein Speicher erfunden, der das Wissen
allgemein zugänglich machte.14
Mit der Renaissance wuchsen die Kenntnisse auf allen Gebieten
explosionsartig an. Schrittmacher der Physik waren die Uhrmacher für die
Mechanik, die Optiker und Seeleute für die Himmelsphysik, die Festungsbauer (frz. le génie) für die Statik, die Kanoniere für allerlei…
Zur
Theorie wurden sie nicht an der Universität geordnet, sondern in den
Privaträumen denkender Liebhaber – Descartes war Reiteroffizier, Newton
leitete die Londoner Münze. Die Theorie hatte der Physik
jahrtausendelang vielmehr den Weg versperrt. Das war der Fluch ihrer
frühen Geburt: Das abendländische Denken begann bei den ionischen
(kleinasiatischen) Griechen als Natur-Philosophie, als meta-physische Spekulation über ‚Ein und Alles’, wo die Natur – gr. physis
– gemeinsam mit allem Denkbaren in einem unlösbaren Durcheinander
unterging, aus dem sie die rein zufälligen Experimente einzelner
Neugieriger nicht herausholen konnte. Unter der Herrschaft der römischen
Kirche war an eine Lösung der Natur aus der Theologie schon gar nicht
zu denken.
Dazu
bedurfte sie des Eingriffs der Mathematik. Die mittelalterlichen
Scholastiker hatten mit ihrer gnadenlosen Logik der Wissenschaft den
Boden bereitet, das sei nicht vergessen. Nichts ließen sie gelten, als
was mit überprüfbaren Gründen bewiesen wurde,15 und ihre
Disputationen fanden öffentlich statt. Aber ihnen waren seitens der
Gegenstände wie seitens der Gründe von der Theologischen Fakultät enge
Grenzen gesetzt, und ihre Gelehrtenrepublik – von Salamanca bis Wilnius,
von Palermo bis Uppsala – zählte nur ein paar hundert Köpfe.
Doch
der Mathematik konnte keiner Grenzen setzen, und auf Hörsäle war sie
gar nicht erst angewiesen. Sie war universell und unwiderstehlich. Sie
war nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem
kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr
Interesse auf die Arithmetik konzentriert. Aber Mathematik entstand
erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst
der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das
Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt16 – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion.17
Auf
etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie
nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte
sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden:
„die Naturerscheinun- gen auf mathematische Gesetze zurückzuführen“,18 und nur darum galten die Konstruktionsregeln der Mathematik  fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik
überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber
unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend
immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird
geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und
nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In
den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik
überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber
unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend
immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird
geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und
nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In
den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
 fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik
überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber
unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend
immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird
geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und
nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In
den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
fortan
„als allgemeingültige Naturgesetze, von denen die Dinge selbst geformt
werden“[19]. Diese ‚Methode’ macht eine besondere Metaphysik
überflüssig, weil sie selber metaphysisch ist – aber
unausgesprochen.[20] Ein ‚letzter Grund’ bleibt dabei stillschweigend
immer vorausgesetzt, und ob oder wie er sich auffinden läßt, wird
geflissentlich den Philosophen und anderen Hirnwebern überlassen, und
nicht viel anders steht es mit dem ‚Gegenstand an sich’, der Welt. In
den realen Wissenschaften begnügt man sich pragmatisch mit der Methode, und ihre Ergebnisse bewährten sich jeden Tag aufs Neue: in der Industrie.
…schafft auch nicht alles.
Die
wichtigste Leistung der Wissenschaft war die industrielle Revolution.
Mit ihr trat seit Mitte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche
Geschehen in den Mittelpunkt öffentlichen Streits.21 Wenn sich Descartes’ wissenschaftliches Programm irgendwo zu bewähren hatte, dann hier. Das meinte der Mediziner Dr. Quesnay und ging daran, die Wirtschaftstätigkeit der Menschen nach physikalischem Vorbild als ein naturgesetzliches System zu fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
 fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
fassen:22
So wie im lebenden Körper das Blut, so zirkulierten in der Gesellschaft
die Werte. Als deren ‚Grund’ machte er die Produktivkraft der Natur
(der Physis, d. h. des Ackerbodens) aus, weshalb sein System das
‚physiokratische’ hieß.
Es hatte aber den Mangel, daß aus der Produktivität des Bodens den Werten kein Maß erwachsen konnte. An ihre Stelle setzten Adam Smith und David Ricardo daher im ‚Klassischen System der Politischen Ökonomie’ die Produktivität der menschlichen Arbeit.23 Das Wertgesetz
lautet: Die Waren tauschen sich gegen einander nach Maßgabe der in
ihnen dargestellten Arbeitsmenge. Es war politisch in einem unerwarteten
Sinn.24 Ließ sich nämlich die bürgerliche Gesellschaft als
geschlossenes System darstellen, das sich durch ebenso natürliche wie
vernünftige Gesetze selbst-begründet, so erschien sie als gerechtfertigt – gegen den untergehenden Erbadel sowohl als gegen das aufkommende Proletariat.
Politisch
waren auch die Motive für die Kritik daran. Doch ihre ‚Methode’ bestand
zunächst nur in dem Versuch, das ‚System’ abschließend darzustellen.
Doch was zeigte sich? Zu Grunde liegt ihm in Wahrheit ein „fehlerhafter
Kreislauf“: Was erklärt werden müßte, wird schon vorausgesetzt!25
Wenn nämlich die Arbeit in den Austauschprozeß der Werte (=Waren) als
Maß eingreifen soll, dann muß sie selber regelmäßig als Ware
ausgetauscht werden. Mit andern Worten, das Wertgesetz setzt Lohn-Arbeit
voraus.
Es
setzt voraus, daß eine Klasse von Leuten entstanden ist, die nicht die
Mittel (Werkzeuge, Rohstoffe) haben, um ihre eigene Arbeit in
Gebrauchsgütern zu vergegenständlichen, die sie mit andern tauschen
könnten, und darum die Arbeit selbst als Ware veräußern müssen.26
Setzt voraus, daß die Masse der Bevölkerung von ihrer angestammten
Scholle vertrieben war. „Die Expropriation des ländlichen Produzenten,
des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen
Prozesses.“27 Und das war kein naturgesetzlicher und kein
ökonomischer Vorgang, sondern ein historischer Gewaltakt. Das ‚System’
hat sich nicht ‚selbst begründet’, der ‚Wert’ ist nicht aus dem ‚Gesetz’
hervorgegangen, sondern aus einem ungleichen Kräfteverhältnis, und die
bürgerliche Gesellschaft wurde nicht gerechtfertigt, sondern fix und
fertig vorausgesetzt.
Wissen wozu?
Alles
kann irgendwie ‚gewußt’ werden. Oder richtiger, indem es gewußt wird,
kann Alles überhaupt nur ‚sein’. Doch wie der Gegenstand bestimmt wird,
hängt anscheinend davon ab, wer was wozu wissen will. Erst recht hängt
davon ab, wie es wem zu beweisen ist.
Die
Politische Ökonomie konnte offenbar nicht in derselben Weise
Wissenschaft werden wie die Physik. In dieser wirken ‚Naturgesetze’,
aber in jener wirken lebendige Menschen, und auf deren Gesetzestreue ist
kein Verlaß. Man kann auch sagen: Im Menschenleben gibt es ein Moment
von Freiheit, das sich nicht berechnen läßt. Man hat darum die  Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.
Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.
 Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.
Naturwissenschaften, in denen Phänomene
aus ihren Ursachen erklärt werden, von den sog. Geisteswissenschaften
unterschieden, die Handlungen aus ihren Motiven verstehen wollen:28
In jenen beschäftigt sich der denkende Mensch mit den Dingen außer ihm,
und in diesen beschäftigt er sich mit sich selbst. Doch diese
Unterscheidung ist nur vorläufig, denn sie läßt sich nicht bestimmen.
Auch aus den Dingen lesen wir nämlich nur heraus, was wir vorher von
ihnen erfragt haben, unsere Motive stecken immer auch mit drin.
Stattdessen wurde vorgeschlagen, zwischen ‚nomothetischen’ und ‚idiographischen’ Wissenschaften zu unterscheiden:29
zwischen solchen, die ‚Gesetze formulieren’, und solchen, die
‚Einzelnes beschreiben’. Die einen bestimmen das als ihren Gegenstand,
was den Dingen gemeinsam ist, die andern das, was sie unterscheidet.
Zwar erfordert die Vermittlung zwischen dem Sichern des Grundes und dem
Bestimmen des Gegenstands jedesmal dieselbe methodische  Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
 Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
Sorgfalt.
Dennoch hat das Idiographische seine wissenschaftliche Würde nicht
recht durchsetzen können: Als Wissenschaft gilt eben doch nur, was
‚Gesetze’ entdeckt – denn nur dann kann ich was damit anfangen:
Die „Arbeits- und Leistungswissenschaft trägt heute unsere gesamte
Weltzivilisation und alle Technik und Industrie“; ihr entspricht „ein
Weltbild in mathematischen Gleichungen, das es ermöglicht, den
Weltprozeß… gehen zu machen nach beliebigen praktischen Zwecken“.30
Und
so erscheint es, als sei das einzige Wissen, das diesen Namen verdient,
dasjenige, das unsere Macht über besagten Weltprozeß mehrt.
‚Herrschaftswissen’ hat es Max Scheler genannt32 – und hat
daneben ein ‚Bildungswissen’ gestellt, das unsere „geistige Person“
prägt, sowie ein – wie er es nannte – ‚Erlösungswissen’, das dem
persönlichen Leben seinen Sinn weist. Doch Bildungs- und Erlösungswissen
drängen nicht an die Öffentlichkeit, denn sie bedürfen niemandes
Einverständnis’. Sie können mitgeteilt werden; Herrschaftswissen muß. Es
ist der Typus der Wissenschaft.
Bevor
wir zu der Frage kommen, wer was wozu vom Erziehen wissen will, und ob
dies Wissen zur Wissenschaft taugt, sei eine weitere Unterscheidung
eingeführt: Kants Trennung von ‚theoretischem’ und ‚praktischem’ Wissen.
Dieses hat alles zum Gegenstand, was ist; jenes das, was sein soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist.“33
‚Durch Freiheit möglich’ sind die Zwecke, die wir uns selber setzen.
Theoretische Wissenschaft kann die ‚Gesetze’ aufzeigen, derer wir uns
bedienen, um unsere Zwecke zu verfolgen. Aber Zwecke setzen kann sie
nicht.
So
hat sich die Politische Ökonomie seit der Marx’schen Kritik zu dem
zurückentwickelt, was sie an ihrem Anfang war – ein Inventar von
Techniken der Wirtschaftspolitik.34 Könnte sie wirklich
lehren, wie man die Produktion steigert, wäre sie ‚theoretisch’ im
selben Sinn wie etwa die Ingenieurswissenschaften. Wie aber das Produkt
etwa ‚gerecht verteilt’ werden soll, wäre eine praktische Frage, die
‚durch Freiheit’ zu entscheiden ist – von der Politik, nicht von der
Wissenschaft. Einverständnis kann darüber nicht durch Gründe erzwungen
werden, weil es um Zwecke geht, und die werden nicht erwiesen, sondern
postuliert.
Normalisierung
 Das
Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von
äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die
Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das
Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu
erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte
uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken
lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert
werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,
dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.
Das
Heranwachsen der kommenden Generation ist nun eine Angelegenheit von
äußerstem öffentlichen Interesse, darf man sagen. Eher noch als die
Volkswirtschaft wäre dies der Ort, das
Feld öffentlichen Meinungskampfs einzuschränken und Einverständnis zu
erzwingen. Doch selbst angenommen, eine theoretische Wissenschaft könnte
uns (besser als die Volkswirtschaftslehre) die richtigen Techniken
lehren – es geht ja immer erst um die Zwecke! Die müßten postuliert
werden. Aber von wem? Wenn sich schon Postulate nicht begründen lassen,
dann sollte sich der Postulierende doch immerhin rechtfertigen können.
Das
Problem ist hier offenbar das Subjekt. Wer darf die Zwecke der
Erziehung postulieren? Die Öffentlichkeit? Aber die ist gespalten. Darum
ging es doch gerade: die Öffentlichkeit durch zwingende Gründe zu einem
Subjekt zu bilden – dazu war Wissenschaft da! Wieder ein „fehlerhafter
Kreislauf“: Um postulieren zu können, müßte sie sich zum Subjekt bilden;
aber um sich zum Subjekt zu bilden, bräuchte sie Wissenschaft. Aber
deren Zweck sollte sie ja erst noch postulieren!
Darum
postuliert ‚die Öffentlichkeit’ in dieser Sache auch nicht selber. Das
überläßt sie stellvertretend dem Berufsstand der erwerbsmäßigen
Pädagogen. Es scheint auch nahe zu liegen: Es ist ja ihr Beruf, da
werden sie schon wissen, was sie tun. Ein Arzt weiß, was er tut, weil er
nicht nur ein Handwerk gelernt, sondern auch eine Wissenschaft studiert
hat. Der Kfz-Mechaniker hat zwar keine Wissenschaft studiert, aber wenn
er nicht wüßte, was er tut, würden seine Machwerke nicht laufen. Und
wüßte die Köchin nicht, was sie tut, müßten alle spucken.
Daß
Pädagogen einen Beruf ausüben, beweist aber nicht, daß sie wissen, was
sie tun. Ein Handwerk mögen sie gelernt haben, doch ob ihre Machwerke
‚laufen’, mag im einzelnen jedesmal bezweifelt werden – denn wo ist das
Maß? Gespuckt hat schon mancher. Und ob das, was sie studiert haben,
eine Wissenschaft ist, steht eben in Frage.
Doch
wenn sie zwar nicht mit zwingenden Gründen Einverständnis schaffen, so
stehen sie doch zum gesellschaftlichen Konsensus irgendwie in einem
privilegierten Verhältnis. Denn von alters ist es der Berufsstand der
Pädagogen, der für Normalität sorgt! Das hat ihn gerechtfertigt und zum
Postulieren befugt. Doch wer wagt heute noch zu sagen, was normal ist?
Den Pädagogen kommt ja nicht mal mehr das Wort über die Lippen!35
Die
Rechtfertigung des Pädagogenstandes war eine historische. In
vorbürgerlichen Gesellschaften gab es keine Normalität. Sie sahen aus
wie Flickenteppiche aus soundsoviel verschiedenen Nischen, die nur
äußerlich verbunden schienen: durch Handelswege und dynastische
Herrschaft. Jeder war an seiner Statt so, wie er eben war und wuchs in
die Besonderheiten seiner Umwelt hinein, sich von Anfang an nach Maßgabe
seiner je entwickelten Kräfte an deren besonderer Reproduktionsweise
beteiligend, mitmachend, learning by doing – und die er normalerweise sein Lebtag nicht verließ: Werkstatt, Laden, Acker, usw.
Mit
zwei Ausnahmen: Ein Handwerk gibt es, das man nicht durch Mitmachen
erlernen kann, das Kriegshandwerk. Es bedarf einer vorgängigen
Ausbildung der technischen Fertigkeit  sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
 sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
sowohl
als einer Entwicklung der Körperkraft. Ähnlich stehts mit jenem andern
Ursprung der herrschenden Klassen, der Priesterschaft.
Deren Ausübung bedarf der vorherigen Einweihung ins göttliche
Geheimnis. Seit die Religion aber in Schriftform tradierbar ist, wird
die religiöse Bildung auf weite Strecken formalisierbar: Die Kleriker
haben die Schulen erfunden.
Eine
Besonderheit der westlichen Entwicklung: mit der Feudalisierung
entsteht im christlichen Adel eine Kriegerkaste, die – teils in
Abhängigkeit vom Klerus, teils in Konkurrenz – selber zum Kulturträger
wird: Bildung wird, wie bei Plato, zur Legitimation des Berufs zum
Herrschen. Bildung  ist
ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger
und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in
München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein
Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.
ist
ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger
und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in
München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein
Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.
 ist
ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger
und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in
München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein
Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.
ist
ein Kastenprivileg. Und beachte: durch ihre Ausbildung wurden Krieger
und Pfaffen mobil! So konnte ein Mönch aus der Grafschaft Surrey in
München zum Chefideologen beim römisch-deutschen Kaiser werden, und ein
Ritter aus den Ardennen wurde König von Jerusalem.
In
der bürgerlichen Gesellschaft wird Bildung zu einer allgemeinen
Aufgabe. Sie zersetzt die partikularen Umweltnischen durch ihre
Vereinnahmung ins Marktgeschehen. Sein Charakter ist, nach Dr. Quesnay,
Zirkulation. Jetzt sollen alle mobil werden. Austauschbarkeit wird zum
entscheidenden Kriterium gesellschaftlicher Wert-Schätzung.
Normalisierung, mit einem andern Wort.
 Das
heißt vor allem: Formalisierung, nämlich Verschriftlichung, und dadurch
Vereinheitlichung der bislang partikularen Standesbildungen durch
Lateinschulen, Universitäten, später Gymnasien. Seit dem Buchdruck und
dem Entstehen der Wissenschaft explodiert der Fundus sachlicher Kenntnisse und nimmt einen Umfang an, der den Rahmen des Learning by doing in einer Lebensspanne weit übersteigt. Nicht
nur der Form, sondern auch dem Gehalt nach wird Bildung nunmehr
allgemein. Motor der Entwicklung einer allgemein- verbindlichen,
„normalen“ Bildungsidee ist der wachsende Bedarf an qualifizierten
Staatsbeamten.36
Das
heißt vor allem: Formalisierung, nämlich Verschriftlichung, und dadurch
Vereinheitlichung der bislang partikularen Standesbildungen durch
Lateinschulen, Universitäten, später Gymnasien. Seit dem Buchdruck und
dem Entstehen der Wissenschaft explodiert der Fundus sachlicher Kenntnisse und nimmt einen Umfang an, der den Rahmen des Learning by doing in einer Lebensspanne weit übersteigt. Nicht
nur der Form, sondern auch dem Gehalt nach wird Bildung nunmehr
allgemein. Motor der Entwicklung einer allgemein- verbindlichen,
„normalen“ Bildungsidee ist der wachsende Bedarf an qualifizierten
Staatsbeamten.36
Mit
der industriellen Revolution wird ein allgemeiner, wenn auch
elementarer Bildungsstandard zur Voraussetzung auch der ausführenden
Tätigkeiten in der Fabrik: „Allgemeinbildung“, Lesen, Schreiben,
Kopfrechnen… Ursache ist die fortschreitenden Kapitalisierung der
Produktionsvorgänge. Je mehr Kapital in der Technik steckt, umso teurer
kommen Bedienungsfehler. Der ideale Fabrikarbeiter ist mobil und kann
bedarfsweise von einer Maschine zur andern wechseln, ohne dabei an
Zuverlässigkeit zu verlieren. Die industrielle Zivilisation schafft den
Durchschnittsarbeiter. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt.37
Die
erziehende Tätigkeit hat ihren besonderen Ort gefunden. Dort hat sich
ein besonderer Berufsstand gebildet. Da war es nun, das postulierende
Subjekt! War es aber zum Postulieren berechtigt? Immerhin erledigt es
eine allgemeine Aufgabe – Normalisierung. Zugleich erschien ihm seine
Tätigkeit als eine besondere; so besonders nämlich, daß sie einer
speziellen Ausbildung bedarf, ja daß sie gar zum Gegenstand einer eignen
Wissenschaft bestimmt werden kann. Mit andern Worten, in der Schule
wurde Erziehung auf einen Begriff gebracht,37
und der gilt seither als das Eigentliche. Was Väter, Mütter, Onkels,
Tanten und alle andern tun, die sonstwie regelmäßig mit Kindern Umgang
haben, ist dagegen eine uneigentliche, verunreinigte, dilettantische und
– sagen wir’s nur graderaus – eine störende Mängelversion davon.
Unsere Welt und meine Welt
Das
wirkliche Verhältnis scheint auf den Kopf gestellt. Als Herder meinte,
der Mensch werde ‚nur durch Erziehung’ zum Menschen, wollte er,
gegenüber biologischer Vererbung in der Natur, die Bedeutung kultureller
Traditionen für die Ausbildung der Gattung hervorheben. Durch das
Einschmuggeln der ‚Normalität’ in die ‚Menschwerdung’ bekommt der Satz
nun einen neuen Sinn: Der Mensch wird nur durch die Erwerbstätigkeit von
Pädagogen zum Menschen. Und ‚erziehen’ wird in beiden Fällen in völlig
anderer Bedeutung verwendet: da unspezifisch, auf die Forstschritte der
ganzen Gattung bezogen; hier auf das Individuum bezogen und historisch
spezifiziert.
Daß
der Mensch ‚erzogen werden muß’, liegt daran, daß er nicht mehr in
einer biologisch definierten Umwelt lebt, sondern in einer offenen Welt.
„Für ein Tier ist durch seine umweltgebundene Organisation von
vornherein darüber entschieden, ob und inwiefern ein Naturbestandteil
dieses Wesen etwas angeht. Uns kann jeder noch so unscheinbare
Teilbestand der Umgebung bedeutend werden. Uns kann alles etwas
angehen.“38 Eine Umwelt ist ein Inventar natürlicher Dinge,
die sich selbst bedeuten.* Die Welt ist ein Tableau von Bedeutungen, die
in Symbolen dargestellt wurden.39
Es
sind nicht sowohl die Dinge, die kulturell tradiert werden, als die
Bedeutungen. Während seiner „extra-uterinen Embryonalzeit“ ist der
Mensch noch in seine Umwelt gebunden; doch bereitet sein „noch im
Stadium der Ausreifung vor sich gehender früher Kontakt mit dem offenen
Reichtum der einströmenden Reizfülle“ den Grund für seinen spezifisch
menschlichen Wesenszug: „seine Weltoffenheit“.40 Erziehen
heißt nun, einem Menschen die Dinge zeigen und die Symbole, die ihm die
Welt bedeuten. Doch haben die in den Symbolen aufbewahrten Bedeutungen
einen andern Realitätsgrad als die Dinge. Sie ‚sind’ nämlich nur, sofern
ich sie gelten lasse. Denn der Mensch ist das Tier, das nein sagen kann;41 auch dazu: zur Meinung der Andern. Das heißt, ‚die Welt’ wird überliefert, aber seine Welt bildet sich jeder selbst..
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, sagt Ludwig Wittgenstein,42
aber das ist falsch. Die Grenzen unseres gemeinsamen Symbolsystems –
das ist mehr als Sprache – sind die Grenzen unserer gemeinsamen Welt;
nämlich ihrer Mitteilbarkeit (und die erheischt Bestimmtheit).43 Meine Welt hat andere Grenzen, denn in ihr können auch  Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
 Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
Bilder
vorkommen, die ‚nur sich selbst bedeuten’ – und daher unbestimmt
bleiben dürfen: Das ist ihre ästhetische Qualität. Wovon ich nicht
sprechen kann, darüber muß ich nicht schweigen: Ich kann es zeigen.
‚Symbole’, nämlich Bedeutungsträger für andere, können auch Bilder
werden. Sie irrlichtern dann am Rande ‚unserer’ Welt und beleuchten ihn.
Als da wären die ‚Existenzialien’ wie Liebe, Leidenschaft, Freiheit,
Sinn, Schönheit, Grauen, Glück, Ehre und Anstand; übrigens auch Komik
und… Wissen.
Kein verständiger Kopf würde sie bestimmen wollen. Aber gezeigt werden sie oft und gern – in den Bildern der Kunst.44
Nicht zuletzt darum übrigens ist die Welt, im Unterschied zu den
geschlossenen Umwelten, offen: weil in meiner Welt Anderes vorkommen mag
als in der der Andern45 – und ich es ihnen zeigen kann.
Gebildet ist, wer sein Leben in ‚seiner’ Welt und in ‚unserer’ Welt
gleichzeitig führt, ohne sich zu verlaufen. Nur als Bildung läßt
Erziehung sich rechtfertigen.
Alles,
was als Tatsache in ‚unserer’ Welt vorkommt, läßt sich auch bestimmen;
nämlich in das allgemeine Bedeutungsgeflecht einpassen, wo Jedem seine
Bedeutung durch die Bedeutung aller Andern zugewiesen wird. Reflektieren
heißt nichts anderes als: seinen Platz im großen
Verweisungszusammenhang aufsuchen. Was bestimmt ist, kann Bestandteil
einer Wissenschaft werden – weil sich sein logischer Zusammenhang
demonstrieren und Einverständnis erzwingen läßt. Was demonstriert werden
kann, läßt sich erlernen.
Was
dagegen ‚durch meine Freiheit möglich’ wurde, läßt sich eo ipso nicht
bestimmen. Es liegt allein in ‚meiner’ Welt. Ich kann es nicht erlernen,
sondern muß es erfinden und mir einbilden. Einverständnis der andern
kann ich nicht erzwingen, sondern höchstens ihren Beifall heischen: sie
animieren, meine ‚Anschauung’ nach-zu-erfinden. Das Nacherfinden kann
nicht gelehrt werden: dazu muß man verführen, und das ist Kunst.
Gegenstand von Wissenschaft kann es nur ‚idiographisch’ werden: kritisch
und historisch.
Das Labor und das Leben
Eine
Welt braucht jeder von uns, weil wir unsre Umwelt verlassen haben. Aber
eine gemeinsame Welt brauchen wir, weil wir zusammen arbeiten müssen.
Vereinfacht, aber kaum verkürzend kann man sagen: ‚Unsere’ Welt
verdanken wir der Arbeitsgesellschaft, und Wissenschaft ist ihr Abbild.
In der Arbeitsgesellschaft gilt ‚unsere’ Welt als die ganze Welt, was in
ihr nicht vorkommt, ist nicht real. Aber nur in der Arbeitsgesellschaft
kann keiner leben, nicht der Arbeiter und nicht einmal sein Chef. Nach
Feierabend darf verkehrte Welt sein, wenn man’s bezahlen kann, und gilt
ein Kunstwerk nicht nur als Sachanlage. Aber das liegt jenseits der
Realität.
Die
Schule will die Arbeitsgesellschaft als das wahre Leben und ‚unsere’
Welt als die wahre Welt, will Wissenschaft als das wahre Wissen lehren.
(Die musischen Fächer setzen ein paar Gänsfüßchen hintan, aber keiner
nimmt sie ernst.) Und jedenfalls sind die Grenzen ihrer Welt die Grenzen
ihrer Wörter: „Pädagogisches Handeln ist nur dort möglich, wo der wechselseitige
Austausch von sprachlich erschlossenen Erfahrungen möglich ist“,
schreibt Hermann Giesecke, und fügt hinzu, das sei „der Normalfall im
privaten wie im gesellschaftlichen Leben“.46 Reden über
unsere Welt – das wäre Erziehung! Nein, das ist nicht der Normalfall im
privaten wie im gesellschaftlichen Leben. Das ist der Normalfall im
pädagogischen Labor, und nirgends sonst. Nur weil schulische Pädagogik
im Labor stattfindet, kann sie sich für ‚Wissenschaft’ halten; für
‚nomothetisches’ Herrschaftswissen zumal.
Normalisierung
bedarf freilich eines mehrjährigen Aufenthalts im Labor. Dort wird auf
das gesetzmäßig Verbindende abgesehen und das individuell
Unterscheidende ausgeklammert – bei den wissenschaftlich bestimmten
Lehrgegenständen, was dachten Sie? Na ja, wenn ich’s recht besehe – bei
den Schülern auch. Natürlich werden die persönlichen Eigenheiten des
einen und der andern ‚zugelassen’, aber als Ausnahmen von der Regel. Die
Regel bleibt die Regel. Wie soll der Betrieb sonst funktionieren?
„Standards“, na bitte, ick bün all do! Das ist der methodologische Sinn
der Laborsituation: Störfaktoren ausschalten! Es ist nicht „das Leben“,
worauf die Schule vorbereitet, sondern das Arbeitsleben. Und das ist nur
ein Teil der Wirklichkeit, und zwar, am Ende der industriellen
Zivilisation, ein schrumpfender.
Die
Arbeitswelt war ‚unsere’ Welt, war Sinn und Zweck des Lebens. Es gab
noch einen Rest, der war Randbedingung, Konsumsektor, Pause und
Erholung. In der Arbeitsgesellschaft war Normalisierung ein
‚gerechtfertigtes’, nämlich aus historischer Notdurft erwachsenes
Postulat. Heute erscheint immer mehr die Arbeit als ein Rest, eine
Randbedingung des Lebens, das seine Bestimmung verloren – oder, besser
gesagt: seine Bestimmung als Unbestimmtes wiedergefunden hat. Das
wirkliche Leben spielt (sic) sich immer in einer schwebenden Spannung
zwischen ‚unserer’ und ‚meiner’ Welt ab. Wie gut sich einer in dieser
Schwebe hält, bleibt tagtäglich sein Problem. Jemanden für dies Problem
zu wappnen, ist der einzig mögliche Sinn einer Erziehung, durch die ‚der
Mensch zum Menschen wird’.
Alltagskunst
Dies
Problem ist das, was der Erziehung zu Grunde liegt. Und das ist nichts,
worauf man bauen kann. Da muß man sich durchschlagen, jeden Tag aufs
Neu’. Mit andern Worten, wer Erziehen zu einem wissenschaftstauglichen
Begriff bestimmen will, der kann auch gleich ‚das Leben selbst’ als
Wissenschaft bestimmen. Erziehung ist alles und nichts. Das ist die
erhabene Sicht auf die Sache.
Prosaisch
gesehen, ist erziehen eine Alltagsverrichtung wie kochen oder Auto
fahren. Im Prinzip kann das jeder, aber manch einer besser als manch
anderer. Wohl kann man aus diesem  eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
 eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
eine Kunst, aus jenem einen Hochleistungssport machen. Dann wird man es mit Eifer (lat. studium)
erlernen müssen. Für den Alltagsgebrauch reicht learning by doing, doch
eine gewisse Vorübung ist nötig, um Katastrophen zu vermeiden. Bei
aller Alltäglichkeit sind beide Tätigkeiten aber noch so spezifisch, daß
ich sie von all meinen andern Verrichtungen im Tageslauf unterscheiden
kann. Ich weiß, wann ich damit anfange und wann ich wieder aufhöre, und
wenn ich’s mir nicht vornehme, findet’s nicht statt. Wenn aber, sagen
wir, ein Vater mit seinen Kindern in den Zoo geht, wirkt er zweifellos
erziehend. Aber deshalb tut er’s nicht, sondern weil es Freude macht.
Nur darum wirkt es übrigens ‚erziehend’. Ginge er dagegen mit
erzieherischem Vorsatz in den Zoo, hat er alle Chancen, dass er weder
sich noch den Kindern damit Freude macht – und verfehlt die Absicht.
Wann
‚erziehen’ Eltern? Die Frage taugt als Vorlage für ein Schmunzelbuch.
Zweifellos doch, wenn sie belohnen oder strafen: denn das tun sie ja
wohl vorsätzlich. Was lernen ihre Kinder dabei? Nutzen und Schaden
abwägen. Das würden sie aber auch ohne dies lernen – vielleicht
langsamer, vielleicht schneller. Gerade dafür ist Erziehen also nicht
‚notwendig’. Tatsächlich geschieht das, was ein unbeteiligter Betrachter
Belohnung oder Strafe nennt, im täglichen familiären Kuddelmuddel nicht
vorsätzlich, sondern nebenher, ohne Kalkül. Das ist die Regel, die von
Ausnahmen bestätigt wird – welche ihrerseits nur deshalb wirken, weil
sie Ausnahmen sind. Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
 Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
Mit andern Worten, Erziehung geschieht in der Regel beiläufig,
unabsichtlich, unspezifisch, und immer, wenn es eigentlich um irgendwas
anderes geht: Erziehung ist medial, sie braucht ein Drittes. Erziehung
ist nicht Einwirkung von A auf B, Erziehung „ergibt sich“, wenn sich A
und B an C zu schaffen machen.
Einen
allgemeinen Begriff von Pädagogik – oder einen Begriff von Allgemeiner
Pädagogik – kann es nicht geben. Was es gibt, ist ein allgemeines Bild
von der pädagogischen Situation. Nämlich: Einer, der in der Welt schon
zuhause ist, begegnet einem, der dort neu ist, und ist er ein
anständiger Kerl, dann zeigt er sie ihm. Darin liegt keinerlei
Notwendigkeit, die in Begriffen, Gesetzen oder Formeln darstellbar wäre.
Es ist nur eben tatsächlich so. Die Menschen neigen dazu – weil der
Neue in diesem Bild typischerweise ein Kind ist.
 Wer
mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen.** Wie gut er sich
aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann
am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern
schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bißchen
neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags
verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben
‚meiner’ Welt scheint. Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den
Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite
der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst
ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom
pädagogischem Eros umschrieben wurde.47
Wer
mehr von der Welt kennt, kann wohl auch mehr zeigen.** Wie gut er sich
aber aufs Zeigen versteht, ist eine andre Sache. Es gelingt immer dann
am besten, wenn dabei der Eine versuchsweise durch die Augen des Andern
schaut. Denn dann erscheinen die Dinge beiden immer wieder ein bißchen
neu und zeigen ‚Seiten’, die in den Selbstverständlichkeiten des Alltags
verborgen blieben: weil dann nämlich ‚unsere’ Welt immer in den Farben
‚meiner’ Welt scheint. Das hat einen eigenen Reiz und punktiert den
Alltag mit kleinen sonntäglichen Momenten. Es ist die ästhetische Seite
der Sache, es lockt und verführt und ist das, was das Wesen der Kunst
ausmacht. Für beide ein erhebendes Erlebnis, das mit dem vagen Wort vom
pädagogischem Eros umschrieben wurde.47
Im
Alltag gelingt es umso eher, je näher Menschen einander stehen. Darum
sind Eltern in der Regel die besseren Pädagogen. Normalisieren können
sie nicht so gut, aber was ihrer Welt an schulischer Breite fehlt,
überbieten sie an anschaulicher Tiefe. Sie sind Alltagskünstler (wenn
auch vielleicht nicht alle.)
Man
kann immer noch einen Beruf daraus machen. Aber weil Normalität kein
berechtigter Erziehungszweck mehr ist, ist das Labor nicht mehr der
bevorzugte Ort. „Erziehung findet in Situationen statt, und die sind
immer konkret. Erziehen ist eine Sache des Alltags. Pädagogik ist, wo
sie theoretisch ist, Kunstlehre. Und der – gute – Erzieher ist ein
Künstler. Aber ein Aktionskünstler: er schafft keine ‚Werke’, sondern
eben nur – Situationen.“48 Seine Sache ist es, die
Situationen so zu arrangieren, daß sie den andern verlocken, (sich)
heraus zu finden; nie vergessend, daß er selber mitspielt und daß vieles
auch auf seinen Auftritt ankommt. Was es ist und wieviel es ist, wird
er wissen, wenn er es probiert. Er ist kein Ingenieur,  sondern ein Performer.
sondern ein Performer.
 sondern ein Performer.
sondern ein Performer.
______________________________________________________________________________________
*) [Nachtrag: Das ist eine saloppe Formulierung, die ich andernorts präzisiert habe.]
**) Zusatz. Je
allgemeiner die ‚Welt’, von der die Rede ist, umso unspezifischer die
Tätigkeit des Zeigens: Typischerweise bezeichnet dieses Bild in seiner
Allgemeinheit das Verhältnis zwischen einem Erwachsenen und einem Kind.
Man
kann ‚die Welt’ von einem partikularen Standpunkt aus ansehen. Je
partikularer die ‚Welt’, von der die Rede ist, umso spezifischer der Akt
des Zeigens. Die ‚Welt des Soldaten’ ist zwar eine besondere Welt, aber
sie ist ‚allgemein’, weil ‚Soldatsein’ keine besondere Verrichtung,
sondern eine besondere ‚Seinsweise’ ist; Soldat ist man auch nach
Feierabend. Das ist nicht Einweisung in Strategie und Taktik, nicht
Waffenkunde, nicht dies oder das, sondern ein ‚ganzes Universum’, wenn
auch ein besonderes. „Pädagogik“ heißt hier ‚Menschenführung’, hat aber
mit Kindern nichts mehr zu tun und sollte Andragogik heißen. Die ‚Welt
der Physik’ ist dagegen kein Universum, sondern nur ein Ausschnitt: aus
der ‚Welt der Wissenschaft’, gar nur der ‚Welt der (‚exakten’)
Naturwissenschaften’. Diese hochspezialisierte Welt einem Neuling zeigen
ist eine höchst spezifische Tätigkeit, die man von Rechts wegen Lehre
nennt. Erst hier gilt: ‚Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner
Welt’.
Je
allgemeiner die Welt, um die es geht, umso eher ist von Bildung -, je
spezifischer die Welt, umso richtiger ist von Lernen die Rede. Merke:
Die allgemeinste Welt – die, die den Meisten zugänglich ist – ist die
natürliche Welt der natürlichen Sprachen; die Welt, in denen nur Kinder
‚neu’ sind..,
Alle
Kinder werden irgendwie heranwachsen; dazu brauchen sie keine
Professionellen. Professionelle braucht es, um ihnen das „Symbolnetz“ zu
überliefern, in dem unsere ganze Welt dargestellt ist: weil das
Allgemeinwissen der Menschheit so umfangreich und dabei so komplex
geworden ist, daß es nicht mehr einfach in jedenkinds Alltag „vorkommt“
und man einfach nur, jeder an seiner Statt, dort hineinwachsen müßte,
learning by doing. Ihre Mitteilung bedarf einer reservierten Zeit
außerhalb der Alltagsgeschäfte und einer speziellen Methode, denn
natürlich kann nicht jedem alles und schon gar nicht alles zugleich
überliefert werden. Aber die Schule privilegierte jene ‚Symbolnetze’,
die sich zu diskursiver Verknüpfung eignen. Das war mit dem Schlagwort
der ‚Verwissenschaftlichung’ gemeint, das den pädagogsichen Diskurs seit
den sechziger Jahren prägte.
Verwissenschaftlichung
bezieht sich per Definition auf den Bereich des sogenannten
‚Herrschaftswissens’. Anderes fällt nicht in ihren Bereich. Daß seither
‚Lernen’ zum Schlüsselbegriff staatlicher Pädagogik wurde und ‚Bildung’
wie ein Zopf abgeschnitten wurde, ist nur folgerichtig.
Quod erat demonstrandum: Das gegenwärtige Schulsystem ist entstanden
und behauptet sich als ein Produkt und eine Bedindung der industriellen Arbeitsteilung. Aber die Arbeitsgesellschaft und ihre Industrie sind am Vergehen.
1) J. G. Herder, Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, Darmstadt 1966, S. 227
2) „Fordert den Führerschein für Eltern: Prof. Klaus Hurrelmann“ in: Hör zu,
Heft 25/2001 (15. 06. 01); siehe dazu: J. Ebmeier, Eltern und Erzieher,
oder Die pädagogische Mystifikation in: PÄD Forum 5/2001, S. 322
3) Platon, Politeia, VII. Buch, Kap. 4-18
4) siehe hierzu Ivan D. Rozanskij, Geschichte der antiken Wissenschaft, Mchn. 1984; insbes. S. 7-20
5) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“ in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 216
6)
dt.: Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie, Hamburg 1988
(PhB) Siehe hierzu: Alexandre Koyré, Von der geschlossenen Welt zum
unendlichen Universum, Ffm. 1980; ders., Du monde de l’à-peu-près à l’univers de la précision in: Études d’histoire de la pensée philosophique,
Paris 1971, S. 341-362; auch: Wilhelm Dilthey, „Die Autonomie des
Denkens, der konstruktive Rationalismus und der pantheistische Monismus
nach ihrem Zusammenhang im 17. Jhdt.“ in: Philosophische Aufsätze, Bln.
(O) 1986, S. 327-389
7)
Zu diesem Zweck führt Galileo das Experiment in die Physik ein: nicht
um Gesetze zu entdecken, sondern um eine erdachte Theorie den
Widersachern zu beweisen.
8]
„Das zunehmende Eingreifen gesatzter Ordnungen“ sei „ein besonders
charakteristischer Bestandteil jenes Rationalisierungs- und
Vergesellschaftungsprozesses“, der die „wesentliche Triebkraft“ der
bürgerlichen Entwicklung ausmacht: Max Weber, Wirtschaft und
Gesellschaft, Tbg. 51972, S. 196.
9)
Es ist ein Wechselverhältnis. Dem einen ‚letzten’ Grund entspricht der
allgemeinste Gegenstand, und umgekehrt: je enger der Gegenstand, umso
breiter die Voraussetzungen.
10) René Descartes, Discours de la méthode
(1637) Hbg. 1960 [frz./dt.], S. 66; ein weiterer Stichtag der
abendl„ndischen Vernunft. – Die Begründung für die meta-physischen
Stellung der Mathematik liefert D. 1642 in den Meditationes de prima philosophia nach: [lat./dt.] Hamburg 1959 (PhB)
11)
Der Begriff stammt – als Gegensatz zu den „okularen“ Griechen und
Indern – von Paul Gf. Yorck v. Wartenberg in: ders., Bewußtseinsstellung
und Geschichte, Tbgn. 1956, S. 177
12) In Descartes’ Raum-Welt kommt keine andere Kraft als ‚Druck und Stoß’ vor. Als Newton die Gravitation
einführte, mußte daher der mysteriöse Stoff ‚Äther’ erdacht werden,
durch den diese neue Kraft ‚übertragen’ werden konnte.
13) In der Industrie wird die verräumlichte Zeit selber zur ersten Realität: Zeit ist Geld.
14)
Am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft stand die Erste mediale
Revolution; siehe Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit,
Ffm. 1991, sowie Elisabeth Eisenstein, Die Druckerpresse.
Kulturrevolution im frühen modernen Europa; Wien-New York 1997.
15) Um die Beweiskraft der Argumente ging es schon bei Plato/Sokrates (Theaitetos pass.) Aber
ihre Erkenntnis steht in Dienst des ‚Eros’: der Suche nach der guten
und schönen Lebensführung; und die ist privat, nicht öffentlich.
16) z. B. Plato, Timaios 55e-56c
17)
Das Modewort ‚Konstruktivismus’ entstammt der Einsicht moderner
Mathematiker, daß die Wahrheit der Mathematik in der anschaulichen
Konstruierbarkeit ihrer Figuren besteht; klassisch formuliert von der
sog. Erlanger Schule um Paul Lorenzen (seit den 1950er Jahren).
18] Isaac Newton, Mathematische Grundlagen…, S. 9. – Newton knüpft an Descartes an.
19)
Isaac Newton in Optik, Buch 3, Teil 1, Frage 31; hier zit. nach: J.
Robert Oppenheimer, Wissenschaft und allgemeines Denken, Hbg. 1955
(rde), S. 95f.
20)
Thomas Hobbes zog diese Konsequenz, verzichtete in seinem
philosophischen System auf eine Metaphysik i. e. S., und gilt daher zu
recht als Begründer des modernen metaphysischen Materialismus; und der modernen Wissenschaftsgläubigkeit.
21) 1755 erschien im 5. Band der Encyclopédie
der Artikel „Politische Ökonomie“, verfaßt von J. J. Rousseau. Er
stellt den Wirtschaftsprozeß in Analogie zum menschlichen Stoffwechsel
dar.
22) Quesnays’ Tableau économique erschien ab 1758 in mehreren Bearbeitungen; dt. in: ders., Ökonomische Schriften, Bln. (O) 1971
23)
Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen (1776), Mchn. 1978 (dtv); David
Ricardo, Über die Grundsätze der Politischen Ökonomie und der
Besteuerung (1817), Bln. (O) 1959
24) gr. oíkos: der Haushalt; pólis:
das Gemeinwesen. Der Ausdruck Politische Ökonomie bedeutet
ursprünglich: Lehre vom Staatshaushalt. Die Schrift, in deren Titel er
erstmals auftaucht, enthält daher nur Ratschläge an Ludwig XIII., wie er
seine Staatskasse füllen kann: Antoine de Montchrétien, Traité d’économie politique (Rouen 1615)
25) Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I; in: MEW Bd. 23, S. 741
26)
Da findet ein ungleicher Tausch statt. Der Käufer bezahlt die Arbeit,
wie jede andere Ware, nach ihren (Re-)Produktionskosten: d. h. das, was
der Arbeiter zum Leben braucht. Was die Arbeit darüber hinaus
produziert, gehört dem Käufer auch. Er bezahlt den Tauschwert der Arbeit
und erhält ihren Gebrauchswert, der darin besteht, daß sie mehr
produzieren kann, als sie selber gekostet hat.
27) ebd, S. 744
28] Wilhelm Dilthey und die ‚hermeneutische Schule’
29) von gr. nómos, Gesetz, und thésis, Setzung; und ídios, einzeln, und graphé
Zeichnung; so Wilhelm Windelband in „Geschichte und Naturwissenschaft“,
in: Präludien, Tbg. 1907, S. 355-379, und in seinem Gefolge die
Südwestdeutsche Schule der Neukantianer
30) Max Scheler, „Erkenntnis und Arbeit“, in: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 31980, S. 210
31)
ebd, S. 205. (Rudi Dutschke hat ‚Herrschaftswissen’ im verballhornten
Sinn von Geheimwissen der Herrschenden in die studentische
Umgangssprache eingeführt.)
32)
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 800. In: ders., Werke (Hg.
Weischedel) Bd. IV, Ffm. 1974, S. 673 – `Praktische Philosophie’
bedeutet soviel wie Ethik.
33)
siehe Anm. 26. Sie ‚funktioniert’ freilich nur, wenn die Wirtschaft
ohnehin floriert. In der Krise, wenn man sie wirklich braucht, versagt
sie regelm„áig.
34) Die seit PISA so beliebten „Standards“ sind ein verschämter Ersatz.
35)
Im napoleonischen Frankreich wie im romantischen Deutschland: Unser
humanistisches Bildungsideal verdanken wir in erster Linie dem
bürokratischen preußischen Militärstaat. Der hatte kein
Bildungsbürgertum und keinen kultivierten Adel. Seine Intelligentsia war
seine Beamtenschaft.
36) siehe hierzu J. Ebmeier, Homo ludens victor in: PÄD Forum 2/2003, [S. 114]
37) Das Wort kommt im 17. Jhdt. auf, ‚Pädagogik’ hundert Jahre später. Der griechische paidagogós
war eine verächtliche Figur, ein alter Sklave, der zu sonst nichts mehr
taugte und die Knaben als Sittenwächter in der Öffentlichkeit zu
begleiten hatte. Bevor er namens der Pädagogik zu späten Ehren kam, war
er im 16. Jhdt. in der Korruptionsform il pedante landläufig geworden.
38] Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Hamburg (rde) 21958, S. 65
39) Ernst Cassirer, „Ein Schlüssel zum Wesen des Menschen: das Symbol“ in: Versuch über den Menschen, Hbg. 1990 (PhB), S. 47ff
40) Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek 1961 (rde), S. 57
41) vgl. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928, S. 63ff.
42) Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe Bd. 1, Ffm. 1984, S. 67 [5.6]
43) „Was ich nur meine, ist mein,
gehört mir als diesem besonderen Individuum an; wenn aber die Sprache
nur Allgemeines ausdrückt, so kann ich nicht sagen, was ich nur meine. Und das Unsagbare,
Gefühl, Empfindung, ist nicht das Vortrefflichste, Wahrste, sondern das
Unbedeutendste, Unwahrste.“ G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der
philosophischen Wissenschaften, in: ders., Werke, Bd. 8, Ffm. 1970, S.
74
44) …die darin ihre Berechtigung findet.
45) Wittgenstein wußte das: „Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.“ aaO, S. 83 [6.43] (Es ist sicher nicht die Sprache, nach der sich beide von einander unterscheiden.)
46) Hermann Giesecke, Pädagogik als Beruf, Weinheim 1987, S. 23
47)
Plato bezeichnet im Symposion als Eros das gemeinsame Streben des
Knaben und des Mannes nach der Anschauung des Wahren und Schönen.
48) J. Ebmeier, Kleine Erziehlehre, in: Unsere Jugend 6/1990, S. 229f.
_____________________________________________________________________________________________
III. „Erziehungswissenschaft“
oder:
Die Standesideologie der pädagogischen Zunft

Gibt es von „Erziehung“ einen Begriff? Kann es eine Erziehungswissenschaft geben?
Der Begriff wäre die Antwort auf die Frage: Wer tut da was mit wem? Das ist das Idion. Wer mit wem, das wäre der Umfang; was, das wäre der Inhalt. Das Wie wäre gegebenenfalls Gegenstand des historischen Berichts, und wenn überhaupt, dann ließen sich aus ihm verallgemeinernde Sätze ableiten, die zwar ‚Gesetzlichkeit’ nicht für sich in Anspruch nehmen, aber doch einen pragmatischen Hinweis geben könnten, was man versuchen kann und was man besser unterlässt. Doch dies ist klar: Ohne Wer-was-mit-wem kann nach Wie gar nicht erst gefragt werden. Nicht nur auch, sondern gerade als historisches Fach ist „Erziehungswissenschaft“ auf einen klaren und bestimmten Begriff angewiesen.
Ich mache es kurz: Die pp. Erziehungswissenschaft, d. h. ihre Königsdisziplin, die Allgemeine Pädagogik, kann einen solchen Begriff nicht geben.
„Erziehen = Von einem Menschen s1 auf einen Menschen s2 gerichtetes absichtsvolles und geplantes Zuführen von Impulsen mit dem Ziel, dass s2 diese Impulse als Reize oder Informationen so verarbeitet, dass s2 Verhaltensbereitschaften bewahrt oder erwirbt oder so verändert, das s2 (in einer festgelegten Zeit) Verhalten realisiert, das den Soll-Zuständen von s1 entspricht.“ Diese denkwürdige Definition, die uns Lutz Michael Alisch und Lutz Roessner in „Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis“* gegeben haben, trifft auf den Bananenverkäufer auf dem Wochenmarkt und auf den Schaffner in der Straßenbahn ebenso zu. Ist sie bloß ein Kuriosum? Nein, sie spricht die Hilflosigkeit der ganzen Branche aus.

Irgendwie hat es mit Erwachsenen und mit Kindern zu tun (und kommen Sie mir jetzt nicht mit ‚Erwachsenenpädagogik’, Sie bringen ja alles nur noch mehr durcheinander!). Ach, und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, da stellen wir sogleich fest, dass es den ‚Begriff’, genauer: das Wort ‚Erwachsener’ grad mal seit zweihundert Jahren gibt – man merkt es schon an der verlegenen grammatikalischen Form: ein substantiviertes Partizip Perfekt. Vorher gab es Männer und Frauen (und Mütter und Väter); aber ein soziales Corps, das einem andern sozialen Corps namens Kinder als dessen Oppositum auflauerte, das gab es nicht. Denn ein kint war noch im Mittelhochdeutschen zunächst ein Sohn oder eine Tochter, später konnte jeder Jüngere jedem Älteren gegenüber ein kint heißen. Nur einen bestimmten biologischen Entwicklungsstand – das bedeutet ‚Kind’ erst in der bürgerlichen Gesellschaft.
Tatsächlich entsteht der Sozialstatus ‚Kind’ erst in eben dem Maße, wie die Angehörigen der sich ausbildenden bürgerlichen Gesellschaft zu ‚autonomen Subjekten’ (in der Philosophie), zu ‚Warenproduzenten’ (in der Nationalökonomie) und zu ‚Berufsmenschen’ (in der Soziologie) erwachsen. Seither erst kommen auch die Vokabeln ‚Erziehung’ und ‚Pädagogik’ in Gebrauch. Die Marktwirtschaft sorgt für einen so hohen Grad gesellschaftlicher Arbeitsteilung, dass an ein stilles, stetiges Hineinwachsen wie in den Handwerksstuben und den Bauernhöfen des Ancien Régime nicht mehr zu denken war. Seither bedarf es einer besonderen Schutz-, Dressur- und Zubereitungsphase, um zu einem vollgültigen Glied der Berufswelt gemacht zu werden. Von Pädagogen, von wem denn sonst?
Darum ist Pädagogik ein „Fach“, und darum braucht es eine „Erziehungswissenschaft“. Seine Extensio – das sind die Versorgungsansprüche der Pädagogen. Ihre Intensio sind die Wörter, die sie gebrauchen, um diesen Umstand zu verschleiern. Vorangegangen ist auf diesem Wege Friedrich Daniel Schleiermacher, den sie darum mit Grund als ihren Stiftungsvater erkennt.
Historisch war es zwar Johann Friedrich Herbart, der sie eine halbe Generation zuvor mit seiner Allgemeinen Pädagogik als akademisches Fach begründet hat. Aber er war ein erklärter Gegner der Schule. Und zwar nicht zuletzt aus diesem Grunde: weil sie auf die Dauer einen Berufsstand züchtet, dessen Eigeninteresse sich an die Stelle der pädagogischen Zwecke zu drängen neigt – zumal, wenn es „in öffentlichem Dienst“ auftreten darf. Kein Wunder, dass man ihm einen Schleiermacher vorzieht.
Der allererste Schritt beim Verschleiern ist, den pädagogischen Berufsstand aus dem Blickfeld verschwinden
 und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“
und
in einem ‚Großen Ganzen’ untergehen zu machen. Der Schleiermacher
blieb bis heute darin vorbildlich: „Ein großer Teil der Tätigkeit der
älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso
unvollkommener, je weniger gewusst wird, was man tut und warum man es
tut. Es muss also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der
älteren Generation zur jüngeren ausgehend die Frage stellt: Was will
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“Da „die jüngere Generation“ hier nur als Objekt in Frage kommt, die nichts zu „wollen“ hat, mag ihm dieser Ausdruck hier durchgehen. Wenn aber die „ältere Generation“ etwas will, dann… muss sie ein Subjekt sein. Das ist sie offenkundig nicht, wie sollte sie? Der Ausdruck ist eine bloße Mystifikation, unter der sich ein materielles Interesse tarnt. Die Pädagogenschaft „will“ stellvertretend für alle andern. Man hätte wohl meinen können, mit der ‚älteren Generation’ seien hier die Eltern von Kindern gemeint. Aber deren „erziehende Tätigkeit verteilt sich ihnen unter ihr ganzes übriges Leben und tritt nicht gesondert hervor.“ Davon gibt es daher keine Wissenschaft. „Man bezieht also die Erziehungslehre auf diejenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen“ – verschämt ausgedrückt; man bezieht es also auf die Erwerbspädagogen.
Wie kommen die aber zu ihrer Stellvertreterrolle, was rechtfertigt sie? Plötzlicher Anflug christlicher Demut: „Ich sehe keinen andern Rat, als an dieser Stelle unserer Untersuchung abzubrechen und zu sagen, wir müssen an die jetzt bestehende Form der Erziehung unsere Theorie anschließen.“ Und das ist die Quintessenz des Ganzen! Zum Trost breitet er uns einen Weihrauchschleier drüber: Es nennt ‚das Ganze’ „Praxis“, und damit ist es glücklich aller Kritik entzogen; der wissenschaftlichen zumal.
Wissenschaft ist öffentliches Wissen. Sie ist entstanden, um in der Öffentlichkeit ein Feld abzustecken, innerhalb dessen Meinungsverschiedenheiten, die immer auch von Interessen geprägt sind, vernünftiger Weise nicht mehr möglich sind. Dies ist ihr historischer Sinn.
Das Aufkommen der Wissenschaften im Abendland des siebzehnten, achtzehnten Jahrhunderts war das politische Weltergeignis schlechthin. Herrschaft konnte von nun an gemessen werden an dem, was ‘als vernünftig erkannt’ war. Und nur so ist eine repräsentative, nämlich die Staatsbürger repräsentierende politische Ordnung überhaupt denkbar.
Die Öffentlichkeit erwartet allerdings von der Wissenschaft, dass sie Gesetzestafeln erstellt, in die man die ‘konkreten Fälle’ nur noch einzutragen braucht, um die ‘richtige Lösung’ sogleich ablesen zu können. Es liegt daher im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Wissenschaft selbst, ihre Grenzen möglichst scharf zu ziehen.

Nirgends ist das dringlicher als bei der Erziehung der heranwachsenden Generationen. Schon wegen unserer Zukunft, nicht wahr? Aber auch, weil der Steuerzahler sein Geld nicht gern vergeudet.. Doch die Öffentlichkeit glaubt nur zu gern, dass die Erziehungswissenschaft ihr Gesetzestafeln zeigt, aus denen abzulesen ist, „was zu tun sei“. Doch eben das kann sie nicht bieten. Sie ist keine ‚nomothetische’ Disziplin, die Naturgesetze freilegt, die auf die „Praxis“ nur noch anzuwenden wären. Die ein jeder, unabhängig von Stand und Geburt, aber unabhängig auch von persönlichem Vermögen, nur zu lernen bräuchte, um sie zu beherrschen. Gesetze, die eine berufliche Zunft als Ganze rechtfertigen könnten und den Einzelnen seiner Verantwortung enthöbe…
Und so hätte es gern auch die Erwebserzieherschaft. Ihre Vorlieben sind Techniken, Methoden und Strukturen, über nichts reden sie lieber. Dass zum Pädagogen nur taugt, wer dazu taugt, kommt unter den Teppich. Störend ist das Wuchern der sogenannten Erziehungswissenschaften nicht an sich selbst – das wäre nur ein akademisches (und vielleicht fiskalisches) Problem. Störend, nein: katastrophal ist, dass die Fiktion einer Wissenschaft, die „die Praxis begründet“, den Beruf des Erziehers radikal entwertet, indem sie seine personale Verantwortung an ein Drittes delegiert – eine anonyme Instanz, einen Wörterberg, den man dreht und wendet wie man will, weil er sich nicht wehren kann. Doch was er zu tun und zu lassen hat, muss der Erzieher selber wissen
Nicht „zu viel Wissenschaft“ gibt es bei uns im Erziehungsgetriebe. Davon kann es gar nicht zu viel geben, wenn man es so versteht, wie es in einem idiographischen Fach nur zu verstehen ist: als Kritik. Sondern es gibt zu viel Pseudowissenschaft, und umso mehr Kritik ist nötig: an dem „dialektischen Schein“, dass aus dem bloßen Kombinieren von Begriffen sachliche Erkenntnis möglich würde. Newtons nil in verbis! gehört über unsere Schulportale geschrieben.

Die empirische Sozialforschung kann – in Längs- und in Querschnitten – herausfinden, welche Institutionen in der Geschichte ursächlich irgendwie mit der Verbreitung einzelner kultureller Kompetenzen in einem Gemeinwesen zusammenhängen. Aber die Summe dieser Kompetenzen insgesamt begrifflich unter „Erziehung“ zu fassen, ist genau so ein definitorischer Gewaltakt wie „Intelligenz ist das, was der IQ-Test misst“. Darauf können sich Forscher in heuristischer Absicht einstweilen verständigen. Aber ansonsten ist es rein nominal und Schall und Rauch.
Eine solche historisch vergleichende Wissenschaft „vom Erziehen“ könnte, wenn sie eben mehr sein wollte als ein Zweig der Humanethologie, nur die Meinungen sammeln, die andere Leute über ein X geäußert haben, das sie „Erziehung“ nannten – und sie logisch-kritisch aufbereiten. Darüber hinaus kann sie in literarischer Sprache erzählen, was dieselben Leute – soweit man es sehen kann – dabei getan haben. In einer irgend exakten Weise beobachten kann sie es aber nicht, denn eben dazu bräuchte sie Begriffe, die sie nicht hat noch haben kann. Und in ganz besonders farbigen Worten kann sie uns ausmalen, was dabei „herausgekommen“ zu sein scheint – im Guten wie im Bösen. Das ist wörtlich gemeint: Es ist am Ende eine Frage von gut und böse. Das taugt nicht für Wissenschaft, sondern für den Roman.
In nüchterne Worte gebracht, zerfiele diese Forschungsrichtung in 1) Doxologie, und 2) historische Institutionssoziologie. Aber wie die beiden zusammenhängen – folgt die Meinung aus den Institutionen oder folgen die Institutionen aus den Meinungen; oder was heißt hier „Wechselwirkung“? – das bleibt immer Sache eines hermeneutischen Kunststücks. Und so allein gehört Wissenschaft in die pädagogischen Ausbildungspläne – historisch und kritisch.
Denn was er tun soll, muss ein Erzieher eben selber wissen. Er ist ein darstellender Künstler, der es immer drauf ankommen lassen muss.

*) München 1981, S. 38

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen