Sport und Spiel und Kampf und Kunst

Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?
In den letzten Jahren hört man immer wieder, daß Funktionäre den Sport nach außen hin mit sozialpädagogischen Argumenten recht- fertigen, und fast glaubt man, er hätte
das nötig. Da heißt es ‘Aggressionen abbauen’, ‘der Gewalt bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für
die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,
bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-
liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport
bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß
ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit
besser vermitteln…
bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für
die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,
bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-
liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport
bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß
ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit
besser vermitteln…
Nachdem ich ein Vierteljahrhundert sozialpädagogische Berufspraxis auf dem Buckel habe, darf ich dazu wohl das Wort ergreifen. Dahingestellt sein laß ich, ob man wirklich immer nach den Fleischtöpfen schielen und die Frage nach richtig oder falsch gar nicht mehr stellen muß. Ich rede hier nicht moralisch, sondern pragmatisch. Und da sage ich: Wenn der Sport sich mit der Sozialpädagogik auf einen Wettlauf um die Fördermittel einläßt, hat er von vornherein verloren. Dann trägt er selber dazu bei, einen schlechten Zustand zu zementieren, den zu beenden gerade er aufgerufen ist.
Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Sport (unnützer) Zeitvertreib und Sozialpädagogik (nützliche) Arbeit ist. Bis in die sechziger Jahre hat ja gerade der Sport als „Jugendarbeit“ par excellence gegolten! Wenn
 damals ein Politiker sagte, er wolle
„was für die Jugend tun“, dann meinte er immer – neue Sportstätten.
Recht so: Die Jugend strebt zum Sport, der Sport strebt zur Jugend,
anders kann es
gar nicht sein. Freilich, das Berufsbild des Sozialpädagogen gab es da
noch nicht. Das kam erst Ende der Sechziger auf, mit jener
explosionsartigen Vermehrung der pädagogischen Berufe, die man füglich
als Landnahme bezeichnet. Seither war „Professionalisierung“ das gängige
Stichwort, in den freien Jugendverbänden wurden „Fachkräfte“
angestellt, die rissen alles an sich, die freiwilligen „unfachlichen“
Helfer wurden rausgeekelt, und schließlich blieben auch die einfachen
Mitglieder weg. „Jugendarbeit“ gibts seither nicht mehr. Auch keine
Jugendbewegung. Nur noch Sozialpädagogen.
damals ein Politiker sagte, er wolle
„was für die Jugend tun“, dann meinte er immer – neue Sportstätten.
Recht so: Die Jugend strebt zum Sport, der Sport strebt zur Jugend,
anders kann es
gar nicht sein. Freilich, das Berufsbild des Sozialpädagogen gab es da
noch nicht. Das kam erst Ende der Sechziger auf, mit jener
explosionsartigen Vermehrung der pädagogischen Berufe, die man füglich
als Landnahme bezeichnet. Seither war „Professionalisierung“ das gängige
Stichwort, in den freien Jugendverbänden wurden „Fachkräfte“
angestellt, die rissen alles an sich, die freiwilligen „unfachlichen“
Helfer wurden rausgeekelt, und schließlich blieben auch die einfachen
Mitglieder weg. „Jugendarbeit“ gibts seither nicht mehr. Auch keine
Jugendbewegung. Nur noch Sozialpädagogen.
Übriggeblieben ist eigentlich nur die Sportjugend, d. h. der Jugendsport. Der hat der Sozialpädagogisierung getrotzt. Und die Sozialpädagogen ignorieren ihn vornehm – als unlautere, weil „unprofessionelle“, nämlich billigere Konkurrenz.
An „fachlichen“ Versuchungen hat es bei den Jugendfunktionären sicher auch nicht gefehlt. Es liegt aber in der Natur des Sports, daß ihm die Sozialpädagogik widerstrebt. Denn sie folgen beide zwei diametral entgegengesetzten Logiken, und die machen sich bis in den intimsten Winkel geltend: Die Sozialpädagogik richtet ihr Augenmerk auf die Schwächen der Kinder, der Sport auf ihre Stärken.
Für die Sozialpädagogik heißt es: „Defizite kompensieren“.
“Aggressionen“ modisch: „Gewaltbereitschaft“ wären so ein „Defizit“. Früher sprach man von Flegeljahren und von überschüssigen Kräften, aber die Sozialpädagogik denkt gleich an eine ‚Störung’, die man wegmachen muß. Im Hinterkopf schwebt irgendein idealer Durchschnitt von „Normalität“, von dem natürlich keiner genau sagen kann, wo er liegen soll.
Im Sport heißt es dagegen: „Der Beste möge siegen“. Durchschnitt, Norm und Normalität kommen im Sport nicht vor.
Ganz krass wird es bei den Paralympics: Selbst da geht es nicht darum, „Defizite“ zu „kompensieren“, sondern auch da gilt: „Der Beste wird gewinnen.“ Es ist nicht Sache des Sports, irgendwem einen Maßstab vorzuhalten und zu sagen: „Siehst du, da mußt du hin!“ Das Ethos des Sports ist, ganz im Gegenteil, daß jeder aus sich das Beste macht. Jeder schafft, was er kann. Das Maß eines jeden sind seine eignen Möglichkeiten, und was er daraus macht, liegt ganz bei ihm. Man könnte vielmehr fragen, mit welchem Fug und Recht eigentlich die Sozialpädagogen den Leuten Maßstäbe setzen wollen; bestimmen wollen, was Norm und was Abweichung, was Defizit und was Störung, was Kompensation und Normalität sind; wer hat sie dazu eingeladen? Da kämen sie aber ganz schön in Verlegenheit.

Gewiß, sie haben es schwer. Ein liberaler Staat in einer pluralistischen Gesellschaft kennt kein positives, verbindliches „Menschenbild“ mehr. Das brauchen sie aber: Wonach sollen sie sich sonst richten? Ersatzweise griffen sie daher zu einem negativen Menschenbild: Je lauter man von den „Defiziten“ der andern redet, umso weniger muß man über die eignen Maßstäbe sagen. Das hat den weiteren Vorteil, daß so die Defizite natürlich nie behoben, die Aufgaben nie erledigt und die Planstellen nie überflüssig werden. Es bleibt alles im Ungefähr, und man kann beliebig viel neue Defizite entdecken – wenn man nur lange genug hinschaut.
So kommt es, daß in diesem Berufsstand heute immer mehr Professionelle immer weniger leisten. Die Sozialpädagogik bestreitet ihre Leistungsschwäche gar nicht. Aber sie will uns einreden, es handle sich nur um ein fachliches Problem, das sie schon selbst und mit ihren Mittel lösen wird. Das ist eine Augenwischerei, der wir – wie alle Steuerzahler – energisch widersprechen sollten. Daß ein Erziehungssystem, das an den Kindern mit Vorliebe deren Fehler und Schwächen wahrnimmt, nichts Manierliches zustandebringt, kann jeder erkennen. Dazu braucht man kein Fachwissen. Man muß nur alle fünf Sinne beisammen haben. Es ist eine Sache des gewöhnlichen menschlichen Anstands: Kinder muß man auf ihre Stärken hinweisen.

Aus einem Briefwechsel
An H. v. H.
30. 1. 1997
… Nun zum Sport. Das ist auch für mich ein neues Thema. Vor einem Jahr bin ich zufällig zu Siegfried Nordwest geraten und habe seither eigentlich nur zugesehen. Gewiß hab ich mir auch immer so meine Gedanken gemacht… Erst aus gegebenem Anlaß beginne ich jetzt zu ordnen, und es muß nicht alles gleich beim erstenmal stimmen.
Ob z.B. Sport immer Wettkampf ist? Es gibt ganz einsame Sportarten, z. B. beim Alpinismus. Aber auch da ist wohl ‚der Andere’, dessen Marke man einholt und überholt, in Gedanken immer mit dabei. Doch das haben Sie mit Ihrem „kleinen täglichen Sport“ wohl nicht gemeint. Was alles will man unter Sport verstehen? Das ist keine semantische Frage. Sport als Wettkampf gibt es seit vielen tausend Jahren; eine Art Kulturkonstante, wenn man Johan Huizinga folgen will.
Körperliche Ertüchtigung „ganz und gar für mich“, alias fitness, gibt es aber, wenn ich nicht irre, eigentlich erst in der Industriegesellschaft; genau gesprochen, nach der Industriegesellschaft. Soll man das alles unter denselben Begriff fassen? Aber Sie haben recht, ich meine mit Sport eine öffentliche Angelegenheit, und an der Stelle, die Sie beanstanden, wollte ich darauf aufmerksam machen, daß der Sammelname Sport nur in der Schule etwas Bestimmtes bedeutet, nämlich ein „Fach“: weil es dafür einen Lehrer gibt und eine Zensur. Nur so ist er auch Pensum. Aber im gesellschaftlichen Leben gibt es immer nur diese oder jene sportliche Disziplin; und deren Träger ist immer dieser oder jener Verein – kein öffentliches Institut.

Daß dem im Poelchau-Modell Rechnung getragen wird – und sei es aus Geldmangel -, schien mir der springende Punkt zu sein. Ich denke, ich werde wohl etwas länger beim Jugendsport bleiben, als ich anfangs vorhatte. Ich war ein Vierteljahrhundert lang Sozialpädagoge und habe mich nie darum geschert. Nun merke ich, daß ich was versäumt habe. Da liegt jede Menge Energie verborgen, mit der man der ganzen Pädagogik Feuer unterm … machen kann, und das gefällt mir. Eine erste Probe habe ich Ihnen beigelegt. Ihnen als Altphilologen empfehle ich außerdem: Michael Poliakoff, „Kampfsport im Altertum“, vor ein paar Jahren bei Artemis-Winkler erschienen. Der Mann ist Althistoriker und war in seiner Jugend selber Ringer. [...]
1.3.1997
Das ist eben der sogenannte „Ausgleichssport“, wie er für die Industrie-, d. h. in Wahrheit: die Angestelltengesellschaft charakteristisch ist. Die Schule konnte sich eben nur nicht verkneifen (unbedingter Reflex), der Sache eine Zensur und einen Plan aufzusetzen. Das macht’s nicht rühmlicher.
Mich interessiert am Sport (d. h. am Ringen) nicht speziell die Dimension „Körperkultur“ bzw. Leibesübung. Die ist unstrittig. Und natürlich ist es besser, wenn aus „kompensatorischen“ Erwägungen der Sportunterricht ausgedehnt, als wenn aus fiskalischen
Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher
Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in
(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.
Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die
waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim
Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die
Gründe, warum ich dabei geblieben bin.
fiskalischen
Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher
Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in
(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.
Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die
waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim
Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die
Gründe, warum ich dabei geblieben bin.

* Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?
* Aus einem Briefwechsel
* Worauf’s beim Ringen ankommt
* Ringen als Schulfach
* betr.: Ringen an der Poelchau-Schule
* Bericht an die Mitgliederversammlung
* Von der Überlegung
__________________________________________________________________________
Soll sich der Sport als Sozialpädagogik verkaufen?
Zum Jahr des Kinder- und Jugendsports
(für die Sportjugend Berlin, im Januar 1997)
(für die Sportjugend Berlin, im Januar 1997)
 bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für
die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,
bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-
liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport
bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß
ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit
besser vermitteln…
bereitschaft begegnen’, ‘die Kinder von der Straße holen’ als sei sie bloß für
die Autos da, ‘Frustrationstoleranz ein- üben’ usw. Fragt man nach,
bekommt man als Antwort: Anders kommen wir nicht mehr an öffent-
liches Geld ran. Überall wird gespart, und wenn der Sport
bloß als Freizeitvergnügen erscheint, wird er nicht gefördert. Man muß
ihn als eine Art Nothilfe darstellen, das läßt sich der Öffentlichkeit
besser vermitteln…Nachdem ich ein Vierteljahrhundert sozialpädagogische Berufspraxis auf dem Buckel habe, darf ich dazu wohl das Wort ergreifen. Dahingestellt sein laß ich, ob man wirklich immer nach den Fleischtöpfen schielen und die Frage nach richtig oder falsch gar nicht mehr stellen muß. Ich rede hier nicht moralisch, sondern pragmatisch. Und da sage ich: Wenn der Sport sich mit der Sozialpädagogik auf einen Wettlauf um die Fördermittel einläßt, hat er von vornherein verloren. Dann trägt er selber dazu bei, einen schlechten Zustand zu zementieren, den zu beenden gerade er aufgerufen ist.
Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Sport (unnützer) Zeitvertreib und Sozialpädagogik (nützliche) Arbeit ist. Bis in die sechziger Jahre hat ja gerade der Sport als „Jugendarbeit“ par excellence gegolten! Wenn

Übriggeblieben ist eigentlich nur die Sportjugend, d. h. der Jugendsport. Der hat der Sozialpädagogisierung getrotzt. Und die Sozialpädagogen ignorieren ihn vornehm – als unlautere, weil „unprofessionelle“, nämlich billigere Konkurrenz.
An „fachlichen“ Versuchungen hat es bei den Jugendfunktionären sicher auch nicht gefehlt. Es liegt aber in der Natur des Sports, daß ihm die Sozialpädagogik widerstrebt. Denn sie folgen beide zwei diametral entgegengesetzten Logiken, und die machen sich bis in den intimsten Winkel geltend: Die Sozialpädagogik richtet ihr Augenmerk auf die Schwächen der Kinder, der Sport auf ihre Stärken.
Für die Sozialpädagogik heißt es: „Defizite kompensieren“.
“Aggressionen“ modisch: „Gewaltbereitschaft“ wären so ein „Defizit“. Früher sprach man von Flegeljahren und von überschüssigen Kräften, aber die Sozialpädagogik denkt gleich an eine ‚Störung’, die man wegmachen muß. Im Hinterkopf schwebt irgendein idealer Durchschnitt von „Normalität“, von dem natürlich keiner genau sagen kann, wo er liegen soll.
Im Sport heißt es dagegen: „Der Beste möge siegen“. Durchschnitt, Norm und Normalität kommen im Sport nicht vor.
Ganz krass wird es bei den Paralympics: Selbst da geht es nicht darum, „Defizite“ zu „kompensieren“, sondern auch da gilt: „Der Beste wird gewinnen.“ Es ist nicht Sache des Sports, irgendwem einen Maßstab vorzuhalten und zu sagen: „Siehst du, da mußt du hin!“ Das Ethos des Sports ist, ganz im Gegenteil, daß jeder aus sich das Beste macht. Jeder schafft, was er kann. Das Maß eines jeden sind seine eignen Möglichkeiten, und was er daraus macht, liegt ganz bei ihm. Man könnte vielmehr fragen, mit welchem Fug und Recht eigentlich die Sozialpädagogen den Leuten Maßstäbe setzen wollen; bestimmen wollen, was Norm und was Abweichung, was Defizit und was Störung, was Kompensation und Normalität sind; wer hat sie dazu eingeladen? Da kämen sie aber ganz schön in Verlegenheit.

Gewiß, sie haben es schwer. Ein liberaler Staat in einer pluralistischen Gesellschaft kennt kein positives, verbindliches „Menschenbild“ mehr. Das brauchen sie aber: Wonach sollen sie sich sonst richten? Ersatzweise griffen sie daher zu einem negativen Menschenbild: Je lauter man von den „Defiziten“ der andern redet, umso weniger muß man über die eignen Maßstäbe sagen. Das hat den weiteren Vorteil, daß so die Defizite natürlich nie behoben, die Aufgaben nie erledigt und die Planstellen nie überflüssig werden. Es bleibt alles im Ungefähr, und man kann beliebig viel neue Defizite entdecken – wenn man nur lange genug hinschaut.
So kommt es, daß in diesem Berufsstand heute immer mehr Professionelle immer weniger leisten. Die Sozialpädagogik bestreitet ihre Leistungsschwäche gar nicht. Aber sie will uns einreden, es handle sich nur um ein fachliches Problem, das sie schon selbst und mit ihren Mittel lösen wird. Das ist eine Augenwischerei, der wir – wie alle Steuerzahler – energisch widersprechen sollten. Daß ein Erziehungssystem, das an den Kindern mit Vorliebe deren Fehler und Schwächen wahrnimmt, nichts Manierliches zustandebringt, kann jeder erkennen. Dazu braucht man kein Fachwissen. Man muß nur alle fünf Sinne beisammen haben. Es ist eine Sache des gewöhnlichen menschlichen Anstands: Kinder muß man auf ihre Stärken hinweisen.
Das lehrt uns der Sport. Wenn also von einer Verbindung von Sport und
Sozialpädagogik die Rede ist, dann kann es immer nur so sein, daß das
Ethos des Sports die Fachlogik der Sozialpädagogen korrigiert, und nicht
umgekehrt. So gesehen, wirkt Sport dann allerdings „sozialpädagogisch“.
Aber die Sozialpädagogen werden es
kaum wahrhaben wollen. Und schließlich muß der Sport sein Ethos
offensiv vertreten, statt sich hinter anderen zu verstecken, als ob er
sich schämt. Das kommt in der Öffentlichkeit nicht an? Na das wolln wir
erstmal sehen. Und schließlich: Öffentlich heißt nicht behördlich. Es
gibt in der Öffentlichkeit auch Geld, das nicht von Staatsdienern
verwaltet wird. Vielleicht sogar mehr.
J. Ebmeier, Jugendwart im SV Siegfried Nordwest 1887 e.V.

Aus einem Briefwechsel
An H. v. H.
30. 1. 1997
… Nun zum Sport. Das ist auch für mich ein neues Thema. Vor einem Jahr bin ich zufällig zu Siegfried Nordwest geraten und habe seither eigentlich nur zugesehen. Gewiß hab ich mir auch immer so meine Gedanken gemacht… Erst aus gegebenem Anlaß beginne ich jetzt zu ordnen, und es muß nicht alles gleich beim erstenmal stimmen.
Ob z.B. Sport immer Wettkampf ist? Es gibt ganz einsame Sportarten, z. B. beim Alpinismus. Aber auch da ist wohl ‚der Andere’, dessen Marke man einholt und überholt, in Gedanken immer mit dabei. Doch das haben Sie mit Ihrem „kleinen täglichen Sport“ wohl nicht gemeint. Was alles will man unter Sport verstehen? Das ist keine semantische Frage. Sport als Wettkampf gibt es seit vielen tausend Jahren; eine Art Kulturkonstante, wenn man Johan Huizinga folgen will.
Körperliche Ertüchtigung „ganz und gar für mich“, alias fitness, gibt es aber, wenn ich nicht irre, eigentlich erst in der Industriegesellschaft; genau gesprochen, nach der Industriegesellschaft. Soll man das alles unter denselben Begriff fassen? Aber Sie haben recht, ich meine mit Sport eine öffentliche Angelegenheit, und an der Stelle, die Sie beanstanden, wollte ich darauf aufmerksam machen, daß der Sammelname Sport nur in der Schule etwas Bestimmtes bedeutet, nämlich ein „Fach“: weil es dafür einen Lehrer gibt und eine Zensur. Nur so ist er auch Pensum. Aber im gesellschaftlichen Leben gibt es immer nur diese oder jene sportliche Disziplin; und deren Träger ist immer dieser oder jener Verein – kein öffentliches Institut.

Daß dem im Poelchau-Modell Rechnung getragen wird – und sei es aus Geldmangel -, schien mir der springende Punkt zu sein. Ich denke, ich werde wohl etwas länger beim Jugendsport bleiben, als ich anfangs vorhatte. Ich war ein Vierteljahrhundert lang Sozialpädagoge und habe mich nie darum geschert. Nun merke ich, daß ich was versäumt habe. Da liegt jede Menge Energie verborgen, mit der man der ganzen Pädagogik Feuer unterm … machen kann, und das gefällt mir. Eine erste Probe habe ich Ihnen beigelegt. Ihnen als Altphilologen empfehle ich außerdem: Michael Poliakoff, „Kampfsport im Altertum“, vor ein paar Jahren bei Artemis-Winkler erschienen. Der Mann ist Althistoriker und war in seiner Jugend selber Ringer. [...]
1.3.1997
Vielen Dank für Ihre Texte. [...] Der
Mr. Poliakoff, den ich Ihnen empfohlen habe, bestreitet ausdrücklich,
daß die griechischen Athleten nur für einen Lorbeerzweig und eine
Handvoll Äpfel gekämpft hätten. In Olympia und Delphi habe es zwar
tatsächlich nicht so hohe Preisgelder gegeben, wie bei den weniger
berühmten Wettspielen, denn dorthin mußte man die Sportler nicht erst
locken. Dagegen seien die Sieger in ihren Heimatstädten (mit Ausnahme
von Sparta; die hielten sowieso nichts davon) mit gewaltigen Summen für
ihren Erfolg bezahlt worden – und dafür hätten sie trainiert! Er
berichtet von einem Ringer, der von einem Zehntel seiner Belohnung der
Stadt eine neue Übungshalle habe bauen lassen. Stellen Sie sich vor, wie
hoch die ganze Summe gewesen sein muß!
Er
meint, die Mode der Wettkämpfe sei im 8. Jahrhundert v. Chr.
ausgebrochen, als in der „Demokratie“ die Phalanx- und Hoplitentaktik das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten
und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den
Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine
„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.
Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des
Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz
bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis
hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der
Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.
(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)
das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten
und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den
Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine
„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.
Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des
Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz
bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis
hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der
Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.
(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)
 das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten
und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den
Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine
„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.
Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des
Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz
bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis
hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der
Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.
(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)
das Rittertum kriegstechnisch überflüssig gemacht hätten. Auffällig sei gerade bei den Kampfsportarten
und vor allem beim Ringen der hohe Anteil adeliger Namen bei den
Olympiasiegern. Es handelte sich dann allerdings um eine
„Kompensation“, wie Sie schreiben, und zwar um eine aristokratische.
Daß in der Schule – also dort, wo „Sport“ ein Fach ist – der Sinn des
Ganzen Kompensation für das geisttötende Stillesitzen ist, das ist ganz
bestimmt richtig. Ich würde sogar blind darauf wetten (nähere Kenntnis
hab ich nicht), daß zumindest in Deutschland (und Frankreich) der
Schulsport unter dieser Prämisse überhaupt erst eingeführt worden ist.
(Aber nicht im Lande der Gentlemen – darauf wett’ ich auch!)Das ist eben der sogenannte „Ausgleichssport“, wie er für die Industrie-, d. h. in Wahrheit: die Angestelltengesellschaft charakteristisch ist. Die Schule konnte sich eben nur nicht verkneifen (unbedingter Reflex), der Sache eine Zensur und einen Plan aufzusetzen. Das macht’s nicht rühmlicher.
Mich interessiert am Sport (d. h. am Ringen) nicht speziell die Dimension „Körperkultur“ bzw. Leibesübung. Die ist unstrittig. Und natürlich ist es besser, wenn aus „kompensatorischen“ Erwägungen der Sportunterricht ausgedehnt, als wenn aus
 fiskalischen
Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher
Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in
(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.
Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die
waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim
Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die
Gründe, warum ich dabei geblieben bin.
fiskalischen
Gründen ausgerechnet die Turnstunde gestrichen wird. Aber das ist eher
Sozialhygiene und elementare Menschenfreundlichkeit als „Pädagogik“ in
(irgend-) einem engeren Sinn. Mich interessiert das, was strittig ist.
Das sind nicht die Gründe, aus denen ich ans Ringen geraten bin. (Die
waren optisch-ästhetischer Natur. Beim Jugendringen, wohlbemerkt; beim
Männerringen sind Grazie, Witz und Eleganz eher selten.) Sondern die
Gründe, warum ich dabei geblieben bin.
Nämlich Ringen ist, o Schreck und Graus, Gewalt!
In
einer Schrift des Landessportbundes wird am Sport gerühmt, dort könne
man „Niederlagen trainieren“. Ach herrje! Mein’ Lebtag hab ich keinen
Sport getrieben. Aber Niederlagen trainieren? Ich tu ja kaum was andres!
Der springende Punkt ist vielmehr: Im Sport kann man siegen lernen;
siegen wollen lernen; siegenwollen dürfen lernen. Wenn’s sein muß, mit
Gewalt. Aber natürlich ist das Ganze symbolisiert. Darum ist es
ästhetisch, darum ist es Spiel. Es geht nicht um die faktische, sondern
um die symbolische Unterwerfung des Andern (der’s schließlich nicht
anders gewollt hat), und nicht um faktische, sondern um symbolische
Herrschaft – für einen Moment, an einem lieu consacré. Ein
„Spiel um Leben und Tod“, aber nur als ob; eine ernste Sache, und
trotzdem nicht ganz ernstgemeint, man könnte es ebensogut bleiben lassen
– doch das mindert nicht, sondern steigert den Erlebnisgehalt!
Natürlich nicht in jeder Sportart so sehr wie in der andern; und in keiner so wie beim Ringen. Was mich dabei jedesmal am meisten beeindruckt, ist, wie sich die Kinder Sieg und Niederlage zu Herzen  nehmen – und nicht zu
Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht
kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn
aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es
nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns
verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem
Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich
jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das
symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch
nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir
manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,
solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar
Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.
nehmen – und nicht zu
Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht
kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn
aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es
nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns
verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem
Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich
jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das
symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch
nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir
manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,
solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar
Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe. 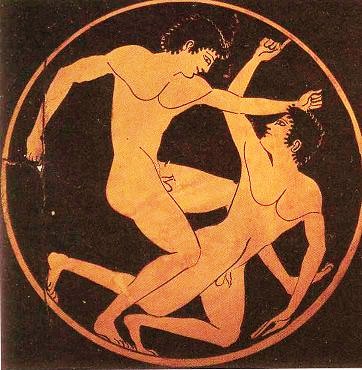
_______________________________________________________________________ nehmen – und nicht zu
Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht
kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn
aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es
nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns
verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem
Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich
jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das
symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch
nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir
manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,
solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar
Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe.
nehmen – und nicht zu
Wie-wir-mit-einander-umgehen. Symbolisch heißt aber nicht
kompensatorisch. Gewiß, die Zivilisation würde nicht lange halten, wenn
aus dem Spiel um Leben und Tod jedesmal Ernst würde. Trotzdem ist es
nicht bloß Ersatz für das, was dem ehemaligen Jäger in uns
verlorengegangen ist. Es ist das wirkliche, für einen Moment, an einem
Ort wirkliche Versuchen einer Möglichkeit; und nach dem Versuch weiß ich
jedesmal wirklich mehr als vorher. Um mit Ihren Worten zu reden: Das
symbolische Spiel um Leben und Tod bildet. Es muß nicht auch noch
nützen. Um den Platz des Spiels im Leben geht es mir, und da hat mir
manches in Ihren Texten aus der Seele gesprochen. Ich versuche im Ernst,
solche Gedanken im Sport anzupflanzen. Anbei finden Sie ein paar
Zeilen, die ich meinen Trainern ins Stammbuch geschrieben habe. 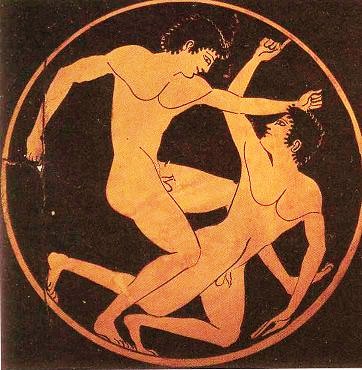
Worauf’s beim Ringen ankommt
Diskussionsbeitrag für den Ringerverein Nordwest 1887 e.V. im Mai 1996
Seit
einem halben Jahr beobachte ich nun aufmerksam das Ringen und mach mir
so meine Gedanken. Ich finde, es ist an der Zeit, daß ich mal
aufschreibe, was mir aus meiner Warte dazu bislang eingefallen ist. Der
wundeste Punkt am „Standort Deutschland“ ist, daß es hier zu viele Leute
gibt, die auf Nummer sicher gehn. Und die letzte Ursache für sogenannte
Jugendkriminalität, Gewaltbereitschaft“, „aggressives
Verhalten“ (und wie die Modewörter sonst heißen) ist, daß Kinder und
Jugendliche keine natürlichen Gefahren mehr erleben können – und sich
künstliche verschaffen müssen, weil sie noch nicht auf Nummer sicher
gehen wollen; Gott sei Dank!
Beim Ringen kann einer erfahren, daß  1)
Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache
ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und
daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie
er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen
Themen…
1)
Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache
ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und
daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie
er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen
Themen…
 1)
Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache
ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und
daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie
er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen
Themen…
1)
Leben auch Gefahr bedeutet; daß das gerade 2) den Reiz der Sache
ausmacht, und daß man 3) mit Anstand über die Runden kommen kann (und
daß es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ob einer heult, sondern wie
er heult). Das ist ein ganzer Komplex von sittlichen und ästhetischen
Themen…
Das
Ringen kann also nicht nur im Lebenslauf des Einzelnen, sondern – wenn
es eine gewisse Breitenwirkung fände – auch im Leben der ganzen
Gesellschaft eine „bildende“ Rolle spielen; wenigstens eine ganz, ganz
kleine. Trotzdem ist Ringen keine Sozialpädagogik. Sozialpädagogik ist
zuerst einmal eine Erwerbsarbeit für Sozialpädagogen (und ob sie
überdies noch etwas mehr ist, ist durchaus strittig). Aber Sport ist
Spiel – egal wie groß oder klein der ist, der ihn treibt. Und
doch ist es ein Unterschied, ob einer als Kind ringt, oder als
Erwachsener. Der Erwachsene hat seinen Lebensstil schon mehr oder
weniger fertig. Wenn er diesen oder jenen Sport (weiter) betreibt, dann
bestätigt und befestigt er damit diejenigen persönlichen Eigenarten, auf
die er sich ohnehin schon festgelegt hat. Ein Kind befindet sich aber
in einem persönlichen Wachstumsprozeß, im umfassendsten Sinn des Wortes.
Da wirkt der Sport noch menschenbildend (oder, wie Erwerbserzieher
sagen, „pädagogisch“).
Daß
im Sport des Erwachsenen das Athletische im Vordergrund steht – nämlich
der Erfolg, das Resultat des Kampfs -, versteht sich von selbst:  Sonst
bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein
„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese
Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die
Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und
zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz
sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen
guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von
vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die
Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.
Sonst
bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein
„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese
Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die
Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und
zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz
sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen
guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von
vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die
Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.
 Sonst
bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein
„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese
Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die
Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und
zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz
sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen
guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von
vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die
Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.
Sonst
bräuchte man gar nicht erst anzufangen. Dadurch nähert sich sein
„Spiel“ an Arbeit an. Aber wenn Kinder kämpfen wollen, wäre diese
Gewichtung ganz verkehrt. Hier geht es zuerst um den Kampf selbst: die
Gefahr, das Wagnis, den ‚Kick’ und die Haltung. So soll es sein – und
zwar nicht erst aus „pädagogischen“, sondern schon aus ganz
sportlich-pragmatischen Gründen. Denn wem es vor allem darum geht, einen
guten Kampf zu bieten, der hat auch das Zeug zum Sieger. Wer aber von
vornherein gebannt auf das Ergebnis starrt, der wird zu sehr die
Niederlage fürchten – und hat gute Chancen, zu verlieren.
Ein Erwachsener treibt einen Kampfsport, weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das
kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.
Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben
wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht
bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie
auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen
bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben
wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.
weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das
kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.
Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben
wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht
bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie
auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen
bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben
wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.
 weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das
kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.
Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben
wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht
bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie
auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen
bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben
wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.
weil er etwas leisten, weil er sich und andern etwas beweisen will. Das
kommt bei Kindern zwar auch schon vor, ist aber nicht gut.
Normalerweise treiben Kinder einen Kampfsport, weil sie was erleben
wollen. Aber wenn sie nicht schon völlig verzogen sind, werden sie recht
bald merken, daß sie auf die Dauer nur so lange was erleben, wie sie
auch was leisten. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Während Ringen
bei den Erwachsenen immer ein ausgesprochener Leistungssport bleiben
wird, hat es für Kinder auch ein bißchen den Charakter von Breitensport.
[…folgen einige praktische Vorschläge zur Veränderung des Trainings]
_________________________________________________________

Ringen als Schulfach
aus: Der Ringer
Zs. des Deutschen Ringer-Bundes, März-Ausgabe 1997
Es
besteht die Möglichkeit, an einer allgemeinbildenden Schule in Berlin
das Ringen als reguläres Unterrichtsfach einzuführen. Die
Poelchau-Oberschule (Gesamtschule) in der Jungfernheide
(Charlottenburg-Nord) plant für das Schuljahr 1997/98 die Einrichtung
von zwei 7. Klassen als Grundstock für einen „sportbetonten Zug“; als
eine der dort zu unterrichtenden Sportarten ist das Ringen vorgesehen.
Es handelt sich dabei um ein neues,
 von der Poelchau-Schule selbst entwickeltes Modell, das nicht mit
herkömm- lichen „Sportschulen“ zu verwechseln ist. Während dort die
Schulen selber Spitzensportler ausbilden wollen, heißt die Grundidee
hier vielmehr „Begabtenförderung“: Es gibt eben Kinder, die ein
besonderes sportliches Talent haben. Normalerweise können sie ihre
Begabung nicht entfalten, ohne ihre schulischen Leistungen zu
beeinträchtigen. In der Regel geht das Training auf Kosten der Schule
oder die Schule auf Kosten des Trainings: Es ist ganz einfach eine
Zeitfrage!
von der Poelchau-Schule selbst entwickeltes Modell, das nicht mit
herkömm- lichen „Sportschulen“ zu verwechseln ist. Während dort die
Schulen selber Spitzensportler ausbilden wollen, heißt die Grundidee
hier vielmehr „Begabtenförderung“: Es gibt eben Kinder, die ein
besonderes sportliches Talent haben. Normalerweise können sie ihre
Begabung nicht entfalten, ohne ihre schulischen Leistungen zu
beeinträchtigen. In der Regel geht das Training auf Kosten der Schule
oder die Schule auf Kosten des Trainings: Es ist ganz einfach eine
Zeitfrage!„Sportbetonter Zug“ bedeutet nun, daß der Unterricht so ausgestaltet wird, daß besonders begabte Kinder die Möglichkeit erhalten, die Ausbildung ihres sportliches Talents mit ihrer schulischen Entwicklung zu vereinbaren – indem bestimmte Sportarten selber als Schulfach anerkannt werden. Die Besonderheit des Poelchau-Modells ist die: Da z. Zt. in Berlin alle schulischen Neuerungen „kostenneutral“ sein müssen (d. h. kein zusätzliches Personal erfordern dürfen), will diese Schule die Sportvereine direkt an der Durchführung beteiligen.
Genau gesagt: Das tägliche (zweistündige) Training am Vormittag wird im wesentlichen von den Vereinstrainern durchgefhrt – die dazu von ihren Vereinen freigestellt und ggf. bezahlt werden müßten. Da es sich um ein Unterrichtsfach handelt, das sich auf dem Schulzeugnis niederschlägt (und in den Notendurchschnitt eingeht), wird es zwar von den Sportlehrern benotet; aber die Kriterien der Benotung werden gemeinsam mit den Trainern erarbeitet. Das heißt, daß die Vereine nicht nur für die praktische Ausgestaltung des Unterrichts selber Verantwortung tragen, sondern auch für den Grad der Würdigung, die die sportliche Leistung in der Schule erfährt – und das ist sportpolitisch von großer Bedeutung.

Es ist nämlich die Anerkennung des Sports als ein allgemeines Bildungselement; und die Anerkennung der Vereine als dessen eigentlicher Träger. In der Praxis wird es wohl darauf hinauslaufen, daß vormittags in der Schule vor allem Grundlagentraining betrieben wird, das ja am meisten Zeit kostet und am ehesten unter den Ansprüchen der Schule leidet; während die technische Feinarbeit – und die Ausbildung von Spitzensportlern – weiter nachmittags in der Vereinen stattfinden dürfte. Da ja das Grundlagentraining in allen Sportarten gemeinsame Züge aufweist – Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung -, ergeben sich bisher ungeahnte Möglichkeiten praktischer Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen. Hier gilt dasselbe wie bei der Kooperation mit dem Lehrkörper: Man wird vieles neu entwickeln müssen – und können.
Es ist im übrigen bemerkenswert,
 daß
gerade eine Gesamtschule die Förderung von Begabungen auf ihre Fahne
schreibt. Bislang wurde der Gesamtschul- gedanke noch stets mit der
„Kompensation von Defiziten“ gerechtfertigt. Überhaupt war es dreißig
Jahre lang in der Pädagogik üblich, eher auf die Schwächen der Kinder
abzusehen, als auf ihre Stärken.
daß
gerade eine Gesamtschule die Förderung von Begabungen auf ihre Fahne
schreibt. Bislang wurde der Gesamtschul- gedanke noch stets mit der
„Kompensation von Defiziten“ gerechtfertigt. Überhaupt war es dreißig
Jahre lang in der Pädagogik üblich, eher auf die Schwächen der Kinder
abzusehen, als auf ihre Stärken.Im Sport war es immer umgekehrt. Der Gedanke, daß sich die Entfaltung aller persönlichen Begabungen auch auf die schulischen Leistungen nur förderlich auswirken kann, steht gerade einer Gesamtschule gut zu Gesicht. Eine solche pädagogische Umorientierung ist die eigentliche Basis für ein Zusammenwirken von Schule und Sport.
Und damit gewinnt das Modell der Poelchau-Schule auch eine allgemeine bildungspolitische Bedeutung.
Doch davon, daß hier der Ringsport eine längst fällige öffentliche Aufwertung erfährt, müssen wir an dieser Stelle nicht lang reden. Die Aufmerksamkeit des Deutschen Ringerbundes sollte diesem Versuch gewiß sein.
_________________________________________________________________________
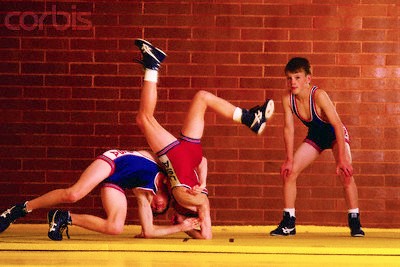 betr.: Ringen an der Poelchau-Schule
betr.: Ringen an der Poelchau-Schule
Beitrag auf einer Pressekonferenz von Landessportbund und Poelchau-Schule
8. 1. 1997
Die Arbeiterkulturbewgung verehrte alles Klassische, und bald galt das Ringen als der typische Arbeitersport. Mit dem Niedergang der Arbeiterkulturbewegung verlor das Ringen den Charakter eines Volkssports, und fast kann man sagen, es fristet seither ein Schattendasein. Es hat auch nicht, wie andere Sportarten, von der Popularisierung durch das Fernsehen profitieren können. Denn leider ist Ringen nicht „telegen“. Wir erinnern uns an die Bilder von der Olympiade in Atlanta: An der Weltspitze herrschen Technizität und Muskelkraft vor – so daß vom Kampf nicht mehr viel zu sehen ist, weil „nix passiert“. Beim Jugendringen ist es genau andersrum: Da kann man nix erkennen, weil alles so furchtbar schnell geht…

Dabei
wäre es wünschenswert, daß in einer so großen Stadt wie Berlin nicht
ein paar hundert, sondern ein paar tausend Jungen diesen Sport ausübten.
Denn er ist eine ideale Kunst für Leute, die in einem Alter sind, wo
sie mit ihren Kräften nicht knausern müssen, weil sie davon noch mehr
haben, als unbedingt nötig wäre. Daher begrüßt der SV Siegfried
Nordwest 1887 e.V. die Initiative der Poelchau-Schule. Wir erkennen
darin eine Möglichkeit, unserm Sport wieder zu dem Rang zu verhelfen,
den er eigentlich verdient.
Freilich möchten wir ihn nicht kurzatmig als einen sozialpädagogischen Trick verstanden wissen, um „Aggressionen abzubauen“ –  und
dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein
Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber
Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,
die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,
der ihn betreibt.
und
dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein
Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber
Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,
die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,
der ihn betreibt.
 und
dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein
Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber
Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,
die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,
der ihn betreibt.
und
dem Deutschlehrer die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sport ist kein
Disziplinierungs- mittel. Sport ist überhaupt kein Mittel. Er ist selber
Zweck. Er ist ein Kulturgut für die ganze Gesellschaft; auch für die,
die nur zuschauen. Und er ist ein persönliches Bildungselement für den,
der ihn betreibt.
Gerade
in dieser Hinsicht verdient die Initiative der Poelchau-Schule
besondere Beachtung. Denn in ihrer Konzeption wird erstmals der
kulturellen Realität des Sports durch die staatliche Pädagogik Rechnung
getragen. Natürlich gibt es überall „Sport“ als Schulfach. Ja, eben:
„Sport“ gibt es nämlich nur
als Schulfach! (Früher hieß das Leibesübungen.) In der Wirklichkeit
findet Sport aber als Wettkampf statt, nicht als Pensum. Und immer in
einer bestimmten Sportart. Die reale gesellschaftliche Existenzweise
jeder einzelnen Sportart ist jedoch, der Natur der Sache nach, der
Verein. Nach dem Modell der Poelchau-Schule werden nun die Vereine, als
die eigentlichen Träger des Kulturguts Sport, unmittelbar in die
pädagogische Verantwortung einbezogen. Das ist eine Innovation, die
nicht nur dem Sport, sondern auch der Institution Schule ganz ungeahnte
Perspektiven öffnet. Darum verdient dieses Experiment größte Beachtung,
weit über die sport- und schulpolitische Öffentlichkeit hinaus.
_________________________________________________________________________
In jedem Verein, in jedem Zweckverband gibt es mindestens zwei Temperamente. Die einen sagen: Möglichst viel und von allem ‘n bißchen. Die
andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-
versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es
insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi
„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich
halten, solange ich dieses Amt ausübe.
Die
andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-
versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es
insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi
„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich
halten, solange ich dieses Amt ausübe.
Mein heutiger Bericht zerfällt in zwei Teile: einen ersten, nicht nur erfreulichen, in dem auch selbstkritische Töne vorkommen, und einen zweiten, mehr optimistischen. Zu unsern Wettkampferfolgen in den letzten 12 Monaten will ich mich kurz fassen. [Hier folgt eine Liste der gewonnenen Medaillen.] Das klingt ganz gut; aber es waren immerhin neun Turniere! Nein, 1996 war nicht so erfolgreich wie 1995. Sowas kann immer mal vorkommen, und es hat sicher auch damit zu tun, daß einige unserer Besten in diesem Jahr in eine höhere Altersgruppe aufgestiegen waren. So war diesmal z.B. mehr als ein 8. Platz bei der Deutschen Meisterschaft nicht drin.
Bedenklicher ist, daß wir einen Rückgang bei den aktiven Sportlern verzeichnen mußten. Im Herbst stellten wir plötzlich fest, daß wir in Moabit keine D- und keine E-Jugend mehr haben. Dort trainieren nur noch fünf Jugendliche! In Lichtenberg sieht es etwas besser aus, dort sind rund dreimal soviele aktiv, aber die Situation ist nicht stabil. Es zeigt sich wiedermal: Nachwuchsarbeit muß man systematisch betreiben, mit Blick über den nächsten Tag hinaus.
 An
dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung: Eine sogenannte „Randsportart“ wie das Ringen kann nicht darauf warten, daß die Kinder von
alleine kommen. Das ist beim Fußball und bei einigen Mode-Sportarten der
Fall. Man mag bedauern, daß das Ringen nicht so populär ist, wie es
sein könnte. Aber über Nacht und ganz allein werden wir daran nichts
ändern. Vorläufig können die Ringer ihren Nachwuchs nur durch
persönlichen Kontakt, durch Mundpropaganda gewinnen. Das heißt dadurch,
daß ein Verein im Wohnviertel Wurzeln faßt und dort in der „Volkskultur“
eine Rolle spielt! Wenn im Wohnzimmer, in der Eckkneipe und vor allem
auf dem Schulhof gelegentlich mal einer sagt: „Ach, was war eigentlich
bei euerm Turnier letztes Wochenende?“
An
dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung: Eine sogenannte „Randsportart“ wie das Ringen kann nicht darauf warten, daß die Kinder von
alleine kommen. Das ist beim Fußball und bei einigen Mode-Sportarten der
Fall. Man mag bedauern, daß das Ringen nicht so populär ist, wie es
sein könnte. Aber über Nacht und ganz allein werden wir daran nichts
ändern. Vorläufig können die Ringer ihren Nachwuchs nur durch
persönlichen Kontakt, durch Mundpropaganda gewinnen. Das heißt dadurch,
daß ein Verein im Wohnviertel Wurzeln faßt und dort in der „Volkskultur“
eine Rolle spielt! Wenn im Wohnzimmer, in der Eckkneipe und vor allem
auf dem Schulhof gelegentlich mal einer sagt: „Ach, was war eigentlich
bei euerm Turnier letztes Wochenende?“
Das hat es früher in den Arbeitervierteln gegeben, wo Ringen populär war, aber das ist lange her. In Moabit ist davon nichts übrig, und in Lichtenberg fehlt es auch. Wir müßten also neu anfangen. Aber nicht jedes Wohngebiet eignet sich dafür. Und vor allem: Es setzt voraus, daß im Sportverein mehr vorkommt als nur der Sport; nämlich Geselligkeit und Vergnügen. Das gilt für die Erwachsenen und erst recht für die Kinder. Kurzum, wir hätten die Ärmel hochkrempeln und ganz tief pflügen müssen. [...]
Das muß auf zwei Feldern gleichzeitig geschehen. Zum einen durch die Qualität des Sports, den wir vertreten. Konkret gesprochen, durch das Niveau des Kinder- und Jugendringens in Berlin. Die Stabilisierung und Entwicklung des sportlichen Standards auf Landesebene liegt im unmittelbaren egoistischen Vereinsinteresse, weil es die Autorität unseres Sports – und damit auch die unsere stärkt.
Und zum andern durch die Qualität unseres Zusammenlebens mit den Kindern. Dazu gehören Spaß und Geselligkeit als tragender Grund gegenseitigen persönlichen Vertrauens. Jeder weiß, daß das nicht die unwichtigste Voraussetzung für den sportlichen Erfolg ist. Vielleicht nicht für jede einzelne Leistung in jedem einzelnen Wettkampf; aber doch für einen anhaltenden Leistungswillen, der auch Zeiten des Durchhängens überdauert.
Das eine ist die Bindung an diesen Sport, das andere ist die Bindung an diesen Verein – und das läßt sich nicht voneinander trennen. Wenn wir am Standort Jungfernheide rund um die Poelchau-Schule mit unsern knappen Kräften das hinkriegen, dann dürfen wir uns was darauf einbilden. Denn dann haben wir ein „Modell“ geschaffen, um das uns alle andern beneiden können. Aber wenn wir uns das nicht zutrauen, dann brauchten wir gar nicht erst anzufangen. Wenn ich meinen Bericht also mit einer optimistischen Note schließe, dann heißt das nicht, daß wir uns stolz und zufrieden zurücklehnen können, sondern daß die Arbeit jetzt überhaupt erst richtig losgeht: Wenn, dann richtig.
[ ...folgt ein kurzes Nachwort faktischen Inhalts.]

Man rühmt den Nutzen der Überlegung in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so
möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so
denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten
bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,
findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn
sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel
tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem
herrlichen
in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so
möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so
denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten
bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,
findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn
sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel
tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem
herrlichen  Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen
sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr
machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich
sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,
bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu
regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.
Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen
sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr
machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich
sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,
bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu
regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.
Der Athlet kann, in dem Augenblick, da er seinen Gegener umfaßt hält, schlechthin nach keiner anderen Rücksicht, als nach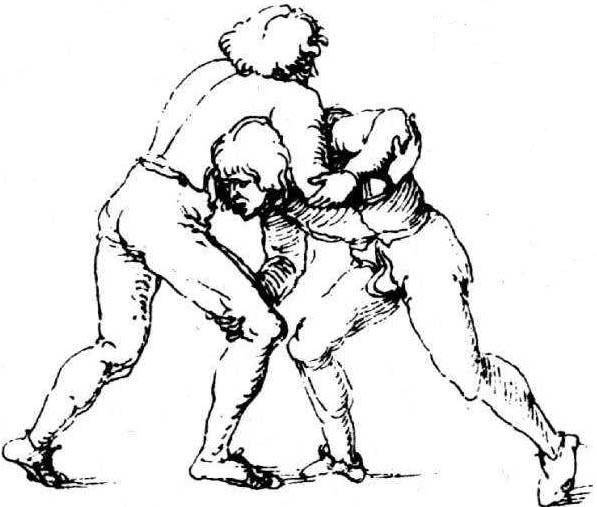 bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,
um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.
Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es
zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,
durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er
ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben
nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach
allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen,
bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,
um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.
Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es
zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,
durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er
ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben
nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach
allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen, Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,
was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der
Schlacht.”
Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,
was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der
Schlacht.”
Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, München 1965, Bd. II, S. 337f.
Bericht
an die Mitgliederversammlung
an die Mitgliederversammlung
des SV Siegfried Nordwest 1887 e. V.
31. 1. 1997
In jedem Verein, in jedem Zweckverband gibt es mindestens zwei Temperamente. Die einen sagen: Möglichst viel und von allem ‘n bißchen.
 Die
andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-
versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es
insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi
„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich
halten, solange ich dieses Amt ausübe.
Die
andern sagen: Wenn, dann richtig. Ich bin von der Mitglieder-
versammlung zum Jugendwart gewählt worden. Meine Aufgabe ist es
insbesondere, auf die Ökonomie der Kräfte zu achten. Ich gehöre quasi
„von Amts wegen“ zur Partei des Wenn, dann richtig. Daran will ich mich
halten, solange ich dieses Amt ausübe.Mein heutiger Bericht zerfällt in zwei Teile: einen ersten, nicht nur erfreulichen, in dem auch selbstkritische Töne vorkommen, und einen zweiten, mehr optimistischen. Zu unsern Wettkampferfolgen in den letzten 12 Monaten will ich mich kurz fassen. [Hier folgt eine Liste der gewonnenen Medaillen.] Das klingt ganz gut; aber es waren immerhin neun Turniere! Nein, 1996 war nicht so erfolgreich wie 1995. Sowas kann immer mal vorkommen, und es hat sicher auch damit zu tun, daß einige unserer Besten in diesem Jahr in eine höhere Altersgruppe aufgestiegen waren. So war diesmal z.B. mehr als ein 8. Platz bei der Deutschen Meisterschaft nicht drin.
Bedenklicher ist, daß wir einen Rückgang bei den aktiven Sportlern verzeichnen mußten. Im Herbst stellten wir plötzlich fest, daß wir in Moabit keine D- und keine E-Jugend mehr haben. Dort trainieren nur noch fünf Jugendliche! In Lichtenberg sieht es etwas besser aus, dort sind rund dreimal soviele aktiv, aber die Situation ist nicht stabil. Es zeigt sich wiedermal: Nachwuchsarbeit muß man systematisch betreiben, mit Blick über den nächsten Tag hinaus.

Das hat es früher in den Arbeitervierteln gegeben, wo Ringen populär war, aber das ist lange her. In Moabit ist davon nichts übrig, und in Lichtenberg fehlt es auch. Wir müßten also neu anfangen. Aber nicht jedes Wohngebiet eignet sich dafür. Und vor allem: Es setzt voraus, daß im Sportverein mehr vorkommt als nur der Sport; nämlich Geselligkeit und Vergnügen. Das gilt für die Erwachsenen und erst recht für die Kinder. Kurzum, wir hätten die Ärmel hochkrempeln und ganz tief pflügen müssen. [...]
Nun
ist uns eine ungeahnte Chance ohne viel eigenes Zutun gleichsam in den
Schoß gefallen. Es ist der Entschluß der Poelchau-Oberschule in
Jungfernheide, im kommenden Schuljahr einen „sportbetonten Zug“
einzurichten. Wir haben die Schule davon überzeugen können, dass das
Ringen unbedingt in ihrem Angebot vertreten sein muß. [...] Nicht jedes
Wohngebiet eignet sich dafür: doch kein zweites Wohngebiet in Berlin
dürfte sich so gut eignen wie unser neuer Standort Jungfernheide. Wir
sind dort fast konkurrenzlos in einem kleinen, übersichtlichen, unsern
Kräften angemessenen „Feld“ und besetzen eine strategische Stellung
zwischen der Oberschule und vier benachbarten Grundschulen. Wenn wir mit
unsern Kräften haushalten und uns nicht verwursteln, dann gehören wir
dort in ein, zwei Jahren zum Lokalkolorit und sind aus dem Viertel
„einfach nicht mehr wegzudenken“. Dann sagen die Kinder auf der Straße
zueinander: „Spielste Fußball oder jehste zum Ringen?“
Dort
können – und müssen – wir in die Tiefe wirken. Denn was noch fehlt, das
sind die „Wurzeln“ im Alltagsleben der Nachbarschaft.  Unser
Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie
das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für
ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern
und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn
sowas spricht sich rum.
Unser
Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie
das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für
ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern
und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn
sowas spricht sich rum.
 Unser
Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie
das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für
ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern
und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn
sowas spricht sich rum.
Unser
Verein muß sich im Kiez zu einer moralischen Autorität aufbauen. Wie
das? Indem wir zuerst für die Kinder, die bei uns ringen, und dann für
ihre Eltern und Lehrer; dann für ihre Freunde und dann für deren Eltern
und Lehrer zu einer moralischen Autorität werden – und so fort; denn
sowas spricht sich rum.Das muß auf zwei Feldern gleichzeitig geschehen. Zum einen durch die Qualität des Sports, den wir vertreten. Konkret gesprochen, durch das Niveau des Kinder- und Jugendringens in Berlin. Die Stabilisierung und Entwicklung des sportlichen Standards auf Landesebene liegt im unmittelbaren egoistischen Vereinsinteresse, weil es die Autorität unseres Sports – und damit auch die unsere stärkt.
Und zum andern durch die Qualität unseres Zusammenlebens mit den Kindern. Dazu gehören Spaß und Geselligkeit als tragender Grund gegenseitigen persönlichen Vertrauens. Jeder weiß, daß das nicht die unwichtigste Voraussetzung für den sportlichen Erfolg ist. Vielleicht nicht für jede einzelne Leistung in jedem einzelnen Wettkampf; aber doch für einen anhaltenden Leistungswillen, der auch Zeiten des Durchhängens überdauert.
Das eine ist die Bindung an diesen Sport, das andere ist die Bindung an diesen Verein – und das läßt sich nicht voneinander trennen. Wenn wir am Standort Jungfernheide rund um die Poelchau-Schule mit unsern knappen Kräften das hinkriegen, dann dürfen wir uns was darauf einbilden. Denn dann haben wir ein „Modell“ geschaffen, um das uns alle andern beneiden können. Aber wenn wir uns das nicht zutrauen, dann brauchten wir gar nicht erst anzufangen. Wenn ich meinen Bericht also mit einer optimistischen Note schließe, dann heißt das nicht, daß wir uns stolz und zufrieden zurücklehnen können, sondern daß die Arbeit jetzt überhaupt erst richtig losgeht: Wenn, dann richtig.
[ ...folgt ein kurzes Nachwort faktischen Inhalts.]

____________________________________________________________________________
Von der Überlegung
Eine Paradoxe
Man rühmt den Nutzen der Überlegung
 in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so
möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so
denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten
bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,
findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn
sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel
tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem
herrlichen
in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so
möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so
denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten
bestimmen sollte, folgende Rede zu halten. “Die Überlegung, wisse,
findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn
sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel
tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem
herrlichen  Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen
sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr
machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich
sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,
bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu
regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.
Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unterdrücken, dagegen
sich nachher, wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr
machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, nämlich
sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,
bewußt zu werden, und das Gefühl für andere künftige Fälle zu
regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhält sich mit dem Handeln wie mit dem Ringen.Der Athlet kann, in dem Augenblick, da er seinen Gegener umfaßt hält, schlechthin nach keiner anderen Rücksicht, als nach
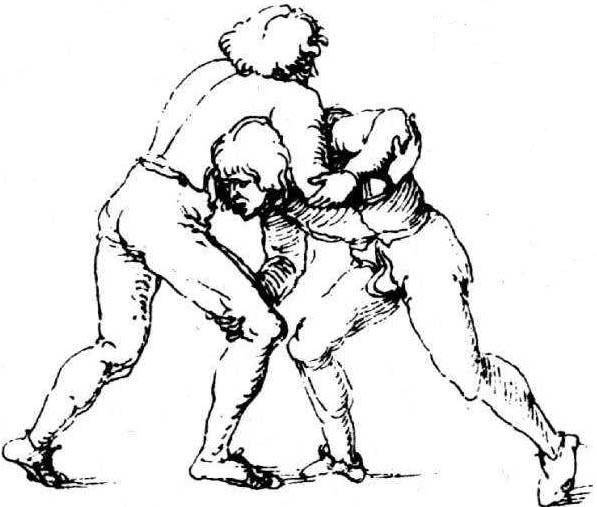 bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,
um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.
Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es
zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,
durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er
ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben
nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach
allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen,
bloßen augenblicklichen Eingebungen verfahren, und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Glieder er in Bewegung setzen soll,
um zu überwinden, würde unfehlbar den kürzeren ziehen, und unterliegen.
Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es
zweckmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen,
durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welches Bein er
ihm hätte stellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben
nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt hält, und tausendgliedrig, nach
allen Windungen des Kampfs, nach allen Widerständen, Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,
was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der
Schlacht.”
Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt, der wird,
was er will, in keinem Gespräch durchsetzen; viel weniger in der
Schlacht.”Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, München 1965, Bd. II, S. 337f.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen