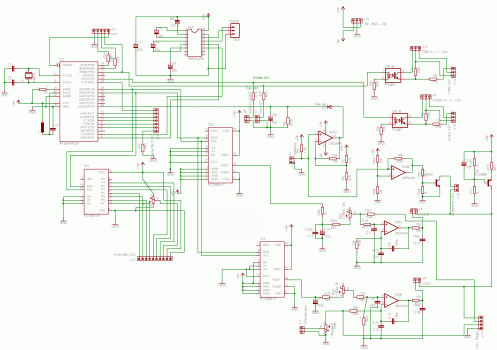aus Der Standard, Wien, 24./25.1.2015
aus Der Standard, Wien, 24./25.1.2015
"Big Hero 6": Kampfmaschine und Krankenpfleger
Der Junge mit dem Erste-Hilfe-Roboter: Der neue Disney-Animationsfilm "Big Hero 6" nimmt das Thema Freundschaft zwischen Mensch und Maschine auf und reichert es mit einer Vielzahl von Themen und Motiven an
von Michael Pekler
Wien - Wer Erfindergeist nicht für die gute Sache verwendet, läuft Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten. Der 14-jährige Hiro, der als Waise bei seiner Tante in San Fransokyo, einem futuristischen Konglomerat aus San Francisco und Tokio, aufwächst, ist eines jener Genies, die ihre Fähigkeiten lieber in den Dienst der eigenen Sache stellen. Hiro treibt sich bei illegalen Roboterkämpfen herum und macht mit seiner harmlos aussehenden, aber effektiven Kampfmaschine Taschengeld.
Der Roboter, um den sich die Erzählung von Big Hero 6 (Baymax), dem jüngsten Animationsfilm von Don Hall und Chris Williams aus der Disney-Computerwerkstatt, dreht, ist gleichwohl ein anderer: Baymax ist ein strahlend weißer, aufblasbarer "persönlicher Gesundheitsbegleiter", hinterlassen von Hiros älterem und nicht weniger erfindungsreichem Bruder. Ein nicht beabsichtigtes Abschiedsgeschenk, das sich freundlich nach dem Befinden erkundigt, medizinische Sofortmaßnahmen ergreift und sich deaktiviert, wenn der Patient seine Gesundheit bekräftigt. Und einen solchen Gefährten, der sich nicht nur um sein körperliches, sondern auch sein seelisches Wohl kümmert, braucht ein jugendlicher Stubenhocker dringend.

Das auf den ersten Blick scheinbar bekannte Szenario einer Freundschaft zwischen Mensch und Maschine erweist sich in Baymax als vielschichtige Erzählung, die vom Autorenduo Daniel Gerson und Robert L. Baird (Monsters University) mit einer Vielzahl von Themen angereichert wird. Denn nachdem Hiros jüngste Erfindung in die falschen Hände gefallen ist und zu einer buchstäblich großen Gefahr für die Stadt heranwächst, entwickelt sich das Coming-of-Age-Drama zum Whodunit. Und in der Folge - wenn Hiro und die Erfindercrew seines Bruders im Kampf gegen den Schurken ihre Gadgets zum Einsatz bringen - gar zum smarten Superheldenfilm.
Als humanoider Roboter, dessen Gesicht sich auf zwei schwarze Knopfaugen beschränkt, entwickelt Baymax zwar menschliche Verhaltensweisen, stellt seine Bestimmung als treuer Diener seines Herrn jedoch nie infrage. Da wiegt die Behandlung pubertärer Stimmungsschwankungen gleich schwer wie die Bedrohung einer Metropole. Der Idee von der beseelten künstlichen Intelligenz, die sich zum besten Freund des Menschen entwickelt, kann dieser Film trotzdem nicht widerstehen.
Doch wer so viel Empathie beweist wie dieser zur Kampfmaschine aufgerüstete Krankenpfleger, dem sei am Ende auch ein eigenes Herz gegönnt, über das nur er selbst entscheiden darf.

_poster_003.jpg)








_623_b1.png)