
Ein romantisches Menschenbild
zur Jahrtausendwende
Ich schwöre Ihnen, erwiderte Ulrich ernst, daß weder ich noch irgendwer weiß,
was der, die, das Wahre ist; aber ich kann Ihnen versichern,
daß es im Begriff steht, verwirklicht zu werden!
Musil, Der Mann ohne Eigenschaften
was der, die, das Wahre ist; aber ich kann Ihnen versichern,
daß es im Begriff steht, verwirklicht zu werden!
Musil, Der Mann ohne Eigenschaften
Abrupt ist gerade * das
zwanzigste Jahrhundert zu Ende gegangen. War es die Epoche der
Weltrevolution oder war es, wie ein konservativer Geist meinte „der
europäische Bürgerkrieg“, gleichviel: vorbei ist es so oder so.
Eine neue Zeit bricht
an, und nirgends so stürmisch wie bei den Deutschen. Ein normales Volk
unter den Völkern in einem normalen Staat unter den Staaten, das hatten
wir noch nie.  Und
immer noch in der Mitte Europas. Ganz ungewohnt: Wir werden uns nicht
mehr mit uns und mit dem Naheliegenden begnügen können. An unsere
Geschichte müssen wir jetzt wieder in der ersten, statt bloß in der
dritten Person denken. Die Welt ist nicht mehr, was sie war, und wir
auch nicht. Unsern Platz müssen wir, wie die andern Völker auch, selbst
bestimmen.
Und
immer noch in der Mitte Europas. Ganz ungewohnt: Wir werden uns nicht
mehr mit uns und mit dem Naheliegenden begnügen können. An unsere
Geschichte müssen wir jetzt wieder in der ersten, statt bloß in der
dritten Person denken. Die Welt ist nicht mehr, was sie war, und wir
auch nicht. Unsern Platz müssen wir, wie die andern Völker auch, selbst
bestimmen.
 Und
immer noch in der Mitte Europas. Ganz ungewohnt: Wir werden uns nicht
mehr mit uns und mit dem Naheliegenden begnügen können. An unsere
Geschichte müssen wir jetzt wieder in der ersten, statt bloß in der
dritten Person denken. Die Welt ist nicht mehr, was sie war, und wir
auch nicht. Unsern Platz müssen wir, wie die andern Völker auch, selbst
bestimmen.
Und
immer noch in der Mitte Europas. Ganz ungewohnt: Wir werden uns nicht
mehr mit uns und mit dem Naheliegenden begnügen können. An unsere
Geschichte müssen wir jetzt wieder in der ersten, statt bloß in der
dritten Person denken. Die Welt ist nicht mehr, was sie war, und wir
auch nicht. Unsern Platz müssen wir, wie die andern Völker auch, selbst
bestimmen.
Der Pädagogenstand,
Mehrer des Fortschritts und Wahrer guter Gesin-nung, hat von alldem noch
nichts gemerkt. Er zehrt weiter, schlecht oder recht, am Vermächtnis
des Jahres Achtundsechzig. Sind aber nicht gerade die Kinder, mehr noch
als die andern, Kinder ihrer Zeit? „Weiter so“ ist schon an ruhigen
Tagen keine Losung, die der Pädagogik zu Gesicht stünde. Doch im Moment
der Zeitenwende macht sie sich damit ganz unmöglich.
Nicht das Kapital ist zusammengebrochen. Seine zivilisatorische Mission war wohl noch nicht erschöpft: Der Welt-Markt liegt erst noch vor uns.
Das nachindustrielle Zeitalter läßt auf sich warten, die Postmoderne ist schon wieder vorbei. Die Welt, in der wir leben, stellt sich neuerlich dar, als was sie ist: bürgerliche Gesellschaft.
Durchbruch
Doch der Charakter der bürgerlichen Zeit ist Krisis. Sie ist das Tor, das aus der Naturnotwendigkeit hinausführt ins Reich der Freiheit – oder in die Barbarei. Die Krisis ‚äußert’ sich als Revolution in Permanenz: Jede noch verbliebene Naturschranke wird beiseite geschoben, noch die letzte Naturfessel wird abgestreift wie eine Schlangenhaut, eine nach der andern.
Ihre nacheinander eingerichteten Gesellschaftsbildungen haften der Menschheit an wie Häute, in denen sich ihre Anpassung an die – je durch Arbeit modifizierte – Natur materialisiert hat zu so und sovielen Bedürfnissen und „Eigenschaften“ der Menschen selbst. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Aber die Menschen machen ihre Geschichte selbst. Sie können sich häuten, wenn und weil sie es wollen.
Der Charakter der bürgerlichen Epoche ist Revolution in Permanenz. Theoretisch ausgesprochen hat sie ihn in der Wissenschaftslehre – als der „pragmatischen Geschichte“ davon, wie ‚das Ich’ sich immer wieder „selbst setzt“ im ‚praktischen Erzeugen einer gegenständlichen Welt’ – als seinem Spiegel. [1]
 Die Geschichte davon,
wie es ein ‚Selbst’ wird, indem es die Welt zu seiner Aufgabe macht; wie
es seine Zukunft zu dem macht, was ihm zukommt.
Die Geschichte davon,
wie es ein ‚Selbst’ wird, indem es die Welt zu seiner Aufgabe macht; wie
es seine Zukunft zu dem macht, was ihm zukommt.Je dringender aber die bürgerliche Welt nach ihrer Zukunft fragt, umso unabweisbarer wird ihr ihre Herkunft zum Problem. Führt ein gerader Weg von ihrem Woher zu ihrem Wohin? Waren die Bewegungsgesetze ihrer Gegenwart schon die Bildungsgesetze ihrer Entstehung? Nur wenn ihre Entwicklungslogik immanent, und wenn die bürgerliche Verkehrsweise in sich selbst begründet ist, läßt sich aus ihrem Heute auch ihr Morgen hochrechnen. Anderfalls bleibt ihre Zukunft in der Schwebe.
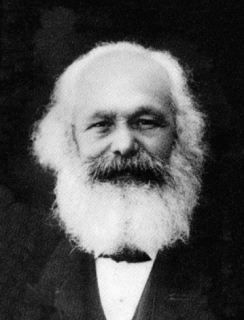 Jene Selbstreflexion der bürgerlichen Gesellschaft auf ihre Ursprünge war die Kritik der politischen Ökonomie gewesen – als Durchführung des Programms der Wissen-schaftslehre am Spezialfall der Bildung des Kapitalverhältnisses. Sie beschrieb
nicht einfach, wie das ‚System’ der bürgerlichen Ökonomie
„funktioniert“, sondern sie zeigte, daß sein Funktionieren auf einer
sachlichen Bedingung beruht, die durch das System nicht begründet werden
kann, weil sie es selbst begründet: die Trennung des Arbeitsvermögens
von den Arbeitsmitteln, alias „die sogenannte ursprüngliche
Akkumulation“. Es ‚basiert’’ auf einem historischen Faktum, nicht auf
einem Gesetz.[2]Aber Fakta sind vergänglich.
Jene Selbstreflexion der bürgerlichen Gesellschaft auf ihre Ursprünge war die Kritik der politischen Ökonomie gewesen – als Durchführung des Programms der Wissen-schaftslehre am Spezialfall der Bildung des Kapitalverhältnisses. Sie beschrieb
nicht einfach, wie das ‚System’ der bürgerlichen Ökonomie
„funktioniert“, sondern sie zeigte, daß sein Funktionieren auf einer
sachlichen Bedingung beruht, die durch das System nicht begründet werden
kann, weil sie es selbst begründet: die Trennung des Arbeitsvermögens
von den Arbeitsmitteln, alias „die sogenannte ursprüngliche
Akkumulation“. Es ‚basiert’’ auf einem historischen Faktum, nicht auf
einem Gesetz.[2]Aber Fakta sind vergänglich.Und weiter!
Da sie so aus ihren heutigen Bewegungsregeln ihre zukünftige Entwicklungsrichtung nicht einfach extrapolieren kann, kommt sie sich nach vorn hin offen vor. Ihre Krisis erscheint ihr als Progressus in infinitum. Sie weiß zwar, daß es irgendwo „hin“ geht. Aber sie weiß nicht, wo das liegt. Sie fühlt sich unterwegs, aber sie weiß nicht die Richtung. Sie weiß nur, daß da irgendeine „sein muß“.
Das Hier und das Jetzt der bürgerlichen Gesellschaft heißen immer: plus ultra. Für den Einzelnen bedeutet das: Er muß sein Leben führen – denn es versteht sich nicht mehr von selbst. Und wenn es nach vorne offen ist, muß er seine Bestimmung suchen – nämlich da, wo er nicht ist. Ist ihm sein Ziel nicht ‚gegeben’, so kann er es auch nicht sehen – nicht einmal als ‚Idee’; nicht, wie es aussieht, noch wo es liegt. Er ahnt nur, daß eins da sein muß. Darum steht er nicht einmal, sondern immer vor der Frage: Wo soll ich hin? Wie geht es weiter? Und das heißt immer bloß: Was ist der nächste Schritt? An einem spanischen Kloster steht die Inschrift: No hay caminos; hay que caminar. Oder wie der Tatmensch Oliver Cromwell das ausgedrückt hat: Einen Mann trägt sein Roß nie weiter, als wenn er nicht weiß, wohin er reitet. – Sein Ziel ist dann nämlich nur: weiter vorn.
Ein ewig gegenwärt’ges Nun.
Doch „wenn man nicht weiß, wohin man geht, weiß man bald auch nicht mehr, wo man sich befindet“[3]. So schlägt die Permanenz der bürgerlichen Krisis sich erlebenswirklich nieder als permanente Selbstreflexion – das ewige Fragen nach Wo, Woher und Wohin. Es ist die unablässige
 Neugeburt des transzendentalen Subjekts: Es ist nur in actu, es ist immer wieder „frei und neu in jedem Nun“[4]. Ansonsten ‚ist’ es nur formale Möglichkeit.
Neugeburt des transzendentalen Subjekts: Es ist nur in actu, es ist immer wieder „frei und neu in jedem Nun“[4]. Ansonsten ‚ist’ es nur formale Möglichkeit.
Es dauert nicht in Raum und Zeit. Es kann sich nicht ‚rechtfertigen’ durch bleibende Werke. Es muß sich bewähren stets aufs neue. Es ‚ist’ nicht erbrachte Leistung, sondern höchstens stete Bereitschaft, zu leisten. Es rechtfertigt sich „allein aus dem Glauben“, als daz fünklîn,[5] das nur leuchtet, wenn ich es anschaue. „’Ich bin’ heißt, ich befinde mich in allgemeiner Relation, oder ich wechsle – es ist das Glied des Wechsels überhaupt: erstes Spiel.“[6]
Ein ‚Ziel’ – ein Unbedingtes, bei dem er stehenbleiben; ein Absolutes, bei dem er sich beruhigen könnte – ist dem modernen Menschen nicht „sichtbar“; ist nicht im Raum noch in der Zeit. Und doch soll es ihm „irgendwie“ präsent sein! Nämlich als Maßstab seines jeweiligen Handelns, hier und jetzt. „Moral ist die Zuordnung jedes Augenblickszustandes unseres Lebens zu einem Dauerzustand.“[7] Aber er kanns nicht behalten und kanns nicht vergessen, und faßt er es ganz, so kann ers nicht messen. „Das einzig mögliche Absolute, das uns gegeben werden kann“, ist „die unendlich freie Tätigkeit in uns“. Es „läßt sich nur negativ erkennen, indem wir handeln und finden, daß durch kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen“. [8] Und mit den Worten des Cherubinischen Wandersmanns: Je mehr du nach ihm greifst / je mehr entwird er dir.
Als ob
 „Ich glaube nicht, daß Gott da war, sondern daß er erst kommt. Aber nur,
„Ich glaube nicht, daß Gott da war, sondern daß er erst kommt. Aber nur, wenn man ihm den Weg kürzer macht als bisher.“
Se. Erlaucht wies das mit den würdigen Worten zurück: „Das ist mir zu hoch.“
Der Mann ohne Eigenschaften
Der Mann ohne Eigenschaften
Dieses Paradox wird gewöhnlich veranschaulicht durch die Metaphern „Ideal“ und „unendliche Annäherung“. Aber solche Bilder verdunkeln mehr, als sie erhellen.
Da ist kein ‚Punkt’, dem es näherzukommen gälte, früher oder später, mehr oder weniger. Sondern da ist ein Wert, der gilt – jetzt und überhaupt. Man ‚hat’ ihn nicht als Aktivposten,sondern wie einen Stachel. Er gilt, indem ich jederzeit so handle, als ob die Welt „jetzt schon“ nach einem göttlichen Heilsplan eingerichtet wäre. Wenn alle so handelten, als ob es eine göttliche Weltregierung gäbe, dann – gäbe es eine göttliche Weltregierung.
Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und so kann ich auch nicht messen, wie weit mich mein Handeln jenem idealen Zustand „nahegebracht“ hat. Ich kann nur wissen, daß ich so gehandelt habe, als ob… Wenn aber das Resultat kläglich ausfiel, dann wird mich das bekümmern; doch reuen muß es mich nicht.
Mehr noch als die Geschichte der Gattung ist so der Lebensplan jedes Einzelnen Sinngebung des Sinnlosen. Die Welt ist ‚alles, was der Fall ist’. Ein Sinn ist darin noch keiner. Mein Leben in der Welt dagegen ist so, wie es sein soll – oder nicht. Anderer Sinn wird sich in der Welt nicht auffinden lassen.
Das Unbefriedigende daran ist, daß man das Ende nie zu fassen kriegt. Immer greift man ins Leere. Da ist kein Stoffliches, vulgo „Inhalt“, in dieser Moral, woran man sich halten könnte. Sie ist die Ausbreitung einer einzigen Tautologie – zu einem Paradox.
Durch einander
Die ganze Philosophie ist aber so eine Tautologie. Sie besteht nur in der Auflösung eines tautologischen Satzes in einen Gegensatz. Jener Satz heißt a = a, oder „was ist, ist“, und ist
 landläufig
als ‚Satz der Identität’ bekannt. Einen Sinn hat er freilich nur, wenn
damit „eigentlich“ eine – Nichtidentität gemeint ist. Dann heißt er so:
Das Eine ist ‚es selbst’ durch ein Andres; soll gelten als das Andre.[9] Etwa
so: Das Unendliche soll endlich sein; oder: Das Unbedingte soll bedingt
werden; oder auch, Was ist, soll einen Sinn haben. – Dann ist er nicht
Feststellung einer Tatsache, sondern Stellung einer Aufgabe.
landläufig
als ‚Satz der Identität’ bekannt. Einen Sinn hat er freilich nur, wenn
damit „eigentlich“ eine – Nichtidentität gemeint ist. Dann heißt er so:
Das Eine ist ‚es selbst’ durch ein Andres; soll gelten als das Andre.[9] Etwa
so: Das Unendliche soll endlich sein; oder: Das Unbedingte soll bedingt
werden; oder auch, Was ist, soll einen Sinn haben. – Dann ist er nicht
Feststellung einer Tatsache, sondern Stellung einer Aufgabe.
In der Geschichte der abendländischen Philosophie ist jene Aufgabe als das Problem der „Einheit von Subjekt und Objekt“ formuliert und formalisiert worden. Aber so, als ob seine Lösung irgendwann einmal gelingen müßte. Doch kann ich den „Gegensatz des Bewusstseins“ lediglich ‚praktisch’ als gegenstandslos behandeln – nämlich im Moment der Tat selbst, wo im Vollzuge ‚Subjekt’ und ‚Objekt’, Sinn und Sein, das Gegebene und die Aufgabe, der ‚Stoff’ und die ‚Form’ wirklich in einem Punkt zusammenfallen. Die Lösung ‚gelingt’ immer nur actu: während der Tat, doch schon nicht mehr in ihrem Produkt; und hernach ist alles so offen wie je zuvor. Die Lösung der Aufgabe ist immer wieder nur die Aufgabe selbst.
Der dialektische Schein
Und wenn ich es recht bedenke, ist der ‚Gegensatz des Bewußtsein’ auch theoretisch ein bloßer Schein. Im wirklichen Leben kommen überhaupt nur Handlungen vor. Ohne das wäre ein ‚Objekt’ uns ebensowenig gewärtig wie ein ‚Subjekt’. Die Handlungen sind das Reale am wirklichen Leben. Was aber „in Begriffen dargestellt wird, ruht“[10]. ‚Subjekt’ und ‚Objekt’ sind theoretische Bestimmungen, die eine abstrahierende Reflexion im nachhinein in meine Anschauung hineingetragen hat. Sie stammen nicht aus dem natürlichen Bewußtsein, sondern sind selbst schon Wissenschaft.
Doch reden wir hier ja nicht vom natürlichen Bewußtsein „überhaupt“, sondern von der Gemütslage des modernen, des bürgerlichen Menschen. Und den zeichnet es allerdings aus, daß er eben – reflektiert. Es ist ihm ja nichts mehr selbstverstündlich, kein Gegebenes und kein Aufgegebenes. Die beseufzte „Verwissenschaftli-chung des Alltags“ hat diesen Grund: Er muß fragen – nach einem Wozu. Und prompt zerfällt ihm die Wirklichkeit in ein Ich und in ein Nichtich. Um die Unschuld ists geschehn.
Der antiquierte Mensch ist mit sich selbst im Reinen und in jeder Nische zuhaus, wo es sich wohlsein läßt.
 Das ist die Gattung des Philisters. Sie ist zwar noch zahlreich, aber schon veraltet.
Sie ahnen es, und seither werden sie ihrer Unzufriedenheit nicht mehr Herr:
Das ist die Gattung des Philisters. Sie ist zwar noch zahlreich, aber schon veraltet.
Sie ahnen es, und seither werden sie ihrer Unzufriedenheit nicht mehr Herr:Es scheint, daß der brave, praktische Wirklichkeitsmensch die Wirklichkeit nirgends restlos liebt und ernst nimmt. Als Kind kriecht er unter den Tisch, um das Zimmer der Eltern, wenn sie nicht zu Hause sind, durch diesen genial einfachen Trick abenteuerlich zu machen; als Knabe sehnt er sich nach der Uhr; als Jüngling mit der goldenen Uhr nach der zu ihr passenden Frau; als Mann mit Uhr und Frau nach der gehobenen Stellung; und wenn er glücklich diesen kleinen Kreis von Wünschen zustande gebracht hat und ruhig darin hin und her schwingt wie ein Pendel, scheint sich sein Vorrat unbefriedigter Träume um nichts verringert zu haben. Wenn er sich erheben will, so gebraucht er dann ein Gleichnis – denn es kommt ihm anscheinend nur darauf an, etwas zu dem zu machen, was es nicht ist; was wohl ein Beweis dafür ist, daß er es nirgends lange aushält, wo immer er sich befinde.[11]
Der Philister ist eine aussterbende Spezies.
Eine komische Existenz
Der moderne Mensch ist ein Wanderer: An seinem Platz ist er immer fremd. Setzt er sich fest, fällt er aus seiner Bestimmung.[12] Das Endliche, das er nur immer hat, wird zur greifbaren Figur erst vorm Hintergrund des Unendlichen, das er haben soll und nicht haben kann. Gewärtig ist ihm das Endliche bloß als ein (zu kleines) Stücklein vom Absoluten. „Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge.“[13] In seiner Welt ist er jenseits. Er ist selber das Paradox: Seine Gottheit ist diesseitig, sein Jenseits hier und jetzt, sein Alltag ist seine Offenbarung, seine Erkenntnis Ironie, denn „jeder Philosoph, der die Immanenz gegen die empirische Person geltend macht, ist ein Ironiker“[14]. Er partizipiert an der Ewigkeit, indem er weiß, daß er nur vorläufig ist.
Es ist die Anschauung des hier-und-jetzt-Gegebenen sub specie aeterni –
so „als ob“ es ein Unbedingtes zu  vergegenwärtigen habe -, die die
Romantiker Ironie genannt haben. „Der Humor, als das umgekehrte
Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den
Kontrast mit der Idee.“[15] Gemessen
an der ‚unendlichen Aufgabe’ wird alles Reale, jedes einmal fertige
Produkt, das im Raum und in der Zeit vorkommt, komisch: Verglichen mit
dem, was es vorstellen soll, wirkt es gemein – und rührend zugleich.
vergegenwärtigen habe -, die die
Romantiker Ironie genannt haben. „Der Humor, als das umgekehrte
Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den
Kontrast mit der Idee.“[15] Gemessen
an der ‚unendlichen Aufgabe’ wird alles Reale, jedes einmal fertige
Produkt, das im Raum und in der Zeit vorkommt, komisch: Verglichen mit
dem, was es vorstellen soll, wirkt es gemein – und rührend zugleich.
 vergegenwärtigen habe -, die die
Romantiker Ironie genannt haben. „Der Humor, als das umgekehrte
Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den
Kontrast mit der Idee.“[15] Gemessen
an der ‚unendlichen Aufgabe’ wird alles Reale, jedes einmal fertige
Produkt, das im Raum und in der Zeit vorkommt, komisch: Verglichen mit
dem, was es vorstellen soll, wirkt es gemein – und rührend zugleich.
vergegenwärtigen habe -, die die
Romantiker Ironie genannt haben. „Der Humor, als das umgekehrte
Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den
Kontrast mit der Idee.“[15] Gemessen
an der ‚unendlichen Aufgabe’ wird alles Reale, jedes einmal fertige
Produkt, das im Raum und in der Zeit vorkommt, komisch: Verglichen mit
dem, was es vorstellen soll, wirkt es gemein – und rührend zugleich. „Ironie ist die Form des Paradoxen“, sie repräsentiert den „unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und Bedingten“[16]. Durch sie erst „wird das eigentümlich Bedingte allgemein interessant und erhält objektiven Wert“[17]. „Sie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst hinweg.“ [18]
Wo das empirische Ich aus sich heraustritt, sich über sich hinwegsetzt und von dort aus – auf sich zurückblickt: dort reden wir von Reflexion. Permanente Reflexion ist der Charakter der bürgerlichen Existenz. Sie ist deren reale Ironie, auch bei einem, dem aller Humor abgeht.
Mann ohne Eigenschaften
Was immer er erreichen will, es ist immer nur der nächstbeste Schritt auf seinem Weg ins Unendliche. Und hat er was erreicht, kehrt es sich gegen ihn als die nächste Schranke auf seinem Weg. Es hält ihn auf, es hält ihn fest, es schmiedet ihn an… das Endliche. Das richtige war es nur, solange er es nicht hatte. Kaum hält er es in Händen, da ist es schon falsch. „Das Endziel hat keine bestimmte Weise, es entwächst der Weise und geht in die Breite.“[19] Was immer er hat, es ist nicht genug. Immer ist er auf dem Weg zu einem andern Ufer. Und wo er sich niederläßt, da – schwebt er nur.
Was er je geworden ist – gemessen an dem, was er alles nicht ist, ist es viel zu wenig. Alle Eigenschaften, die er haben kann, sind ebensoviele Einschränkungen seiner Möglichkeiten: weniger Reichtum als Mangel. Seiner Bestimmung gerecht wird er erst als Mann ohne Eigenschaften. „Kinder sind deshalb am schönsten“, meint Hegel, weil „das Kind in seiner Lebhaftigkeit als die Möglichkeit von allem erscheint“.[20] Das Kind ist das Urbild des modernen Menschen: Es hat noch keine Eigenschaften.
 Es
fühlt sich im Möglichen nicht minder zuhaus als im Wirklichen; eher
mehr. Sein – um mit Robert Musil zu reden – Möglichkeitssinn ist ihm
präsenter als sein Wirklichkeitssinn: „Alles könnte auch ganz anders
sein.“ Darum wurde das Kind zur großen Entdeckung der Romantik: „Der
frische Blick des Kindes ist überschwänglicher als die Ahndung des
entschiedensten Sehers“, und „ein Kind ist weit klüger als ein
Erwachsener: das Kind muß durchaus ironisches Kind sein“.[21]
Es
fühlt sich im Möglichen nicht minder zuhaus als im Wirklichen; eher
mehr. Sein – um mit Robert Musil zu reden – Möglichkeitssinn ist ihm
präsenter als sein Wirklichkeitssinn: „Alles könnte auch ganz anders
sein.“ Darum wurde das Kind zur großen Entdeckung der Romantik: „Der
frische Blick des Kindes ist überschwänglicher als die Ahndung des
entschiedensten Sehers“, und „ein Kind ist weit klüger als ein
Erwachsener: das Kind muß durchaus ironisches Kind sein“.[21]
Aber auch als Urbild ist es doch bloß ein Bild.
Mögen es sein frischer Blick und der „leichte Sinn für das Zeitliche“ (Fichte) auch auf vertrauten Fuß mit dem Unendlichen setzen – aber es ‚strebt’ ja nicht in der Welt, die „der Fall ist“. Sein Überschwang hält sich in den Grenzen einer ‚Welt’ ad usum Delphini: einer Kunstwelt des harmlosen Scheins. Da kostet es nichts, sich alles „ganz anders“ zu denken. Es ist Gedanken-Spielerei.
Unternehmer an der Grenze
Wirkliches Streben in der Welt der Tatsachen ist Arbeit, nicht Spiel. Der Mensch, der bloß arbeitet, wird zum Philister. Er arbeitet, um sich an seiner Statt einzurichten. Er strebt, um zu haben. Er ist Krämer. Ein Unternehmer ist der, dem am Gewinnen noch mehr gelegen ist als am Gewinn.
 |
Wo er nicht ist, dort ist sein Glück, und dahin ist er immer unterwegs. Er hat alles stets noch vor sich. Er lebt an einer Grenze, die nur da ist, damit er sie übertritt.
So weit als die Welt
So mächtig der Sinn
So viel Fremde er umfangen hält
So viel Heimat ist ihm Gewinn.[23]
Das ist das Menschenbild, das der Erziehung an der Jahrtausendwende vorzuschweben hat ; als Stachel, nicht als zu erfüllendes Maß. Nicht als Vorbild, wonach der Pädagoge seinen Zögling modelt, sondern als ein Gleichnis, in dem er sich selbst erkennt. Wenn nicht einmal die Pädagogen Unternehmer wären – ja wer denn dann?
*) geschrieben im Mai 1992
[1] Fichte, J. G., Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Hbg. 1979; ders., Wissenschaftslehre 1805, Hbg. 1984; Marx, K., und Friedrich Engels, Werke, Bd. 3; Erg.-Bd. I; Berlin 1983; 1968
[2] Marx, K., und Friedrich Engels, Werke, Bde. 23-25, Berlin 1970-74 ; Bd. 42, Berlin 1983
[3] Bachelard, G., Poetik des Raumes, Ffm. 1987, S. 188
[4] Eckart, Meister Johannes E. : Deutsche Predigten und Traktate (Hg. J. Quint) München 1979, S. 160
[6] Novalis, Werke, Bd. I, Zürich. 1945, S. 208
[7] Musil, R., Der Mann ohne Eigenschaften, Hbg. 1960, S. 869
[8] Novalis, aaO, S. 172
[9] Fichte 1984, S. 39
[10] Schelling, F. W. J., Werke, Bd. I, Ffm 1985, S. 193
[11] Musil aaO, S. 138f
[12] ebd., S. 234
[13] Novalis aaO, Bd. II, S. 10
[14] Marx 1968, S. 221
[15] Jean Paul (Richter, F.), Werke Bd. IV, Leipzig-Wien o.J. (Bibl. Inst.), S. 173
[16] Schlegel. Fr., Werke Bd. I, Berlin-Weimar 1980, S. 172, 182
[17] Novalis aaO, Bd. II, S. 17
[18] Schlegel aaO, S. 182
[19] Meister Eckart aaO, S. 196
[20] Hegel, G. W. F., Ästhetik Bd. I, Berlin-Weimar 1955, S. 153
[21] Novalis aaO, Bd. III, S. 63, 263
[22] Musil ebd., S. 130
[23] Brentano, Cl., Godwi, In: Werke (Hg. Kemp), Bd. 2; München 1963-68; S. 1
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen